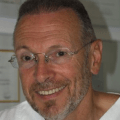Implantologie 31.01.2018
Implantatverluste im bestrahlten Kiefer
share
Literaturübersicht in Kombination mit einer Metaanalyse
Chirurgisch und strahlentherapeutisch behandelte Patienten leiden nicht selten an der postoperativ veränderten oralen Anatomie. Sprech- und Schluckvermögen sowie die Kaufunktion müssen wiederhergestellt werden. Die Rekonstruktionsmaßnahmen reichen von einer Vestibulumplastik und/oder einer Zungenlösung bis hin zum Ersatz des Kieferknochens mit freien oder gefäßgestielten Knochentransplantaten.1,2 Für die kaufunktionelle Rehabilitation ist der Einsatz dentaler Implantate von Bedeutung. Trotz Zunahme der Verwendung dentaler Implantate bei bestrahlten Tumorpatienten verbleibt eine Vielzahl unbeantworteter Fragen. Widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur behindern die Entwicklung von Therapiestandards. Ein systematischer Überblick kann helfen, Antworten auf ungelöste Fragen zu bekommen.
Die Therapie der Wahl des Mundhöhlenkarzinoms (MHCa) besteht in der radikalen Tumorentfernung ggf. mit Ausräumung der regionären Lymphknoten. Ziel der chirurgischen Therapie ist die histologische Tumorfreiheit der Resektionsränder. Im Fall einer R-1-Resektion mit Resten von Tumorgewebe wird i.d.R. eine adjuvante Strahlentherapie erforderlich. Die Strahlentherapie des MHCa hat folgende Nebenwirkungen: persistierende Hyposalivation, Veränderung der Speichelzusammensetzung, „Strahlenkaries“, Parodontalerkrankungen, Weichgewebs- bzw. Gefäßfibrose, Einschränkung der Mundöffnung, verzögerte Wundheilung und Osteoradionekrose.3–5 Eine zusätzliche Sauerstoffüberdruckbehandlung wird bei bestrahlten Patienten in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zur Prophylaxe der Osteoradionekrose seltener eingesetzt. Dieser Indikationsbereich betrifft vor allem Patienten, bei denen dentale Implantate im bestrahlten Kiefer vorgesehen sind.6 Dennoch erschweren widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur die Entwicklung von Therapiestandards. Folgender Beitrag gibt einen systematischen Literaturüberblick in Kombination mit einer Metaanalyse.
Material und Methode
Zum Erreichen dieser vorgegebenen Zielsetzung wurde eine internationale Literaturrecherche durchgeführt. Folgende Einschlusskriterien mussten dabei erfüllt sein:
- operierte MHCa-Patienten (adjuvante Bestrahlung der Kiefer vor oder nach Insertion dentaler Implantate)
- Originalarbeiten (randomisierte, nichtrandomisierte, prospektive, retrospektive klinische Studien mit einem Publikationsdatum zwischen 1985 und 2015)
Nicht relevante Literaturstellen wurden identifiziert und ausgeschlossen. Fallberichte, Übersichtsartikel und tierexperimentelle Studien wurden nicht berücksichtigt.
Bei der ausgewählten Literatur wurde die Rate der Implantatverluste bezogen auf die ursprünglich inserierten Implantate ermittelt. Im Rahmen einer Metaanalyse wurden die Implantatverluste in den Publikationen, in denen die Implantate vor der Bestrahlung gesetzt wurden, mit den Publikationen, bei denen die Implantate nach der Bestrahlung gesetzt wurden, verglichen.
Zusätzlich wurden bei den Publikationen mit Implantatinsertion nach der Bestrahlung die Verluste abhängig von der Lokalisation, applizierter Strahlendosis, hyperbare Sauerstofftherapie (HBO-Therapie) und dem Zeitintervall zwischen Bestrahlung und Implantation untersucht und verglichen. Zur Auswertung der Ergebnisse wurde die Odds Ratio (Quoten- bzw. Risikoverhältnis) als Quotient zweier Odds zusammen mit einem Konfidenzintervall von 95 Prozent und einem Signifikanzniveau von 0,05 ermittelt.
Ergebnisse und Diskussion
41 relevante klinische Publikationen konnten ausgewertet werden. Davon waren 29 (71 %) retrospektiv, zehn (24 %) prospektiv angelegt und nur zwei (5 %) randomisiert und kontrolliert.
Bei 34 der von uns ausgewerteten Publikationen fand die Implantatinsertion nach der Bestrahlung statt, in neun Publikationen vor der Bestrahlung. Die Anzahl der Implantatverluste war bei Patienten mit Insertion vor der Bestrahlung mit 49 von 602 inserierten Implantaten (8,13 %) kleiner als bei den Patienten mit Implantation nach der Bestrahlung mit 412 von 3.611 gesetzten Implantaten (11,40 %). Die im Rahmen der Metaanalyse durchgeführte statistische Auswertung ergab insgesamt einen signifikanten Unterschied der Verlustrate bei Implantation vor und nach der Bestrahlung (Abb. 1).
Die simultane Implantatinsertion zum Zeitpunkt der Tumor-OP vor Beginn der Bestrahlung bietet im Vergleich zur Insertion nach der Bestrahlung folgende Vorteile: Vermeidung der Implantatinsertion in einen strahlungsbedingt kompromittierten Kieferknochen, Verringerung des Komplikationsrisikos (z. B. einer Osteoradionekrose), Vermeidung eines weiteren chirurgischen Eingriffs zur Implantatinsertion und eine schnellere prothetische Rehabilitation.
Ein hypothetischer Nachteil der Bestrahlung nach der Implantation ist der Backscatter-Effekt im Bereich der Implantatoberfläche (sog. „hot spots“). Das Risiko einer dadurch ausgelösten Osteoradionekrose (ORN) im Unterkiefer ist jedoch vernachlässigbar gering.7,8
Der wesentliche Nachteil der simultanen Implantatinsertion zum Zeitpunkt der Tumor-OP ist das Risiko einer ungünstigen Implantatposition. Diese Gefahr ist besonders dann gegeben, wenn als Folge der Tumorresektion Veränderungen der anatomischen Situation und/oder der intermaxillären Beziehung resultieren, beispielsweise infolge einer Unterkieferkontinuitätsresektion. Dies kann dazu führen, dass die Implantate für die prothetische Versorgung überhaupt nicht eingesetzt werden können.9,10 Vermutlich deshalb wird die Insertion dentaler Implantate meist postoperativ vorgenommen.
Unabhängig vom Zeitpunkt der Implantatinsertion vor oder nach Strahlentherapie belegen aktuelle Übersichtsarbeiten, dass Implantatverluste überschaubar sind.11–16 Daher kann die Implantatversorgung von Tumorpatienten im bestrahlten Kiefer als relativ sicheres Verfahren angesehen werden. Zur Ermittlung der Implantatverluste bei Implantatinsertion nach Strahlentherapie wurden folgende Vergleiche durchgeführt:
- Lokalisation (Oberkiefer/Unterkiefer),
- applizierte Strahlendosis (< 50 Gy/ ≥ 50 Gy),
- HBO-Therapie (mit/ohne),
- Zeitintervall zwischen der Strahlentherapie und der Implantatinsertion (4–12 Monate/ ≥ 12 Monate).
In die hier durchgeführte Metaanalyse wurden Publikationen mit nur einer Vergleichsgruppe und mit einem Implantatverlust von null Prozent nicht in die Auswertung einbezogen.

Ad 1.: Vergleicht man die Gesamtzahl der Implantate im Oberkiefer mit der Gesamtzahl der Implantate im Unterkiefer, so gingen im Oberkiefer von den 497 gesetzten Implantaten 114 (22,93 %) und im Unterkiefer von den 2.406 gesetzten Implantaten 159 (6,60 %) verloren (Abb. 2). Die im Rahmen der Metaanalyse durchgeführte statistische Auswertung der Odds Ratio ergab im Oberkiefer einen signifikant höheren Implantatverlust verglichen mit dem Implantatverlust im Unterkiefer. Die Ergebnisse zeigen, dass im Oberkiefer die Bestrahlung einen ungünstigeren Einfluss auf den Implantatverlust zu haben scheint als im Unterkiefer. Nooh, Claudy et al., Chambrone et al. und Zen Filho et al. kommen in ihren vergleichenden Untersuchungen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das größere Risiko des Implantatverlustes im Oberkiefer wird mit einer ungünstigen Knochenqualität in Verbindung gebracht.14,15,17–21
Ad 2.: Beim Vergleich der Implantatverluste der Patienten mit einer Dosis von 50 Gy oder darüber mit den Patienten mit einer Dosis von unter 50 Gy zeigte sich, dass bei 50 Gy oder darüber von den 2.104 inserierten Implantaten 231 (10,97 %) verloren gingen, während es bei einer Dosis unter 50 Gy von den gesetzten 563 Implantaten nur bei 40 Implantaten zum Verlust kam (7,10 %; Abb. 3). Die im Rahmen der Metaanalyse durchgeführte statistische Auswertung der Odds Ratio ergab einen signifikant höheren Implantatverlust bei einer Bestrahlungsdosis von 50 Gy oder darüber, verglichen mit einer Bestrahlungsdosis von unter 50 Gy.
Über ein erhöhtes Risiko von Implantatverlusten bei höherer Gesamtstrahlendosis berichten zahlreiche Autoren.11,14,21–23 Das erhöhte Risiko wird mit einer reduzierten Regenerationsfähigkeit des Knochens bei höheren Dosen in Zusammenhang gebracht.22,24
Es lässt sich also feststellen, dass die Implantatverluste im bestrahlten Kiefer bei Gesamtdosen von über 50 Gy zunehmen dürften. Die auch bei höheren Gesamtdosen gut überschaubaren Implantatverluste und die implantatbedingte Verbesserung der Lebensqualität rechtfertigen eine Implantation auch bei Patienten mit höheren Strahlendosen.
Ad 3.: Beim Vergleich der Patienten mit und ohne zusätzlicher HBO-Therapie zeigte sich, dass bei Anwendung von hyperbarem Sauerstoff eine geringere Rate von Implantatverlusten als ohne zu verzeichnen war (8,67 % = 34 von 392 vs. 12,03 % = 375 von 3.116; Abb. 4). Die im Rahmen der Metaanalyse durchgeführte statistische Auswertung der Odds Ratio ergab einen signifikant höheren Implantatverlust bei Implantation ohne HBO-Therapie im Vergleich zur Implantation mit HBO-Therapie. Allerdings basiert dieses Ergebnis auf der Auswertung von nur drei Publikationen, was dessen Aussagekraft stark beeinträchtigen dürfte.
In der Literatur wird die HBO-Therapie kontrovers diskutiert. Marx et al. und Granström et al. zählen zu deren Verfechtern.4,25 Auch sehen Taylor und Worthington, Barber et al. und Fukuda et al. darin Vorteile.26–28 Keller et al., Niimi et al. und Wagner et al. hingegen sind der Ansicht, dass die Implantatinsertion im bestrahlten Kiefer auch ohne HBO-Therapie erfolgreich durchgeführt werden kann.19,22,29,30 Die von Schoen et al. durchgeführte prospektive randomisierte Studie ergab, dass eine HBO-Therapie keinen zusätzlichen Vorteil bringt.22 Derzeit ist eine abschließende Bewertung der HBO-Therapie sehr schwierig. Obwohl sie verzichtbar scheint, gibt es auch starke Befürworter. Randomisierte prospektive Studien könnten dazu beitragen, Klarheit über den zusätzlichen Nutzen zu schaffen.
Ad 4.: Beim Vergleich der Implantatverluste in Abhängigkeit vom Zeitintervall zwischen Strahlentherapie und Implantation zeigt sich, dass bei einem Zeitintervall von einem Jahr oder darüber von 1.369 inserierten Implantaten 110 (8,03 %), bei einem Zeitintervall unter einem Jahr von 677 Implantaten 78 (11,52 %) verloren gingen (Abb. 5). Die im Rahmen der Metaanalyse durchgeführte statistische Auswertung der Odds Ratio ergab einen signifikant höheren Implantatverlust bei einem Zeitintervall zwischen Strahlentherapie und Implantatsetzung von vier bis zwölf Monaten verglichen mit einem Zeitintervall von über einem Jahr.

Auch in den Studien von Anderson et al., Niimi et al., Visch et al. und Yerit et al. war der Implantatverlust größer, wenn das Zeitintervall unter einem Jahr lag, als bei einem Zeitintervall von einem Jahr oder darüber.13,21,29,31 Insgesamt gesehen scheint die Mehrzahl der Autoren eine Wartezeit nach Bestrahlung bis zur Implantatinsertion von mindestens einem Jahr zu favorisieren.19,29,31–33 Die Einschätzung genannter Autoren bezüglich des Implantationszeitpunktes deckt sich zum größten Teil mit den Ergebnissen der bereits 1993 publizierten experimentellen Untersuchungen von Stoll und Wächter. Letztere konnten sowohl im Tierversuch als auch am bestrahlten menschlichen Unterkiefer zeigen, dass die osteogenetische Aktivität bis zu einem halben Jahr nach der Bestrahlung am geringsten ist. Anschließend steigt die Aktivität wieder kontinuierlich an. In kritischen Fällen empfehlen die Autoren vor der geplanten Implantation eine Biopsie zur Beurteilung der Knochenqualität.8
In der vorliegenden Literaturrecherche konnte lediglich die Anzahl der verloren gegangenen Implantate beurteilt werden. Es ist nicht möglich, auf den Funktionszustand der verbliebenen Implantate, z. B. deren periimplantäre Situation, einzugehen. Dafür ist der Informationsgehalt der ausgewerteten Publikationen nicht ausreichend. Auch weisen die untersuchten Studien beträchtliche Unterschiede im Hinblick auf den Untersuchungszeitraum, die Implantatsysteme, die Bestrahlungsdosis, die exakte Implantatlokalisation und den Zeitpunkt der Implantatsetzung bezogen auf die Strahlentherapie auf. Zudem ist die Anzahl auswertbarer Studien begrenzt. Es handelt sich dabei ohnehin meist um retrospektive Studien, die oft sehr schwierig untereinander zu vergleichen sind. Wünschenswert wäre es, auf mehr prospektiv randomisierte Studien zurückgreifen zu können, deren Aussagekraft mehr Sicherheit bei der Interpretation der Ergebnisse liefern würde.
Schlussfolgerung
Die in der vorliegenden Arbeit ausgewertete Literatur weist darauf hin, dass Implantatverluste bei operierten und bestrahlten MHCa-Patienten insgesamt überschaubar sind. Die aktuellsten Publikationen bestätigen dies bei entsprechend individualisierter Indikationsstellung.
Eine ausführliche Analyse der Odds Ratio der Implantatverluste bieten die tabellarischen Darstellungen hier.
Die vollständige Literaturliste gibt es hier.
Der Fachbeitrag ist im Implantologie Journal 1/2018 erschienen.