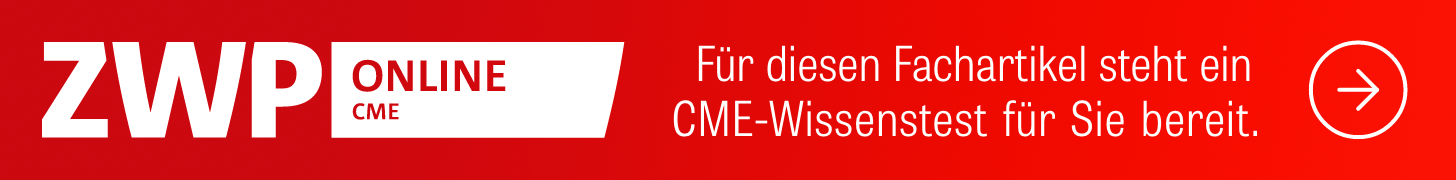Parodontologie 18.05.2022
Parodontitis in der Schwangerschaft: Erhöhtes Risiko für Frühgeburt
share
Trotz des medizinischen Fortschritts ist es bislang nicht gelungen, die Anzahl von Frühgeburten und Geburten mit niedrigem Geburtsgewicht zu reduzieren. Gegenstand klinischer Studien auf der Suche nach Risikofaktoren sind Übergewicht, Rauchen und Alkoholgenuss, ethnische oder sozial-ökonomische Zugehörigkeit, Bildungsgrad, familiäre Verhältnisse, genetische Faktoren und Infektionen. Auch die Parodontitis ist als möglicher Risikofaktor in den Fokus geraten. Die Identifizierung von parodontalen Entzündungen als möglicher kausaler Faktor für die Auslösung negativer Schwangerschaftsverläufe hat großes interdisziplinäres Potenzial und kann zur Einsicht beitragen, dass zahnmedizinischem Fachpersonal wichtige prophylaktische Aufgaben auch aus dieser Perspektive übertragen werden sollten.
Die Forschungsansätze zur Beurteilung der Risikofaktoren und Auslöser von Frühgeburten und Geburten mit niedrigem Gewicht sind vielfältig und die Fragestellungen, Studiendesigns und Resultate daher nur schwer vergleichbar. Ziel dieses CME-Artikels ist es, anhand einer systematischen Literaturrecherche den aktuellen Forschungsstand zur möglichen Risikoreduzierung für Frühgeburten (PB) und Geburten mit niedrigem Gewicht (LBW) zu ermitteln, kritisch zu bewerten, weiteren Forschungsbedarf festzustellen und dem zahnmedizinischen Fachpersonal die Bedeutung der Betreuung und Versorgung von Schwangeren zu verdeutlichen.
Definition zentrale Begriffe
Von einer Frühgeburt wird nach Lawn et al. (2010) gesprochen, wenn eine Lebendgeburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche stattfindet.1 Mit 27 Prozent gelten sie um die Jahrtausendwende weltweit als Hauptgrund für den frühen Tod von Neugeborenen nach der Geburt. In absoluten Zahlen waren das mehr als eine Million weltweit. Nach Hughes et al. (2017) wird niedriges Geburtsgewicht seit 1948 nach den Standards der World Health Organization (WHO) mit weniger als 2.500 Gramm definiert.2
Eklampsie ist die Folge von Präeklampsie während der Schwangerschaft und wird als plötzliches Auftreten tonisch-klonischer Krämpfe bei chronischem oder gestationsbedingtem Bluthochdruck nach der 20. Schwangerschaftswoche, aber auch während und nach der Geburt definiert. Früher wurde die Proteinämie als Signal für die Präklampsie angesehen. Nachdem schwere Krankheitsstadien von Eklamsie vor dem Auftreten von Proteinurie beobachtet wurden, gilt heute für die Diagnose Präeklampsie das Auftreten von erhöhtem Blutdruck während der Schwangerschaft von systolisch ≥ 140 mm Hg und/oder diastolisch ≥ 90 mm Hg 20 Wochen nach der Gestation mit Proteinurie und Multiorgandysfunktion.3
Die Parodontitis ist eine chronische Entzündung aller parodontalen Gewebe, die durch einen multibakteriellen Biofilm ausgelöst wird, der mit dem apikal voranschreitenden Attachmentverlust optimale Lebensbedingungen für immer mehr parodontopathogene Keime bietet. Dadurch können diese ihre Virulenz und die des gesamten Biofilms steigern. In diesem Prozess spielt die individuelle Immunantwort des Patienten eine entscheidende Rolle.4,5 Als modulierende Faktoren treten lokale, genetische sowie epigenetisch bedingte Faktoren in Erscheinung und tragen dazu bei, dass sich aus der reversiblen Gingivitis die irreversible Parodontitis entwickelt.6,7
Methode der Literaturrecherche
Um den aktuellen Forschungsstand zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Parodontitistherapie während der Schwangerschaft und der Risikoreduktion von PB und LBW zu eruieren, wurde eine Recherche in der Datenbank „Pubmed“ durchgeführt. Dabei erfolgte eine Eingrenzung auf den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 1. März 2022. Als weitere Filter wurde die Beschränkung auf die englische und deutsche Sprache gewählt. Um Ergebnisse auf einem möglichst hohen Evidenzniveau zu erhalten, wurde als weiterer Filter randomisierte klinisch kontrollierte Studien gesetzt. Dies führte zur Auswahl von 19 Studien als Basis dieser Übersichtsarbeit. Ergänzt wurde die systematische Recherche durch eine manuelle Suche, um Literatur zu eruieren, die für die Klärung von Fragen im Kontext dieser Untersuchung benötigt wurde.
Ergebnisse
Bezogen auf die Kernfrage, ob eine Parodontitisbehandlung während der Schwangerschaft, genauer mit Abschluss spätestens vor dem Ende des zweiten Schwangerschaftstrimenons, zu einer Reduktion von PB und LBW führt, zeigt die Auswertung der Studien folgende grundlegende Verteilung. Es gibt (Abb. 1):
- neun Studien ohne Bestätigung eines Zusammenhangs
- fünf Studien ohne Aussage zu einem Zusammenhang
- fünf Studien, die einen Zusammenhang zeigen
Die Mehrzahl der Studien seit 2010 konnte keinen Zusammenhang zwischen Parodontitisbehandlung und PB bzw. LBW bestätigen. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang die in einigen Studien angeführten möglichen Gründe für diesen fehlenden Nachweis. So legen die Autoren nahe, dass ein Zusammenhang trotz der negativen Befunde bestehen könnte und weiter erforscht werden sollte. Einerseits verweisen die Hypothesen für das Ausbleiben eines Nachweises für den untersuchten Zusammenhang auf weiteren Forschungsbedarf und andererseits auf Probleme des Studiendesigns, die gelöst werden müssen, um einen ggf. bestehenden Zusammenhang erfolgreich nachweisen zu können.
Macones et al. (2010) nennen typische offene Fragen bzw. Faktoren, die das negative Studienergebnis bewirkt haben könnten8, u. a. die fehlende einheitliche Definition von Parodontitis, die fehlende sichere Unterscheidung von verschiedenen Schweregraden, die unterschiedliche ethnische Zusammensetzung der in die Studien einbezogenen Populationen und die von der Forschung noch nicht geklärte Frage, ob ein früherer Zeitpunkt der Parodontitisbehandlung sich auf PB und LBW auswirken würde.
In der Studie von Harper et al. (2012), in der eventuelle synergistische Effekte von Vaginosis und Parodontitis nicht nachgewiesen werden konnten, wird darauf verwiesen, Parodontitis nicht als kausalen Risikofaktor für PB anzusehen.9 Stattdessen sollte sie – zusammen mit anderen Infektionen – als klinischer Marker betrachtet werden, der auf eine erhöhte Risikoexposition für PB schließen lässt. Deren Ursachen – sei es genetisch, umweltbedingt oder bislang gänzlich unerkannt – seien noch zu erforschen. Weidlich et al. (2013) konnten durch ihr Studiendesign, das einen besonderen Fokus auf den Erfolg der Parodontitisbehandlung legte, das Argument entkräften, dass in anderen Studien eine nicht beachtete, nach der Behandlung fortbestehende Parodontitis zu negativen Ergebnissen bezüglich des untersuchten Zusammenhangs von Parodontitis und PB bzw. LBW geführt hat.10 In dieser Studie wird auch festgehalten, dass kein Effekt der Therapie auf das Auftreten einer Präeklampsie eruiert werden konnte. Eklampsie galt in keiner Studie ein eigenständiges oder zentrales Forschungsinteresse.
Gegen die Auslösung einer Bakteriämie oder von entzündlichen Prozessen mit entsprechender Immunantwort durch die Behandlung sprechen die Ergebnisse von Pirie et al. (2013), die keinen Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe bezüglich bestimmter Zytokin/Interleukin-Level feststellen konnten11, was ähnlich bei Fiorini et al. (2013) und Penova-Veselinovic et al. (2015) zu beobachten war.12,13
Der mögliche Wirkungszusammenhang zwischen Parodontitis und PB/LBW, der die Translokation oraler Pathogene in den Uterus und die Plazenta unterstellt, ist nach Penova-Veselinovic et al. (2015) damit jedoch nicht widerlegt13, da nur eine geringe Anzahl möglicher Zytokine bisher untersucht werden konnte und durch die Schwangerschaft ausgelöste weitreichende hormonelle und immunologische Veränderungen die Resultate der Studien überdeckt haben könnten. Auch Penova-Veselinovic et al. (2015) gehen von der Existenz eines die Risikoexposition selektiv erhöhenden, individuellen, genetischen mütterlichen Phänotyps aus,13 der sowohl eine Parodontitis als auch PB/LBW wahrscheinlicher macht. Dies verweist auf die Notwendigkeit weiterer Forschung zur Identifizierung dieser Risikogruppen und eventuell biologischer Marker, die sie klinisch erkennbar machen. Auch hier zeigen sich Ähnlichkeiten zu den Beobachtungen von Caneiro-Queija et al. (2019).14 Den Studien, die den Zusammenhang zwischen Parodontitisbehandlung und PB bzw. LBW nicht bestätigen konnten, ist gemein, dass die nichtchirurgische Therapie in den Interventionsgruppen zu einer signifikanten Verbesserung der klinischen Symptome führte oder die Progression der Erkrankung aufhielt und somit für die Schwangeren sicher war.10–12,14 Jiang et al. (2015 und 2016) erreichten lediglich durch Gabe eines antibakteriellen Mundwassers ohne Alkohol bis zum Ende der Schwangerschaft parodontale Verbesserungen in ihrer Studie, auch ohne SRP-Behandlung.15,16
Studien ohne Bestätigung eines Zusammenhangs
Bei Ebersole et al. (2010) wird der Nachweis der niedrigschwelligen und daher klinisch unter Umständen nicht in Erscheinung tretenden systemischen bakteriellen Belastung durch eine Parodontitis erbracht.17 Die Resultate von Geisinger et al. (2014) bestätigen die Mechanismen, die in der Schwangerschaft zum Auftreten und zur Progression von Parodontitis sowie Gingivitis führen.18 Hier wird die Hypothese in den Raum gestellt, dass die Vernachlässigung einer fortbestehenden Gingivitis, die auf die Parodontitis bezogenen Resultate anderer Studien – wie die von Offenbacher et al. (2009) und Michalowicz et al. (2006)19,20 – verfälscht haben könnte. Die Studie von Webb et al. (2014) stärkt die Aufmerksamkeit dafür, dass es Gruppen gibt, die von dem Risiko für PB und LBW besonders betroffen sind und von einer Parodontitisbehandlung besonders profitieren können.21 Dies könnte auch ein Hinweis auf eine Ursache für den fehlenden Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Parodontitis, PB und LBW in solchen Studien sein. Die „bedrohten“ Gruppen („target populations“), die selektiv von einer Therapie während der Schwangerschaft zur Reduktion von PB und LBW profitieren können, wären durch entsprechend ausgelegte Studien noch genauer zu identifizieren.
Studien, die einen Zusammenhang bestätigen
Unter den Studien, die einen Zusammenhang zwischen Parodontitisbehandlung in der Schwangerschaft und der Reduktion von PB bzw. LBW bestätigen konnten, nimmt die von Jeffcoat et al. (2011), welche die früheste dieser Art im Untersuchungszeitraum ist, eine Sonderstellung ein.22 Sie nahm eine retrospektive und damit bezogen auf die untersuchte Forschungsfrage fundierte Definition von Parodontitis vor, indem sie den parodontalen Status von Frauen, die später eine Frühgeburt erlitten, zur Grundlage für die weiteren Phasen ihrer Studie machte. In der Studie wurde zwar kein Unterschied zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe bezüglich des Zusammenhangs von Behandlung und PB/LBW festgestellt, aber innerhalb der Interventionsgruppe trat ein statistisch signifikanter Unterschied bezüglich des Eintretens von PB auf, genauer zwischen den Schwangeren, bei denen die Parodontitistherapie erfolgreich war bzw. nicht. Damit stehen die Ergebnisse teilweise im Widerspruch zu denen von Weidlich et al. (2013).10 Die Resultate von Jeffcoat et al. (2011) zeigen einerseits die wichtige Bedeutung der Definition von Parodontitis, andererseits die Notwendigkeit, die Behandlung nicht nur durchzuführen, sondern ihren Erfolg auch sicherzustellen und zu dokumentieren.22 Da die Studie mit einer Risikogruppe für PB durchgeführt worden ist, verdeutlichen die Ergebnisse den möglichen Einfluss der in die Studie einbezogenen Population auf den Studienausgang. Die Studie von Jeffcoat et al. (2014) hatte zum Ziel, den Mechanismus zu ermitteln, der das Scheitern der Behandlung bewirkt haben könnte bzw. auch kausal für das Auslösen von PB sein könnte.23 Ein Gen-Polymorphismus des ProstaglandinRezeptors3 (Subtyp EP3), PTGER3, konnte statistisch signifikant sowohl mit dem Scheitern der Parodontitisbehandlung als auch dem Auftreten von PB assoziiert werden. Die Verbindung zwischen PTGER3, PB und Parodontitis könnte nach Jeffcoat et al. (2014) darin liegen, dass dieses Prostaglandin mit der Auslösung von Kontraktionen bei der Geburt in Zusammenhang steht und – zumindest in der untersuchten Population – mit einer Anfälligkeit für eine individuelle Entzündungsreaktion die Progression der Parodontitis förderte.23 Jeffcoat et al. (2014) sprechen aber nicht vom Nachweis einer genetischen Disposition für PB und Parodontitis, sondern lediglich von einer möglichen Kausalkette, die mit beidem in Verbindung stehen könnte.23 Reddy et al. (2014) führten in einer Studie mit einer kleinen Zahl von indischen Probandinnen (n = 20) vor Abschluss der 28. Schwangerschaftswoche eine Parodontitisbehandlung durch und erreichten eine Reduktion von PB und LBW.24 Parodontitis wurde als Attachmentverlust ≥ 1 mm, PD ≥ 4 mm bei mehr als vier Zähnen in jedem Quadranten definiert. Die Studie belegte außerdem eine Reduktion der Immunoglobin-Antikörperkonzentration in der Interventionsgruppe als Hinweis auf eine verringerte Exposition des Fötus gegenüber mütterlichen parodontalen Pathogenen. Die von Reddy et al. (2014) unterstellten Wirkmechanismen sahen die Parodontitis als Reservoir entzündlicher Mediatoren, die eine vermittelte Entzündungsreaktion auslösten, bzw. gingen von einer systemischen intraunterinen Translokation mütterlicher oraler Keime aus.24
In der Studie von Michalowicz et al. (2006) haben in der Interventionsgruppe 413 Schwangere mit milder bis mäßiger Parodontitis eine SRP-Behandlung vor der 21. Schwangerschaftswoche erhalten, während eine Kontrollgruppe von 410 Frauen lediglich zahnmedizinisch untersucht wurde.20 PB trat in der Interventionsgruppe 49 Mal auf und in der Kontrollgruppe 52 Mal, was Michalowicz et al. (2006) hatte schließen lassen, dass kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Parodontitisbehandlung und PB bestünde.20 Merchant et al. (2018) kommen durch neue epidemiologische statistische Verfahren jedoch zum gegenteiligen Ergebnis bezüglich der Neubewertung der Daten aus der Studie von Michalowicz (2006). Die Autoren gehen davon aus, dass die Behandlung in der Interventionsgruppe Fehl- und Totgeburten reduziert hat und dass Interventions- und Kontrollgruppe durch die ungleiche Verteilung von Fehl- und Totgeburten (5/413 bzw. 14/410) nicht mehr vergleichbar waren20,25, als die Effekte der Therapie auf den Ausgang „PB“ hin geprüft wurden. Der Verlust der Vergleichbarkeit der beiden Studiengruppen durch die unterschiedliche Überlebensrate und Risikoverteilung am Ende der Schwangerschaft hatte die positiven Effekte der Behandlung auf die Reduktion von PB maskiert.
Abschließend bestätigten Novák et al. (2018) im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit in einer ungarischen Studie mit 150 Schwangeren einen Zusammenhang zwischen Parodontitistherapie in der Schwangerschaft und der Reduktion von PB und LBW.26 In einer Risikogruppe für PB bewirkte die Behandlung bei Schwangeren mit Parodontitis ein signifikant höheres Geburtsgewicht und eine längere Schwangerschaft mit statistischer Signifikanz bei Patientinnen, die unter Gingivitis litten. Anzumerken ist, dass von dieser Studie lediglich das Abstract in englischer Sprache zur Verfügung steht, dass aber die wesentlichen Angaben zum Design und zu den Resultaten enthält. Zur Vervollständigung aller für den Untersuchungszeitraum dieser Arbeit relevanten Studien wurden die Resultate von Novák et al. (2018) daher mit aufgenommen.26
Diskussion
Zahlreiche medizinische Befunde, Verhaltensweisen oder Lebensumstände werden als Risikofaktoren mit PB und LBW in Verbindung gebracht. Unter anderem sind das eine vorhergehende Frühgeburt, ein niedriger Body-MassIndex, Alkoholgenuss, Rauchen und die ethnische Zugehörigkeit.22,27 Aber auch Infektionen und insbesondere die Parodontitis gelten seit mehreren Dekaden als mögliche kausale Faktoren für die Auslösung von PB und LBW.28,29 Die ausgewählten Quellen stellen sowohl eine breite als auch aktuelle Datenbasis dar, die aber wegen ihrer Komplexität und Heterogenität die Frage der geeigneten Systematisierung und Auswertung der Ergebnisse aufwarf. Denn obwohl sich die Studien zur Klärung der im Zentrum stehenden Frage und der damit verfolgten Zielsetzung grundsätzlich geeignet erwiesen haben, bezogen sie sich auf unterschiedliche Länder und unterschiedliche Patientinnengruppen. Sie untersuchten verschiedene spezifische Fragestellungen und wandten unterschiedliche Methoden an. Die Studien bezogen sich zudem auf unterschiedliche Variablen, wie etwa Alter, Familienstand, Bildungsgrad, ethnische Zugehörigkeit, sozio-ökonomischen Status, frühere Schwangerschaftsverläufe, Anzahl gesunder Zähne oder Body-MassIndex in abweichenden Kombinationen.14 Ebenso gab es erhebliche Variationen bei den Ausschlusskriterien für die Aufnahme von Patientinnen in die Interventions- oder Kontrollgruppen wie etwa Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme, Raucherstatus, laufende Parodontitisbehandlung, Verwendung antiseptischer Mundwasser oder Alkohol- und Drogenkonsum. Neben der Problematik der „confounding effects“, welche die Interpretation der Studienergebnisse grundsätzlich erschweren oder sogar vorhandene Effekte überdecken können, prägen die Unterschiede im Studiendesign den Forschungsstand, da sie einerseits die Vergleichbarkeit der Resultate stark einschränken, andererseits aber sogar ihre abweichenden Ergebnisse erklären können bzw. diese relativieren. Darüber hinaus haben Macones et al. (2010) gezeigt8, dass auch die statistische Auswertung der gewonnenen Daten von erheblicher Bedeutung ist, da ihre erneute Auswertung in der Studie von Michalowicz et al. (2006)30, die den Zusammenhang Parodontitisbehandlung und PB nicht bestätigt hatte, mit neuen statistischen Verfahren zu einer gegensätzlichen Bewertung und damit zu einer Bestätigung des Zusammenhangs führte. Selbst innerhalb ein und derselben Studie sind die Datenlage und Interpretation der Forschungsresultate bezogen auf die zentrale Untersuchungsfrage also abhängig von der methodischen Herangehensweise und dem Fortschritt der Datenanalyse. Angesichts der hohen globalen Prävalenz sowohl von PB als auch von LBW fällt auf, dass zahlreiche Studien als weitere Limitation die geringe Zahl von Studienteilnehmerinnen oder eine zu kurze Studiendauer angeben. In diesem Zusammenhang kann auch die insgesamt geringe Zahl von 19 Studien innerhalb einer Dekade kritisch gesehen werden. Spezifische Zusammenhänge, wie z. B. ein Zusammenhang der Parodontitis mit Eklampsie, sind noch nicht in den Fokus der Forschung gelangt, sondern wurden bestenfalls am Rande einer Studie mit beobachtet. Umgekehrt kann das oft als Limitation genannte unterschiedliche Studiendesign auch als Stärke der Forschung insgesamt gesehen werden, denn nur verschiedenartige Studiendesigns mit spezifischen Forschungsfragen können z. B. „target populations“, Wirkungszusammenhänge, Kausalitätsketten und eventuell beteiligte Zytokine oder Chemokine eindeutig identifizieren.Trotz zahlreicher offener Fragen lässt sich im Ergebnis festhalten, dass die aktuelle Forschung von einem Zusammenhang zwischen Parodontitis und PB bzw. LBW ausgeht. Selbst Studien, die den Zusammenhang nicht bestätigen konnten, versuchen Hypothesen für das Ausbleiben dieses Nachweises zu entwickeln, die weiteren Forschungsbedarf begründen. Starke Hinweise sprechen für die Existenz von „target populations“, die besonders von PB/LBW bedroht sind und von einer Behandlung profitieren könnten.
Bereits die Studien, die vor der in dieser Untersuchung im Zentrum stehenden Dekade seit 2010 bezüglich eines möglichen Zusammenhangs von Parodontitis und PB sowie LBW – bzw. ihrer Behandlung in der Schwangerschaft und der Reduktion von PB und LBW durchgeführt wurden – waren im Ergebnis uneinheitlich. Neben Untersuchungen, die keinen Zusammenhang feststellen konnten19,30,31, standen solche, bei denen die Therapie reduzierende Effekte auf das Auftreten von PB und LBW zeigte.32–34 Bei der wissenschaftlichen Bewertung der jeweiligen Studienergebnisse bleibt zudem zu beachten, dass bei einem hohen Anteil der Fälle von PB – López et al. (2005) sprechen von mehr als 50 Prozent35 – die Ätiologie nicht bekannt ist.32 Des Weiteren besteht bei allen Studien durch die große Zahl möglicher Risikofaktoren für PB das Problem der „confounding effects“, also, dass neben der Parodontitis und ihrer Behandlung andere Faktoren das Studienergebnis beeinflussen, sie abgeschwächt oder überdeckt haben können.11,27,30
Für die Forschung sowie die klinische Praxis lässt sich aus dieser Übersichtsarbeit folgern, dass unter Umständen die Parodontitisbehandlung gerade bei den Schwangeren scheitert, für die auch ein erhöhtes Risiko für PB besteht. Der Erfolg der Therapie sollte also unbedingt im Blick behalten werden. Umgekehrt ist jedoch auch eine erfolgreiche Behandlung unter Umständen nur für bestimmte Gruppen von Schwangeren oder Populationen eine Maßnahme, die das Risiko für PB mindert. Hier entsteht eine Schnittmenge aus den Folgerungen für die Forschung und die Perspektive auf das Problem zwischen den oben dargestellten Studien, die keinen Nachweis des Zusammenhangs zwischen Therapie und PB/LBW erbringen konnten, und solchen, denen das gelungen ist.Wenn also unterstellt wird, dass es Gruppen gibt, die von einer erfolgreichen Behandlung stärker profitieren als andere, ist nachzuvollziehen, dass es auch Studien wie die von Reddy et al. (2014) gibt, die den untersuchten Zusammenhang zwischen Parodontitisbehandlung und PB bzw. LBW eindeutig bestätigen konnten24. Die von Reddy et al. (2014) ebenfalls festgestellte Reduktion der Immunoglobin-Antikörperkonzentration in der Interventionsgruppe gibt für die weitere Forschung wichtige Hinweise für das Erkennen des möglicherweise wirkenden Mechanismus zwischen Parodontitis und PB bzw. LBW24: Die erhöhte Exposition des Fötus gegenüber mütterlichen parodontalen Pathogenen erfolgt entweder direkt durch eine systemische intrauterine hämatogene Translokation der Keime oder infolge einer zytokinvermittelten Entzündungsreaktion. Ähnlich einzuschätzen im Sinne einer zukünftigen Ausrichtung der Forschung ist die Studie von Jeffcoat et al. (2014), die vergleichbare Hinweise auf genetische Polymorphismen als Ursache sowohl für eine erfolglose Behandlung als auch für die Erhöhung des Risikos für PB feststellen konnte.23
Für die weitere Forschung und klinische Praxis sind die Klärung der bakteriologischen, immunologischen oder genetischen Wirkmechanismen, die zwischen Parodontitis und PB/LBW bestehen sowie das Identifizieren von klinischen Markern von besonderer Bedeutung, unabhängig davon, ob Parodontitis sich als eigenständiger kausaler Auslöser von PB/LBW oder als assoziierter Risikofaktor erweisen wird. Für die Beschäftigten in der Zahnmedizin gilt bereits jetzt als gesichert, dass die Parodontitisbehandlung in der Schwangerschaft sicher ist.8,20
Fazit
Auch wenn nicht alle aufgeführten Studien den Zusammenhang zwischen der Parodontitisbehandlung zur Verringerung des Risikos für negative Schwangerschaftsausgänge wie PB, LBW und Eklampsie bestätigen konnten, wird in der Forschung aktuell davon ausgegangen, dass er besteht und durch weitere Studien zu verifizieren ist. Dass ein eindeutiger und im Einzelfall klinisch belegbarer Zusammenhang nachweisbar wird, ist beim jetzigen Stand der Forschung und dem komplexen Zusammenspiel mehrerer Risikofaktoren sowie der weitreichenden hormonellen und immunologischen Veränderungen durch die Schwangerschaft selbst kaum in Kürze zu erwarten. Zunächst müssen in weiteren Studien, die jeweils nur Teilaspekte untersuchen können, systemische Folgen der Parodontitis, die immunologischen Wirkmechanismen und auch eventuelle genetische Prädispositionen geklärt werden. Die entsprechenden Forschungsanstrengungen sollten angesichts der globalen Verbreitung von Parodontitis, PB und LBW verstärkt werden. Unabhängig von den noch offenen Forschungsfragen lässt sich eine praktische Folgerung und sogar Forderung für die Beschäftigten im Bereich der Zahnmedizin als Ergebnis dieses Reviews formulieren. Da sich in den einbezogenen Studien die Parodontitisbehandlung in der Schwangerschaft als sicher erwiesen hat und nach aktuellem Forschungsstand von einem Zusammenhang zwischen Parodontitis und PB/LBW auszugehen ist, sollte in Beratung und Therapie von Schwangeren auf den klinischen parodontalen Status geachtet und ggf. eine notwendige Behandlung auch in der Schwangerschaft während des zweiten Trimenons durchgeführt werden. Eine Verbesserung der klinischen Zeichen für Parodontitis ist sehr wahrscheinlich und die Verhinderung von PB und LBW schließlich möglich.
Eine Literaturliste steht hier für Sie bereit.
Autoren: Hoda Zafari, B.Sc., Prof. Dr. Georg Gaßmann
Dieser Fachbeitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.
Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren .