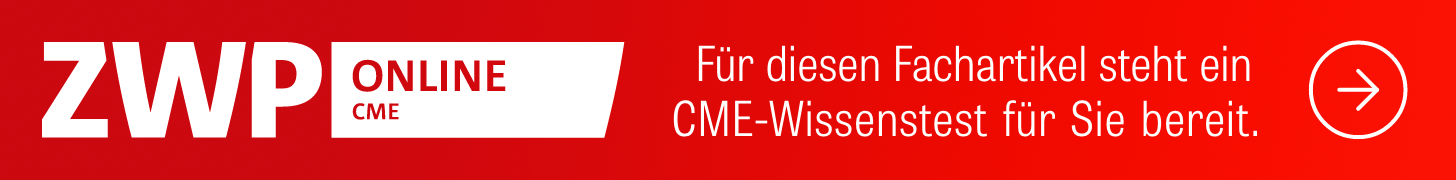Prophylaxe 14.12.2021
Neurotoxizität von Fluoriden? Einschätzung der Studienergebnisse
share
Teil II – Einschätzung der Studienergebnisse
Im ersten Teil des Artikels wurde eine Einführung in das Thema gegeben und die Systematik der Literaturrecherche sowie deren Ergebnisse dargestellt. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse diskutiert und das Fazit gezogen. So soll das zahnmedizinische Prophylaxepersonal in die Lage versetzt werden, kompetent auf die Argumente der Fluoridgegner einzugehen. Ziel dieses zweiteiligen Artikels ist, zu zeigen, ob sich in der wissenschaftlichen Literatur der Verdacht, dass Fluoride aus Zahnpflegeprodukten durch ihre potenzielle Neurotoxizität zur Intelligenzminderung von Kindern führen können, bestätigen oder widerlegen lässt .
Einleitend kann konstatiert werden, dass durch Niu et al. (2018a) dargestellt werden konnte, dass eine sehr hohe Fluoridexposition zu einer verminderten Lern- und Gedächtnisleistung führen kann.1 Darüber hinaus konnte die Studie zeigen, dass eine erhöhte Konzentration von Natriumfluorid (NaF) übermäßigen Stress im Endoplasmatischen Retikulum (ER) auslösen kann, der eine autophage Dysfunktion induzierte.1 Nach Sarkar et al. (2014) und Yin et al. (2017) spielt die Autophagie eine erhebliche Rolle für die Aufrechterhaltung der Zellhomöostase, während eine induzierte Dysfunktion einen neuronalen Zelltod verursacht, der neuro- degenerative Erkrankungen nach sich ziehen könnte.2,3 In Studien von Zhang et al. (2007), Wu et al. (2015) und Liu et al. (2011) konnte ebenfalls übereinstimmend festgestellt werden, dass eine übermäßige NaF-Exposition eine Apoptose in den expositionierten Zellen induziert.4–6 Diese Ergebnisse wurden sowohl im Gehirn der Ratte als auch an permanenten humanen Neuroblastom- SH-SY5Y-Zellen beobachtet. Permanente Zellen werden in der Regel aus Tumoren gewonnen. Sie haben den Vorteil gegenüber primären Zellen aus gesundem Gewebe von Individuen, dass sie auch nach „unendlichen“ Passagen (Replika- tionszyklen) ihre Charakteristiken bei- behalten. Tu et al. (2018) konnten ebenfalls bestätigen, dass durch hohe NaF- Konzentrationen eine Apoptose hervorgerufen werden kann und diese durch einen aktivierten p53-Pfad in den SH-SYS5-Zellen ausgelöst wird.7 In der Studie von Chen et al. (2018) wurde die Auswirkung von hohen NaF-Konzentrationen auf die Synaptogenese untersucht.8 Nach Lyaruu et al. (2008) wiesen Ratten, deren Trinkwasser mit 50 mg/l NaF angereichert wurde, mit 0,79 µM die gleichen Serumfluoridwerte auf, die bei Menschen beobachtet werden konnten, nachdem sie einer NaF- Konzentration von 2–5mg/l ausgesetzt waren.9 Aus diesem Grund verwendeten Chen et al. (2018) höhere Konzentrationen, um die Studienergebnisse auf den Menschen übertragen zu können.8 Die Ergebnisse von Chen et al. (2018) stimmen mit der Studie von Niu et al. (2018b) überein.8,10 Die Invitro-Ergebnisse in der Studie von Chen et al. (2018) zeigten zudem morphologische Veränderungen der Synapsen in SH-SY5Y-Zellen, die vorab mit NaF behandelt wurden.8 Wie aussagekräftig diese Ergebnisse waren, ist jedoch fraglich, da die Stichprobenanzahl für jede Fluoridexposition sehr gering war. Guth et al. (2020) erstellten ein Review zur Überprüfung der wissenschaftlichen Evidenz zur Neurotoxizität durch Fluoride und zeigten auf, dass einige Studienergebnisse zweifelhaft sind, da die Tierversuche in einigen Aspekten nicht den aktuellen Qualitätsstandards entsprechen, sodass die Ergebnisse nicht eindeutig auf eine fluoridinduzierte Toxizität zurückzuführen seien.11 Zudem sollte beachtet werden, dass es sich in den vorgestellten Studien um eine systemische Fluoridierung handelt, die nicht auf eine topische Fluoridanwendung von Dentalprodukten übertragen werden kann. In vielen Studien konnten messbare Ergebnisse im Hinblick auf die Toxizität gezeigt werden, wenn die Fluoridkonzentration ca. 333-mal höher liegt als von einem gesunden Erwachsenen toleriert wird.11 So ist die Anwendung der Studienergebnisse auf die tägliche Dosis von prophylaktisch topisch angewendeten Fluoriden in Deutschland gering bis nicht vorhanden und somit das Risiko einer Fluoridakkumulation bei lokaler Anwendung gering. Tabelle 1 gibt einen Überblick nach Altersgruppen.
Diskussion der Studienergebnisse
Die Metaanalyse von Tang et al. (2008) zeigte den Zusammenhang zwischen hohen Fluoridkonzentrationen und einer Abnahme des IQs von Kindern um fünf Punkte.12 Die Autor*innen räumten jedoch ein, dass die Meta-Analyse nur bedingt repräsentativ war. Anlässlich der geringen Aussagekraft wurde 2012 eine erneute Meta-Analyse von Choi et al. (2012) durchgeführt.13 Die Autor*innen bestätigten die Aussage von Tang et al. (2008), dass der IQ von Kindern infolge hoher Fluoridkonzentrationen sinkt.12 Jedoch zeigte sich, dass die Intelligenzminderung nicht mehr fünf Punkte betrug, sondern nur noch 0,45. Erwähnenswert ist, dass die Meta-Analyse aufgrund des erneut dargestellten Funnel-Plots nun auch repräsentativ war. In der vorgestellten Querschnittsstudie von Das & Mondal (2016) konnten 149 Kinder rekrutiert werden, eine Stichprobe, die man als repräsentativ bezeichnen kann.14 Neun Grundwasserproben, die entnommen wurden, um die Fluoridkonzentration bestimmen zu können, lagen deutlich über dem zulässigen Grenzwert der WHO, der bei <1,5 mg/l (1.500 ppm) liegt. Zudem scheint in der Studie ein Informationsbias vorzuliegen, da einige Probanden falsche Aussagen zum Wasserverbrauch machten. Festzuhalten ist, dass Trivedi et al. (2007), Wang et al. (2007) und Ding et al. (2011) darstellten, dass hohe Fluoridkonzentrationen im Trinkwasser mit niedrigeren IQ-Werten bei Kindern assoziiert werden können.15–17 Fraglich bleibt jedoch, ob der niedrige IQ-Wert hauptsächlich durch die Fluoridexposition verursacht wurde, da soziale Faktoren, die wirtschaftliche Lage, die jeweilige Kultur und die geologische Umgebung auch erhebliche Einflüsse auf die Intelligenz haben.16,17 So ist eine statistische Signifikanz in diesem Bereich zwar ein Indiz auf einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, stellt jedoch nicht alleine genommen einen Nachweis für den alleinigen Einfluss dar.
Die vorgestellte ELEMENT-Studie aus Mexiko scheint auf den ersten Blick sehr repräsentativ, da die Autor*innen eine Stichprobe von 500 Schwangeren rekrutieren konnten. Jedoch ist die Exposition des Fluorids nicht valide, da laut Bashash et al. (2017) keine Wasserqualitätskontrollen durchgeführt wurden.18 Ein ähnliches Problem zeigte sich in der Studie von Till et al. (2018), die ebenfalls keine validen Fluoridexpositionen angaben.19 So konnte festgestellt werden, dass Probandinnen viel höheren Fluoridexpositionen ausgesetzt waren als angegeben und zwei Urinproben aufgrund zu hoher Messwerte entfernt wurden.18,19
In der Studie von Bashash et al. (2018) konnte zwar letztendlich ein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Fluoridexposition und Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätssyndrom ADHS- Symptomen nicht nachgewiesen werden, jedoch konnte eine positive Assoziation zwischen höheren pränatalen Fluoridexpositionen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern gezeigt werden.20 Eine der möglichen Ursachen könnte eine Schädigung der mütterlichen Schilddrüse sein, die fluoridbedingt eine insuffiziente Schilddrüsenhormonausschüttung zur Folge hat.21 Zu den Hormonen der Schilddrüse gehören Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), die unter anderem an der Steuerung von Entwicklung, Wachstum, Zelldifferenzierung und einigen Reaktionen im Stoffwechsel beteiligt sind. Aus dem Prohormon T4 entsteht das biologisch aktive Hormon T3 durch enzymatische Deiodierung. Seine Wirkungen werden über nukleäre T3- Rezeptoren übermittelt, die an der Regulation der Transkription vieler Gene beteiligt sind.22 Für die frühe Embryonalentwicklung ist die mütterliche T3- und T4-Produktion von großer Bedeutung, da die Schilddrüse beim Fötus bis zum dritten Monat noch nicht ausgebildet ist.23
Nach Bachinskii et al. (1985) und Kheradpisheh et al. (2018) können hohe Fluoridkonzentrationen im Trinkwasser, höhere TSH-Werte (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) und niedrigere T3-Werte bei der Mutter verursachen,24,25 die eine wichtige Rolle für die Regulation von Wachstum und Entwicklung des Embryos spielen, da Embryonen bis zum dritten Monat keine Schilddrüse besitzen.26 Allerdings standen Bashash et al. (2018) keine Familienanamnese oder genetische Marker im Zusammenhang mit ADHS zur Verfügung und keines der Kinder wurde klinisch auf die Diagnose ADHS untersucht.20 Des Weiteren konstatierten die Autor*innen, dass in der Studie ein „Ceiling-Effekt“ (Sättigungseffekt) zu beobachten sei. Dies könnte laut Bashash et al. (2018) darauf hindeuten, dass die Höhe der Exposition keinen Einfluss auf den Grad der Verhaltensauffälligkeit hat, die mithilfe des CRS-R (Coma Recovery Scale) ermittelt wurden.20
Die Längsschnittstudie von Till et al. (2020) untersuchte die Auswirkungen der Fluoridbelastung in Säuglingsnahrung auf den IQ von kanadischen Kindern.27 Jedoch konnte bei ausschließlich gestillten Kindern kein signifikanter Unterschied zwischen Fluoridexposition und Intelligenz festgestellt werden, wohingegen die intellektuellen und nonverbalen Fähigkeiten vermindert wurden. Da der Zusammenhang durch zwei Ausreißer in der Statistik nicht mehr signifikant war, sollte dieses Ergebnis unter Vorbehalt wahrgenommen werden. Die Konsistenz der Befunde, der Zusammenhang zwischen Fluoridexposition und Verminderung der Intelligenz war zwar auch in anderen Studien ersichtlich, wie z. B. bei Choi et al. (2012), Bashash et al. (2017), Bashash et al. (2018), Till et al. (2018) und Green et al. (2019).13,18–20,28 Jedoch wurde in allen Studien die empfohlene Tagesmenge an Fluoriden überschritten und die Fluoridexposition erfolgte hauptsächlich systemisch. Obwohl die Gesamtheit der Evidenz zeigt, dass Fluorid toxisch wirken kann, konnte in einer neuerlichen Meta-Analyse von Guth et al. (2020) festgestellt werden, dass das derzeitige Expositionsniveau in europäischen Ländern kein Risiko als Neurotoxikum darstellt und damit nicht mit Entwicklungsstörungen einhergeht.11
| Personengruppen | Alter | mg Fluorid/ Tag Männer | mg Fluorid/ Tag Frauen |
| Säuglinge | 0-4 Monate | 0,25 | 0,25 |
| 4-12 Monate | 0,5 | 0,5 | |
| Kinder | 1-4 Jahre | 0,7 | 0,7 |
| 4-10 Jahre | 1,1 | 1,1 | |
| 10-13 Jahre | 2,0 | 2,0 | |
| 13-15 Jahre | 3,2 | 2,9 | |
| Jugendliche und Erwachsene | 15-19 Jahre | 3,2 | 2,9 |
| ab 19 | 3,8 | 3,1 | |
| Schwangere und Stillende | 3,1 |
Tab. 1.: Empfehlungen zur täglichen Fluoridzufuhr nach der DGE. Tabelle: IfK
Fazit
Die Ergebnisse der Literaturrecherche haben gezeigt, dass die aktuelle Forschung einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Fluoridexposition, die pränatal oder postnatal über einen länger anhaltenden Zeitraum andauert, zu Neurotoxizität und oder Intelligenz- minderung führen kann.13,18–20,28 Jedoch ist der kritische Punkt einer jeden Untersuchung die Realitätsnähe. Aufgrund der derzeitigen wissenschaftlichen Evidenz sollen die Fluoride ausschließlich lokal angewendet werden.29 Die Relevanz der aufgeführten Studien ist dennoch gegeben, da sie aufzeigen konnten, dass in vielen Regionen der Welt, in der künstliche Trinkwasserfluoridierung durchgeführt wird, die Grenzwerte überschritten werden oder gar nicht erfasst sind. Dies stellt ein Problem für die ansässige Bevölkerung dar und kann langfristige toxische Nebenwirkungen haben, wenn zusätzlich Lebensmittel und Dentalprodukte mit Fluoriden konsumiert oder gebraucht werden. Das gilt allerdings nur, wenn zumindest ein Teil des so verwendeten Fluorids auch systemisch aufgenommen wird. Dies ist bei Erwachsenen nicht der Fall. Für zukünftige Forschung oder gesundheitspolitische Entscheidungen in Bezug auf die Dosierung und Erfassung der Fluoridwerte im Grundwasser bieten sie einen umfassenden Einblick. Folglich muss festgestellt werden, dass bei Berücksichtigung der Anwendungsempfehlungen, wie sie in den aktuellen Leitlinien beschrieben sind, keines Falls ein toxikologisches Risiko besteht.30 In dem Zusammenhang sei explizit auf die neueste Fluoridprophylaxeempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGKiZ) hingewiesen,31 die frei im Netz verfügbar ist (Tab. 1).
Hinweis: Im Rahmen dieser Arbeit wird möglichst genderneutral formuliert (z. B. Lesende, Teilnehmende etc.) und das sogenannte Gendersternchen* verwendet, um gleichermaßen Männer und Frauen, aber zusätzlich auch alle anderen Geschlechteridentitäten miteinzuschließen. Hinweis: Im Rahmen dieser Arbeit wird möglichst genderneutral formuliert (z. B. Lesende, Teilnehmende etc.) und das sogenannte Gendersternchen* verwendet, um gleichermaßen Männer und Frauen, aber zusätzlich auch alle anderen Geschlechteridentitäten miteinzuschließen.
Die Zustimmung seitens des Wissenschaftliches Beirats des Prophylaxe Journal wurde für diesen Fachartikel von zwei der drei Mitglieder erteilt.
Autor*in: Nora-Sophie Feulner, Prof. Dr. Georg Gaßmann
Eine Literaturliste steht hier zum Download bereit.
Der Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.
Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren .