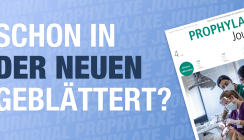Branchenmeldungen 15.09.2022
Erosion des Zahnschmelzes: Vorbeugen und richtig behandeln
share
Empfindliche Zähne sind einer der Hauptgründe, aus denen die Zahnarztpraxis aufgesucht wird. Ursachen sind häufig beschädigter und stark reduzierter Zahnschmelz. Dadurch werden Zähne sensibler für äußere Einflüsse. Man spricht dann von Erosionen im Gebiss. Welche Folgen diese für das Dentin haben und welche Methoden sich am besten zur Remineralisierung des Zahnschmelzes eignen, stellt Priv.-Doz. Dr. Jasmin Flemming, Zahnärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Poliklinik für Zahnerhaltung mit Bereich Kinderzahnheilkunde des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in Dresden, vor.
Frau Priv.-Doz. Dr. Flemming, Softdrinks, Alkohol und säurehaltige Lebensmittel gelten als Hauptursachen für Erosionen beim Zahnschmelz. Warum genau greift Säure den Zahnschmelz so an und welche Folgen hat das für das Dentin?
Zahnschmelz zeichnet sich durch seine hohe Elastizität und Härte aus. Nachteilig ist jedoch seine Säurelöslichkeit bei pH-Werten unter 5,2 bis 5,7. Softdrinks, Alcopops, aber auch unverdünnte Obst- und Gemüsesäfte sowie andere säurehaltige Lebensmittel weisen häufig sehr niedrige pH-Werte auf. Der Wert von Cola-Produkten reicht beispielsweise von 2,5 bis 4,5. Wird nun der Zahn mehrfach über den Tag mit solchen Säuren umspült, kommt es zunächst zu einem oberflächlichen Zahnhartsubstanzverlust. Je häufiger die Säureeinwirkung erfolgt, z. B. bei regelmäßiger, schluckweiser Aufnahme von erosiven Getränken, desto mehr schreitet der Substanzverlust vom Zahnschmelz zum Dentin hin fort. Eine Remineralisation, wie bei initial kariösen Läsionen, ist bei einer Erosion nicht mehr möglich. Es können allenfalls Calcium- und Phosphationen an der Oberfläche präzipitieren. Häufig bemerken die Patienten diese Veränderungen erst, wenn das Dentin durch den immer dünner werdenden Zahnschmelz durchschimmert und es zu einer visuell wahrnehmbaren Farbveränderung der Zähne kommt. Bis dahin wird die Erosion häufig von den Patienten nicht als problematisch eingeschätzt, da sie keine Schmerzen verursacht. Ist der Zahnhartsubstanzverlust allerdings bis in das Dentin fortgeschritten, werden Dentintubuli freigelegt. Nun können alltägliche Reize weitergeleitet werden und es kommt zu Hypersensibilitäten und damit zu einer Einschränkung der Lebensqualität.
Wie beeinflusst Erosion die Bildung bzw. Auswirkungen des Biofilms?
Nach dem Zähneputzen entsteht auf der Zahnoberfläche ein dünner, aber widerstandsfähiger Proteinfilm, die sog. Pellikel. Sie besteht aus bestimmten Proteinen des Speichels, verdickt sich über die Zeit und bindet zunächst unspezifisch Pionierkeime, später rezeptorspezifisch kariespathogene glycolytische Bakterien. Allerdings fehlt eine extrazelluläre mikrobielle Matrix und die dreidimensionale Strukturierung der adhärenten Bakterien, sodass die Pellikel als initialer Proteinfilm klar von der Plaque abgegrenzt wird. Damit stellt diese den Ausgangspunkt der bakteriellen Biofilmbildung dar. Daneben fungiert sie auf der Schmelzoberfläche als natürliche Schutzschicht vor erosiven Demineralisationsprozessen an der Zahnoberfläche. Dieser ist allerdings aufgrund ihrer semipermeablen Eigenschaften limitiert. Die Pellikel fungiert so als Mediator aller mikrobiellen und molekularen Interaktionen an der Phasengrenze zwischen Zahnschmelz und der Mundhöhle und spielt eine ganz zentrale Rolle als erste Stufe der oralen Bioadhäsion und Mediator bei erosivem Zahnhartsubstanzverlust. Die präventive Zahnheilkunde sucht daher nach Strategien, um diese physiologische Schutzwirkung der Pellikel zu verstärken.
Welchen Einfluss haben natürliche Substanzen in diesem Zusammenhang auf die Bildung von Biofilm?
Die steigende Prävalenz von Erosionen und die modernen Ernährungsgewohnheiten erfordern optimierte Präventionsmaßnahmen, die das Zahnhartgewebe vor Demineralisierung schützen. Dazu eignen sich Substanzen, die die Säureresistenz erhöhen. Der Einsatz von natürlichen Substanzen führt zu einer Verbesserung der natürlichen Schutzschicht des Zahnes.
Additive biologische Prophylaxekonzepte gewinnen aufgrund von Allergien und Nebenwirkungen herkömmlicher Produkte zunehmend an Bedeutung. Dabei bieten Arzneipflanzen ein Reservoir für eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen, die unterschiedliche therapeutische Effekte erzielen können. Um das erosionsprotektive Potenzial der Pellikel zu verbessern, kann sie durch ausgewählte externe Agenzien modifiziert und durch deren Anreicherung verstärkt werden. Als solche externen Agenzien können beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe dienen. Zu ihnen gehören Polyphenole, die man beispielsweise in Cistus incanus Tee, wässrigen Tee-Extrakten, wie grünem Tee oder Aufgüssen aus Blättern der schwarzen Johannisbeere, findet. Auch im Granatapfel kann ein hoher Polyphenolgehalt nachgewiesen werden. Daneben können auch extrahierte Pflanzenstoffe aus der Gruppe der Polyphenole direkt angewendet werden. Dazu zählt z. B. die Tanninsäure, die man aus der chinesischen Gallnuss extrahieren kann. Diese sekundären Pflanzenstoffe dienen der Pflanze eigentlich als Wachstumsregulatoren und Schutzstoffe gegen Umwelteinflüsse oder Fraßfeinde. In der Präventivzahnmedizin konnte bereits gezeigt werden, dass sekundäre Pflanzenstoffe Speichelproteine akkumulieren und deren Adsorption an die Zahnschmelzoberfläche erleichtern. Vor allem die Gruppe der pflanzlichen Polyphenole scheint einen Gerbungseffekt auf die Pellikel zu haben, sodass diese proteinreiche Schicht in der transmissionselektronenmikroskopischen Betrachtung dichter und dicker wird. Damit erzielt man eine Verstärkung des erosionsprotektiven Potenzials der Pellikel durch Verdickung und Verdichtung dieser natürlichen Schutzschicht.
Fluoridierung des Zahnschmelzes ist bei Erosion wichtig, um diesen wieder zu festigen. Welche Empfehlungen haben Sie für die Zahnarztpraxis bzw. was kann das Praxisteam dem Patienten für die häusliche Mundhygiene raten?
Zinnfluoridhaltige Zahnpasten und Mundspüllösungen schützen nachgewiesen und effektiv gegen den erosiven Zahnhartsubstanzverlust. Bereits bei initialen Erosionen sollten zinnfluoridhaltige Zahnpasten durch das Praxisteam empfohlen werden, da die Verwendung dieser Präparate zu einer zinndotierten Zahnoberfläche führt. Diese bildet in der Folge eine Art „Schutzbarriere“ vor Säureangriffen. Gerade Patienten, die aufgrund von Reflux oder Bulimie erbrechen bzw. Patienten mit größeren erosiven Defekten können zusätzlich von einer zinnfluoridhaltigen Mundspüllösung profitieren.
Welche zusätzlichen Maßnahmen gibt es, Erosionen vorzubeugen bzw. zu verringern und gibt es natürliche Substanzen, die ebenfalls dazu beitragen, Zahnerosionen zu reduzieren?
Das Zahnärzteteam sollte zunächst eine sorgfältige Anamnese zu den individuellen Ernährungsgewohnheiten der Patienten erheben. Hier bietet sich die Anfertigung eines Tagebuchs über mehrere Tage an. Nicht selten können so versteckte Säurequellen aufgedeckt werden. Daneben sollte die Aufklärung bezüglich Erosionen im Vordergrund stehen. Nicht jedes saure Getränk birgt auch ein erosives Potenzial, da z.B. mittlerweile viele Fruchtsäfte angeboten werden, denen Calcium zugesetzt wurde. Durch die Anreicherung mit Calcium geht von diesen Fruchtsäften kein erosives Potenzial aus. Erosive Getränke sollten generell nicht schlückchenweise und über den Tag verteilt getrunken werden. Außerdem empfehlen wir die Verwendung von nachhaltigen Strohhalmen während des Konsums bzw. das zügige Trinken. Bei Obst- und Gemüsesäften wird nachdrücklich die Verdünnung mit Wasser empfohlen. Daneben können die Patienten mit einer Polyphenol- bzw. Antioxidanzien-reichen Kost das erosionsprotektive Potenzial der Pellikel stärken. Dazu gehören neben dunklen Beeren, wie z. B. Heidelbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren, vor allem Tees und wässrige Extrakte wie grüner oder schwarzer bzw. Cistus incanus Tee. Mehrere Studien konnten zeigen, dass pflanzliche Polyphenole wie Tannine (z. B. Tanninsäure) dazu beitragen können, den erosiven Zahnhartsubstanzverlust zu reduzieren. Ein weiterer natürlicher Bestandteil, der gegen Erosionen wirksam erscheint, ist das Biopolymer Chitosan. Es ist ein Derivat der Schale von Krustentieren und mittlerweile in vielen Zahnprodukten in Kombination mit Zinnfluorid zu finden. Chitosan wirkt antibakteriell und in Kombination mit Zinnfluorid antierosiv.
Wie ist der Einsatz von Mundpflegeprodukten (z. B. Mundspüllösungen) auf biologischer/natürlicher Basis für die Reduktion von Biofilm bzw. Erosion zu bewerten?
Im Handel und in der Werbung werden seit einigen Jahren Produkte mit sog. „künstlichem Zahnschmelz“ beworben (Apatitpartikel). Die Hersteller werben mit dem Versprechen, dass sich künstlicher Zahnschmelz auf der Zahnoberfläche ablagert und so in der Folge ein wirksamer Schutz gegenüber Erosionen entstehen kann. Die nachhaltige Anlagerung an der Zahnoberfläche ist nach aktueller Studienlage jedoch fraglich. Ähnlich wie natürlicher Zahnschmelz ist auch künstlicher wenig säureresistent und bei pH-Werten unter 4,5 säurelöslich, sodass von diesen biomineralischen Produkten kein effektiver Erosionsschutz ausgehen kann. Bisher sind Mundpflegeprodukte auf biologischer/natürlicher Basis nur als Ergänzung zu konventionellen Fluoridpräparaten anzusehen. Polyphenolhaltige Additiva sind zum jetzigen Stand der Forschung ein vielversprechender Ansatz, allerdings werden hier noch klinische Studien mit größeren Kohorten benötigt, um eine valide Empfehlung aussprechen zu können. Der aktuelle Goldstandard in der Prävention von Erosionen ist eine mundgesunde Ernährung und die Verwendung von zinnfluoridhaltigen Mundpflegeprodukten. Polyphenolhaltige Speisen und insbesondere Tees bzw. wässrige Extrakte sind eine wertvolle Ergänzung der mundgesunden Diät.
Frau Priv.-Doz. Dr. Flemming, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dieser Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.