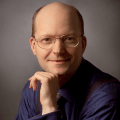Branchenmeldungen 04.03.2025
„In der KFO wird ein effizientes arbeitsteiliges Vorgehen einfacher“
share
Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des VDDI, im Gespräch mit Dr. Christian Ehrensberger
Die Kieferorthopädie kennt viele Konstanten: Apparaturen, Brackets, Retainer – und der Weg zu ihnen wird immer stärker digital gestützt. Mark Stephen Pace, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Deutschen Dental-Industrie (VDDI), blickt voraus auf bewährte und innovative Verfahren und Produkte, mit denen die 41. Internationale Dental-Schau 2025 vom 25. bis 29. März in Köln kieferorthopädische Therapien erfolgssicherer und effektiver macht.
Die digitalen Technologien treiben vieles in der Zahnheilkunde voran. Wie stellt sich vor diesem Hintergrund das Gebiet der Kieferorthopädie dar?
Die Kieferorthopädie befindet sich weiter im Aufwind. Denn der Bedarf ist da, bei Kindern ohnehin, doch auch Erwachsene kommen verstärkt in die Praxen, um von kieferorthopädischen Therapien zu profitieren. Die Grundausrichtung des Fachgebiets hat sich seit Jahrzehnten bewährt, und doch ändert sich viel. Vor allem die Fortentwicklung der digitalen Technologien hat einen spürbaren Einfluss auf die Arbeitsweisen von Praxis und Labor.
In welchen Situationen wird das besonders deutlich?
Der Behandler muss sich von Fall zu Fall entscheiden, wie er den Patientenfall anpacken möchte: klassische analoge Arbeitsweise, volldigital oder gemischt. Das lässt sich gut am Beispiel von Retainern verdeutlichen: Bei der volldigitalen Variante beginnt der Kieferorthopäde mit einem Intraoralscan, spezifiziert beispielsweise „Retainer, OK, von 3 nach 3“ und schickt den entsprechenden STL-Datensatz einem Zentralfertiger oder einem industriellen Dienstleister. Alternativ zum Intraoralscan kann ein Gipsmodell mit einem eigenen Laborscanner oder durch den externen Dienstleister digitalisiert werden. Zwei Tage nach Vorlage der elektronischen Daten erhält die Praxis einen virtuellen Entwurf für den Retainer. Der Kieferorthopäde gibt ihn zur Fertigung frei, gegebenenfalls mit Änderungen. Innerhalb von circa neun Tagen fertigt der Dienstleister den Retainer und sendet ihn an die Praxis.
Wonach soll der Kieferorthopäde entscheiden, welchen Anteil analoge und digitale Teil-Workflows am Gesamt-Workflow haben?
Das wird sich nach der klinischen Ausgangssituation im Einzelfall richten, aber auch nach den persönlichen Präferenzen des Behandlers. Der eine setzt eher auf eine „Blackbox“ mit einem definierten Input- und einem ebenso definierten Output-Kanal; dazwischen liegt ein klar definierter, zuverlässig funktionierender Workflow.
Der andere möchte lieber flexibel bleiben und auch Zwischenschritte kontrollieren. Dabei möchte er sich viele Optionen zum „Ein- und Ausschleusen“ von Daten offenhalten. Auch ein intermediärer Switch von der digitalen auf die manuelle Arbeitsweise ist möglich, indem zum Beispiel das beteiligte zahntechnische Labor ein Sockel- oder Zahnkranzmodell anfertigt oder bei einem industriellen Dienstleister im 3D-Druck herstellen lässt.
Demnach stellt sich für die Praxis stets die Frage: Was genau soll ich selbst übernehmen, was auslagern?
Genau, und das verbindet sich auch mit der Grundhaltung: Wie stark digitalaffin ist der Kieferorthopäde, beziehungsweise wie tief möchte er sich in verschiedene Techniken einarbeiten? Dazu noch ein Beispiel: Die digitale Vorbereitung für das indirekte Kleben von Brackets lässt sich mit einer geeigneten KFO-Software vornehmen; dann platziert der Kieferorthopäde die Brackets virtuell in der eigenen Praxis. Alternativ dazu sourct er diesen Schritt an einen externen Dienstleister aus und kontrolliert das Ergebnis vor der Herstellung der Klebetrays.
Bei der digitalen Planung von festsitzenden Apparaturen kommt der Zahntechniker mit ins Boot. Ein Beispiel dafür stellen Apparaturen für die Gaumennahterweiterung dar, kurz: GNE. Zum Umfang der hier gegebenenfalls nötigen Arbeiten zählen unter anderem der 3D-Druck von Kunststoffen und Metallen sowie das Schweißen und Löten einer GNE-Schraube an ein gedrucktes GNE-Gerüst.
Für eine komplett digitale Finalisierung von herausnehmbaren Apparaturen gibt es für das Anfertigen der Basis und der Drähte elektronische Hilfen. Die einzelnen Teile müssen allerdings am Ende nach wie vor per Hand zusammengefügt werden.
Es fällt auf, dass tendenziell für einen einzigen Fall mehrere Partner zusammengebracht werden müssen – wird das nicht zu komplex?
Eine kieferorthopädische Praxis kann mit digitaler Unterstützung grundsätzlich sehr viele Schritte eines digitalen Workflows in Eigenregie übernehmen. Oftmals wird sich dennoch als effizientere Variante ein arbeitsteiliges Vorgehen unter Beteiligung des zahntechnischen Labors und gegebenenfalls eines Zentralfertigers und/oder eines industriellen Netzwerkservices anbieten. Dank Cloud-Computing wird dies zur 41. IDS 2025 deutlich einfacher, denn hier kann sich jeder Partner genau an der Stelle einklinken, wo er seine Stärken ausspielen und entsprechend seinen Part am Gesamterfolg übernehmen kann. Darum lohnt es sich diesmal besonders, in den Messehallen neben den bewährten Therapieverfahren die innovativen Werkzeuge zu ihrer Umsetzung genau in Augenschein zu nehmen und ihre Eignung für die eigene Praxis, für das eigene Labor und für das zahnärztlich-zahntechnische Team zu eruieren.
Dieser Artikel ist in der KN Kieferorthopädie Nachrichten erschienen.