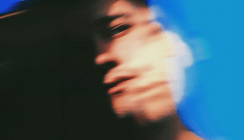Branchenmeldungen 22.09.2025
Chirurgisches Zahnrecycling: Zähne als wertvolle Ressource statt Abfall
share
In Ihrer Antrittsvorlesung an der Charité sprachen Sie über chirurgisches Zahnrecycling. Der Begriff klingt zunächst ungewöhnlich. Was genau versteht man darunter, und welche biologischen sowie klinischen Konzepte stehen dahinter?
Der Begriff mag zunächst tatsächlich etwas ungewöhnlich klingen. Die Idee des chirurgischen Zahnrecyclings beschäftigt mich schon seit mehreren Jahren. Immer wieder bin ich in der klinischen Praxis auf Behandlungskonzepte gestoßen, bei denen Zähne oder Zahnhartsubstanzen nach ihrem Verlust unter bestimmten Bedingungen wiederverwendet werden konnten – etwa bei autogenen Zahntransplantationen oder der Verwendung extrahierter Zähne als partikuläres Knochenersatzmaterial. Aus dem Wunsch heraus, diese verschiedenen Ansätze unter einem gemeinsamen konzeptionellen Dach zu bündeln, habe ich den Begriff „Chirurgisches Zahnrecycling“ geprägt und wie folgt definiert:

Auch wenn wir heute über eine Vielzahl etablierter Implantatsysteme und biomedizinischer Ersatzmaterialien verfügen, bin ich überzeugt: Wo Zähne vorhanden sind und sich eignen, ist ihre Wiederverwendung nicht nur biologischer, sondern auch nachhaltiger.
Zu den chirurgischen Verfahren, die unter dieses Konzept fallen, zählen insbesondere:
- die Verwendung von partikulärem Dentin (z. B. aus extrahierten Weisheitszähnen) als körpereigenes Knochenersatzmaterial, sowie
- die autogene Zahntransplantation, bei der Zähne innerhalb desselben Patienten neu positioniert werden.
Diese Ansätze verbinden biologische Logik mit ressourcenschonendem Handeln – zwei Aspekte, die aus meiner Sicht in der modernen Zahnmedizin weiter an Bedeutung gewinnen werden.
Sie beschreiben das Zahnrecycling als biologisch nachhaltiges Verfahren. Welche biologischen Mechanismen machen extrahierte Zähne zu einem wertvollen Material für regenerative chirurgische Anwendungen?
Eine sehr gute Frage – denn der biologische Aspekt des Zahnrecyclings hängt stark davon ab, welches Verfahren konkret angewendet wird.
Nehmen wir das Beispiel der Verwendung von partikulärem Dentin als Knochenersatzmaterial: Im Vergleich zu tierischen oder synthetischen Materialien ist autologes Dentin deutlich biologischer, da es aus dem eigenen Körper des Patienten stammt. Das bedeutet, es ist immunologisch gut verträglich, das Risiko einer Abstoßungsreaktion ist minimal und es entfällt die Notwendigkeit, Fremdmaterialien zu implantieren.
Auf zellulärer Ebene zeigen Studien, dass Dentin eine ähnliche Zusammensetzung wie Knochen aufweist – insbesondere im Hinblick auf den mineralischen Anteil (Hydroxylapatit) und kollagenes Matrixmaterial. Das macht es zu einem natürlichen Träger für Knochenzellen und Wachstumsfaktoren. Nach der Implantation kommt es in der Regel zunächst zu einer Ankylose des Materials – das heißt, das partikuläre Dentin geht eine direkte Verbindung mit dem umliegenden Knochen ein – gefolgt von einer langsamen Ersatzresorption, bei der das Dentin physiologisch durch neu gebildeten Knochen ersetzt wird. Damit entsteht ein dauerhaft stabiler Knochenaufbau, ganz ohne Fremdmaterialien. Auch bei der autogenen Zahntransplantation spielen biologische Nachhaltigkeit und Immunverträglichkeit eine zentrale Rolle: Ein eigener Zahn wird an eine neue Position transplantiert, ohne Implantat, ohne Fremdkörper. Dadurch entfällt nicht nur das Risiko von periimplantären Entzündungen, sondern auch mögliche Komplikationen im Zusammenhang mit Fremdmaterialien oder Oberflächenbeschichtungen, wie man sie von dentalen Implantaten kennt. Insgesamt ermöglichen beide Verfahren – partikuläres Dentin wie auch die autogene Transplantation – biologisch aktive, körpereigene Lösungen mit hohem regenerativem Potenzial und geringem Komplikationsrisiko. Genau darin liegt die Nachhaltigkeit des chirurgischen Zahnrecyclings: Wir nutzen das, was bereits im Körper vorhanden ist und führen es einer neuen Funktion zu.
Welche praktischen Herausforderungen ergeben sich bei der klinischen Umsetzung von Zahnrecycling, insbesondere im Hinblick auf Reimplantation, autologe Transplantation und die Nutzung von partikulärem Dentin? Gibt es Einschränkungen in Bezug auf bestimmte Indikationen oder Patientengruppen?
Die klinische Umsetzung des Zahnrecyclings bringt einige praktische Herausforderungen mit sich, die je nach Verfahren unterschiedlich ausfallen. Bei der Reimplantation traumatisch avulsierter Zähne ist der Zeitfaktor entscheidend. Die Zähne müssen innerhalb weniger Minuten unter physiologischen Bedingungen reimplantiert werden, da sonst die parodontalen Ligamentzellen absterben und es zu Komplikationen wie Resorption oder Ankylose kommen kann. Hier besteht eine klare Indikationseinschränkung, gleichzeitig aber auch ein vielversprechender Forschungsansatz: Wenn es gelingt, parodontale Zellen an der Wurzeloberfläche wieder zu regenerieren, könnten wir die Indikationen künftig deutlich erweitern. Bei autologen Zahntransplantationen gilt derzeit die offene Wurzelentwicklung als Voraussetzung, um eine Revaskularisation der Pulpa zu ermöglichen und auf eine endodontische Behandlung verzichten zu können. Neue Studien, wie eine kürzlich publizierte Arbeit aus Österreich, zeigen jedoch, dass auch bei vollständig entwickelten Zähnen durch eine extraorale Wurzelspitzenresektion mit vitalerhaltender Endodontie vielversprechende Ergebnisse erzielt werden können, was wiederum neue Möglichkeiten eröffnet.
Die Nutzung von partikulärem Dentin als Knochenersatzmaterial ist biologisch sehr vorteilhaft, setzt aber voraus, dass extrahierte Zähne aus demselben Patienten verfügbar sind. Fehlen geeignete Zähne, entfällt diese Option. Zudem erfordert die Herstellung und Aufbereitung des Materials spezielle Geräte und Protokolle, die nicht überall zur Verfügung stehen. Insgesamt zeigen diese Herausforderungen, dass das Konzept großes Potenzial hat, zugleich aber gezielte Forschung und technische Weiterentwicklung benötigt.
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema in der Medizin. Inwiefern trägt das chirurgische Zahnrecycling zu einem nachhaltigeren Ansatz in der Oralchirurgie bei – sowohl aus biologischer als auch aus ökologischer Sicht?
Nachhaltigkeit spielt in der modernen Medizin und zunehmend auch in der Zahnmedizin eine zentrale Rolle. Das Konzept des chirurgischen Zahnrecyclings trägt in mehrfacher Hinsicht zu einem nachhaltigeren Ansatz in der Oralchirurgie bei.
Biologisch betrachtet nutzt es körpereigenes Gewebe, etwa in Form von autologen Zahntransplantaten oder partikulärem Dentin als Knochenersatzmaterial. Dadurch entfällt der Einsatz körperfremder Materialien, was nicht nur die Biokompatibilität verbessert, sondern auch das Risiko immunologischer Reaktionen oder chronischer Entzündungen reduziert. Ökologisch betrachtet bedeutet die Wiederverwendung extrahierter Zähne Ressourcenschonung, da auf industriell hergestellte Biomaterialien tierischen oder synthetischen Ursprungs verzichtet werden kann. Gleichzeitig werden Transportwege, Verpackungsmaterialien und Herstellungsprozesse eingespart. Insgesamt vereint das chirurgische Zahnrecycling damit biologische Verträglichkeit, therapeutischen Nutzen und ökologische Verantwortung – ein Ansatz, der gut zur Zukunft einer ressourcensensiblen und patientenzentrierten Zahnmedizin passt.
Das Konzept des Zahnrecyclings vereint biologische Effizienz mit nachhaltigem Denken. Welche Entwicklungen und Innovationen erwarten Sie in den kommenden Jahren, um dieses Verfahren weiter zu optimieren und in der Praxis zu etablieren?
Um das Konzept des Zahnrecyclings langfristig zu etablieren und weiterzuentwickeln, müssen wir zunächst ein Umdenken in der zahnmedizinischen Ausbildung anstoßen. Es geht darum, unseren Studierenden zu vermitteln, dass klinisch brauchbare Materialien nicht immer aus der Schublade kommen müssen, sondern dass der eigene Patient oft bereits wertvolles biologisches Material mitbringt. Diese Denkweise sehe ich als persönliches Ziel meiner Tätigkeit als Professor für Oralchirurgie und Oralmedizin an der Charité. In meinen Lehrveranstaltungen vermittle ich die Philosophie des chirurgischen Zahnrecyclings bewusst an die nächste Generation von Zahnärztinnen und Zahnärzten. Ich verstehe mich dabei nicht nur als Chirurg, sondern auch als „Zahn-Recycler“, der biologische, nachhaltige Lösungen aktiv fördert. In den kommenden Jahren erwarte ich insbesondere technische Innovationen, mit denen sich extrahierte Zähne effizienter aufbereiten und standardisiert einsetzen lassen, etwa durch automatisierte Verarbeitungseinheiten für partikuläres Dentin oder neue biologisch aktivierende Verfahren zur Reimplantation. Im Bereich der autologen Zahntransplantation arbeite ich zudem daran, die Technik weiter zu optimieren und das chirurgische Verfahren zu vereinfachen, um es praxistauglicher und für breitere Indikationen zugänglich zu machen.
Ein weiterer Aspekt ist die Patientenperspektive: Immer mehr Menschen legen Wert auf autologe, natürliche Behandlungskonzepte – das Zahnrecycling trifft genau diesen Nerv. Auch wenn es keine industrielle Lobby hinter diesem Ansatz gibt, weil es sich nicht primär vermarkten lässt, ist es umso wichtiger, dieses Potenzial im Sinne einer bewussten, nachhaltigen und patientenzentrierten Zahnmedizin weiter zu fördern.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Herr Prof. Attia!