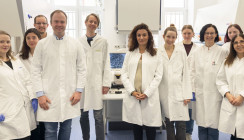Branchenmeldungen 20.06.2025
Neue „Cancer Survivorship“-Professur ins Leben gerufen
share
In Lübeck hatte sie seit 2014 die Langzeitnachsorge für Erwachsene nach Krebs im Kindes- und Jugendalter erfolgreich aufgebaut. Die Leipziger Professur mit diesem Schwerpunkt ist die dritte bundesweit und die erste, die ärztlich und damit mit deutlich klinischer Ausrichtung, besetzt wird. Ein Gespräch über die Schnittstelle zwischen Versorgung und Wissenschaft und eine effektive Langzeitnachsorge für eine bestmögliche Vorsorge.
Frau Prof. Gebauer, worauf zielt Ihre neu geschaffene Professur „Cancer Survivorship“?
Durch bessere Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten überleben mittlerweile immer mehr Menschen ihre Krebserkrankung. Aktuell gibt es etwa fünf Millionen Langzeitüberlebende einer Krebserkrankung in Deutschland und es werden jährlich mehr. Je nach Krebserkrankung und -behandlung besteht allerdings ein Risiko für neue Erkrankungen, die später im Leben auftreten und sich als Folge der Krebserkrankung entwickeln. Betroffene benötigen daher spezialisierte Angebote, die die komplexen Bedürfnisse dieser wachsenden Patientengruppe adressieren sowie leitliniengerechte Vorsorgeprogramme ebenso wie Präventionsangebote, beispielsweise aus dem Bereich Sport und gesunde Ernährung, vereinen. Um diese Angebote optimal zu entwickeln und fortlaufend anzupassen, sind begleitende wissenschaftliche Untersuchungen zentral, deren Erkenntnisse direkt in die Versorgung zurückfließen. Die neu geschaffene Professur soll in diesem Bereich eine Brücke darstellen, die Versorgung und Forschung, aber auch unterschiedliche Disziplinen, die in die Versorgung der Langzeitüberlebenden nach Krebs eingebunden sind, vernetzt, Bewusstsein für das Thema Cancer Survivorship schafft und so letztlich hoffentlich dazu beitragen kann, das ÜberLEBEN und die Lebensqualität der Betroffenen langfristig zu verbessern.
Wie sieht Ihrer Meinung nach eine effektive interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Psychologen und weiteren Fachkräften für eine bestmögliche Langzeitnachsorge aus?
Die inter- und multidisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Cancer Survivorship beginnt früh, in dem im optimalen Fall Langzeitüberlebende aus unterschiedlichen Bereichen, die in die Versorgung von an Krebs erkrankten Menschen eingebunden sind, in einer gemeinsamen Langzeitnachsorge-Sprechstunde zusammengeführt werden. Der Besuch in der Sprechstunde beinhaltet Vorsorgeuntersuchungen, die, je nach Risikoprofil, eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen voraussetzt. Als Beispiel kann hier die Notwendigkeit zu endokrinologischen, kardiologischen, pulmologischen, dermatologischen und gynäkologischen Untersuchungen nach Hodgkin-Lymphom-Behandlung genannt werden, die möglichst alle an einem Tag und durch ein festes Behandlerteam erfolgen. Hinzu kommt eine regelhafte psychosoziale Langzeitnachsorge, die mögliche sozialrechtliche sowie psychologische Aspekte adressiert sowie vulnerable Gruppen für weiterführende Untersuchungen und Behandlungen identifiziert. Sport- und Ernährungstherapeuten im Nachsorge-Team ermöglichen individuelle Beratungen zur gesunden Lebensführung, um das Risiko für spätere Folgeerkrankungen zu reduzieren. Dieses ganze Programm wird im optimalen Fall durch entsprechende Case Manager oder Lotsen geplant und organisiert. Wöchentliche Vor- und Nachbesprechungen im gesamten Team ermöglichen ein Zusammenführen der mitunter unterschiedlichen Eindrücke der beteiligten Disziplinen und hierdurch eine ganzheitliche und verzahnte Versorgung. Mein Ziel ist es, ein entsprechendes Team in den kommenden Monaten am Universitätsklinikum in Leipzig aufzubauen, um den Betroffenen vor Ort ein solches Langzeitnachsorge-Programm verfügbar zu machen. Hierzu ist zu Beginn einiges an Vorarbeit und Organisation zu leisten, um interessierte Partner zu finden und entsprechende Strukturen aufzubauen, aber ich bin, insbesondere nach den ersten Wochen mit vielen positiven Eindrucken vor Ort, sehr zuversichtlich, dass uns dies bald gelingen wird.
Die Folgen neuer Behandlungsmethoden wie der CAR-T-Zelltherapie sind noch wenig erforscht. Wie planen Sie, diese Wissenslücke zu schließen, und welche Schwerpunkte sehen Sie bei der Untersuchung der Langzeitfolgen moderner Krebstherapien?
Viele Spätfolgen manifestieren sich mit langem Abstand zur damaligen onkologischen Therapie, sodass lange Nachbeobachtungszeiträume notwendig sind, bis sich abschließend beantworten lässt, auf welche Spätfolgen beispielsweise nach einer CAR-T-Zelltherapie oder nach Immun- oder zielgerichteten Therapien geachtet werden sollen. Eine fortlaufende wissenschaftliche Begleitung dieser Patientengruppe ist daher essentiell, um Beobachtungen und Erkenntnisse so früh wie möglich sammeln und entsprechend bewerten zu können. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Kenntnisse über mögliche Spätfolgen einer Strahlensowie Chemotherapie gewonnen und auch in entsprechende Vorsorgeempfehlungen übertragen wurden. Eine lediglich geringe Risikoerhöhung für eine mögliche Spätfolge rechtfertigt nicht immer eine Empfehlung für spezialisierte Vorsorgeprogramme, wie wir sie heute beispielsweise für die Brustkrebsvorsorge nach vorangegangener Strahlentherapie bei einem Hodgkin Lymphom haben. In diesem Zusammenhang müssen bei Vorsorgeuntersuchungen insbesondere unter anderem auch das mögliche Risiko einer Untersuchung (bei invasiven Untersuchungen), der Umgang mit Nebenbefunden und die Verfügbarkeit der Untersuchungen berücksichtigt werden. Bis wir daher spezialisierte Langzeitnachsorgeprogramme für Überlebende nach CAR-T-Zelltherapie sowie Immun- bzw. zielgerichteten Therapien haben, wird vermutlich noch etwas Zeit vergehen, in der diese Patientengruppe in prospektiven Studien und Registern ganz besonders und genau untersucht und beobachtet wird, um so früh wie möglich Empfehlungen für die Langzeitnachsorge dieser Betroffenen entwickeln zu können.
Welche spezifischen Methoden oder Indikatoren werden Sie verwenden, um die Effektivität und Nachhaltigkeit der Versorgungsangebote zu bewerten?
Durch den langen Verlauf bis zum Auftreten möglicher Spätfolgen sind jahrzehntelange Programme und Studien notwendig, um die Effektivität von Screening- und Früherkennungsmaßnahmen bewerten zu können. Zudem müssen hierfür viele Betroffene untersucht und in entsprechende Programme eingeschlossen werden, was durch die erst in den letzten Jahren an wenigen Standorten entstandenen Langzeitnachsorge-Sprechstunden bisher eine Herausforderung darstellt. Daher arbeiten wir im Moment insbesondere an der Entwicklung von Registern/bundesweiten Datenbanken, um Spätfolgen sowie durchgeführte Screeningmaßnahmen prospektiv zu erfassen, und begleiten dies durch fragebogenbasierte Evaluationen, in denen die Betroffenen unter anderem ihre Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung bewerten. Gesundheitsökonomische Untersuchungen, die analysieren, inwieweit gezielte Vorsorgeprogramme durch die frühzeitige Diagnose und Behandlung möglicher Spätfolgen zudem kostendeckend im Gesundheitssystem abgebildet werden können, sind ergänzend geplant. Langfristig ist es selbstverständlich unser Ziel, durch die flächendeckende Implementierung von spezialisierten Langzeitnachsorgeangeboten die Morbidität der Langzeitüberlebenden nach Krebs zu reduzieren und ihre langfristige Gesundheit zu stärken. Wir hoffen, dass wir mit den sich derzeit in Deutschland im Aufbau befindlichen Strukturen in der Versorgung und Wissenschaft hierfür eine gute Grundlage schaffen. Es ist auf jeden Fall noch viel zu tun im Bereich Cancer Survivorship und die neu geschaffene Professur bietet hierfür aus meiner Sicht eine ideale Möglichkeit, dieses wichtige Thema in der Klinik, der Forschung und auch in der Lehre zu verankern.