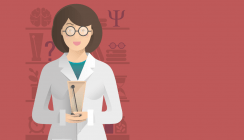Patienten 16.02.2017
Der Nutzen der Gehirnforschung in der Prophylaxesitzung
share
In der Gehirnforschung werden täglich zwischenmenschliche Interaktionen untersucht. Die Erkenntnisse lassen sich jedoch nicht nur auf unseren Alltag anwenden, sondern bringen ebenso ihren Nutzen für die berufliche Kommunikation. Speziell für den Aspekt der Prophylaxebehandlung ergeben sich aus diesem Forschungsbereich einige erfolgreiche Beratungsstrategien, mit denen das Ziel – allen voran die Motivation des Patienten – schneller und gleichzeitig langfristig erfolgreich erreicht werden kann.
Eine bahnbrechende Erkenntnis in der modernen Gehirnforschung ist – und das ist unumstritten: Alle Informationen, die wir wahrnehmen, werden im lymbischen System (Zwischenhirn) mit Emotionen aufgeladen. Es gibt im Großhirn keine Information ohne Emotion (siehe u.a. Ernst Pöppel, Geheimnisvoller Kosmos Gehirn). Oder anders gesagt: Jede Information hat eine Emotion, jeder Gedanke hat eine Emotion. Diese Emotionen gehen entweder in Richtung „gut für mich“ oder in Richtung „schlecht für mich“. Gut für mich bedeutet „hin zu“ – Nähe aufbauen, Freude zeigen. Schlecht für mich heißt „weg von“ – Achtung, Gefahr, Misstrauen, Angst, Zurückhaltung, Skepsis.
Der bereits erwähnte Ernst Pöppel, Gehirnforscher aus München, meint, dass unser ganzes Gehirn für die Suche nach dem Schönen gebaut wurde, für das „Hin zu“-Programm. Das Leid müssten wir nicht suchen, denn es würde sowieso hinter jeder Ecke auf uns warten.
Wenn wir im „Hin zu“-Programm sind, schüttet das Gehirn den Botenstoff Dopamin aus. Dopamin macht wach, aktiviert uns, macht uns ungeduldig und – das ist das Bemerkenswerteste – es lenkt die Aufmerksamkeit auf alles, was uns nützlich erscheint und den nächsten Moment oder unser ganzes Leben verschönern könnte. Dopamin ist der Botenstoff, der uns nach Lösungen suchen lässt, wenn wir Probleme sehen. Dopamin sorgt für gute Laune und wird auch als Glücksbotenstoff bezeichnet (siehe Stefan Klein, Die Glücksformel).
Wie können wir die Produktion von Dopamin anheizen? Neben vielen kleinen gibt es zwei große und einfache Möglichkeiten: Neugierde wecken und Vorfreude erzeugen. Kleiner Tipp am Rande: Wenn Sie sich jeden Morgen auf etwas am Tag freuen, gehen Sie mit guter Laune in den Tag, Sie sind anziehender und denken lösungsorientiert. Kurzum: Sie meckern kaum noch und erzeugen somit weniger schlechte Gefühle bei anderen Menschen. Die Folge ist, dass mehr Menschen Ihre Nähe suchen und Sie weniger Menschen meiden. Chefs sollten deshalb nur gut gelaunt in die Praxis kommen, alle anderen Mitarbeiter der Praxis natürlich ebenso.
Die zweite große Erkenntnis der Gehirnforschung ist: Wir haben ein Bildergehirn (siehe Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder). Wir denken in Bildern, unsere Millionen unbewusst emotional aufgeladenen Signale erzeugen ständig innere Bilder. Folglich wäre es von Vorteil, wenn Sie Ihre Kommunikation mit sprachlichen Bildern oder Fotos anreichern. Es gibt Rhetoriktrainings, in welchen das bildhafte Sprechen trainiert werden kann. Als andere Möglichkeit sollten in der Praxis von jedem Patienten Mundaufnahmen im Überblick und mit der Intraoralkamera gemacht werden – und zwar bei der Erstbefundung und im Behandlungsverlauf.
Die dritte große Erkenntnis ist: Wir haben im Gehirn eine sogenannte Verhaltensblockade, die einen Gedanken daran hindern soll, sogleich in die Tat umgesetzt zu werden. Menschen mit einer schwachen Verhaltensblockade sind häufig stark überschuldet. Wir durchdringen diese Blockade dann, wenn wir beide Emotionsrichtungen aktivieren. Wir müssen erfassen, was wir vermeiden wollen, welche Katastrophe verhindert werden soll UND welche guten Gefühle und welches Schöne wir mit unserer Entscheidung und unserem Verhalten erwarten dürfen. Beides gehört zusammen, unser Gehirn aktiviert unser Handlungsprogramm immer im „Weg von“ und im „Hin zu“. Nach neuester Gehirnforschung ist es nicht ganz korrekt, nur den Vorteil, den Nutzen oder das glorreiche Ziel darzustellen, sondern es ist besser, auch die Katastrophe, das Leid, die schlechten Gefühle, die wir meiden wollen, anzusprechen. Wir entscheiden unser Verhalten zumindest unbewusst immer, wirklich immer, im „Weg von“ UND „Hin zu“.
Die erfolgreichste Beratungsstrategie sieht nun folgendermaßen aus. Der erste Schritt besteht in der Befundung des Istzustandes. Wenn die Mundpflege des Patienten optimal ist und die Zähne, das Zahnfleisch, die Zunge, der Mundraum gesund sind, so wäre die Frage: Was tun, damit es so bleibt? Die Antwort könnte lauten: Regelmäßig zur Prophylaxe kommen. Wenn aber beim Patienten Plaque, Zahnstein oder gar Blutungen und gerötetes Zahnfleisch festzustellen sind, sollten Sie so vorgehen:
Erster Schritt: der Befund
Sie zeigen dem Patienten das Röntgenbild und fragen ihn, ob er wissen möchte, was die hellen und dunkleren Flecken auf dem Bild bedeuten und ob er wissen will, was genau Ihre Untersuchung mit der Sonde und die sonstigen Untersuchungen wie Plaquebefund und Sichtbefund ergeben haben. Mit „möchten Sie wissen“ wird die Neugierde geweckt und die Dopaminproduktion im Gehirn angekurbelt. Das gilt übrigens für das ganze Leben. Wenn der Patient sich jetzt vorbeugt und Sie fragend anschaut, zeigt er, dass er neugierig ist. Er ist jetzt aufmerksamer und – das wird sie überraschen – merkt sich Ihre Worte wesentlich besser. Dann stellen Sie mit wenigen Worten die Lage dar. Zeigen Sie ihm die Großaufnahmen und verweisen auf Plaque und andere Details, aber alles nur kurz und bündig.
Zweiter Schritt: die Risikoanalyse
Fragen Sie den Patienten (nach einer kleinen Atempause und einem problematisch wirkenden Gesichtsausdruck), was mit seinen Zähnen passiert, wenn keine Behandlung erfolgt. Der Patient muss in die Situation (ausgelöst durch Ihre Frage) gebracht werden, sich mit dieser Katastrophenfrage auseinanderzusetzen. Erläutern Sie ihm daraufhin die Risiken, beispielsweise: „Die Parodontitiskeime belasten Ihr Immunsystem immer stärker, sie gefährden Ihr Herz-Kreislauf-System, sie sorgen bei Frauen auch für Fehlgeburten, bei Männern manchmal für Impotenz.“ Sie zeigen auf den Patientenmund, der vielleicht schon vor Entsetzen offen steht, bei Männern meistens mehr als bei Frauen. „In Ihrem Mund breiten sich die Keime weiter aus, sie verursachen weitere Karies, schwere Schäden am Zahnfleisch und letztlich den Verlust von Zähnen. Außerdem kann Mundgeruch hervorgerufen oder zusätzlich unterstützt werden.“
Dritter Schritt: die Rettung, die Behandlung
„Damit wir die Katastrophe verhindern und Sie wieder einen gesunden Mund mit einem frischen Atem haben, möchte ich mit Ihnen folgendermaßen vorgehen.“ Ihr Behandlungsvorschlag sollte danach kurz, klar und eindeutig formuliert werden. Zeigen Sie dem Patienten Vorher-Nachher-Bilder von anderen Patienten, auf denen natürlich nur deren Mund zu sehen ist. Zunächst das Erstbefund-Bild: „Auf diesem Bild sehen Sie einen Mund – vergleichbar mit ihrem Zustand.“ Dann das Nachher-Bild: „So sieht der Mund des Patienten nach einem Jahr aus und so (das dritte Bild) nach zwei Jahren. Der Patient kommt seit drei Jahren alle vier Monate zu mir – das ist das Erfolgsrezept.“
Das Gespräch darf insgesamt nicht länger als sechs Minuten dauern. Sie werden sich wundern, wie schnell Ihre Informationen in dieser kompakten Form gegeben werden können. Sie dürfen auf keinen Fall abschweifen oder etwas näher erläutern. Auch dürfen keine Zwischenfragen des Patienten zugelassen werden, was Sie mit klaren Gesten verhindern können. Wichtig ist, dass Sie dieses Gespräch kurz halten, da sich das Gehirn nur maximal sieben Minuten auf ein Thema konzentrieren kann. Nach meistens schon sechs Minuten bleibt unser Gehirn oft am Gesagten hängen, verarbeitet es oder es denkt an etwas ganz anderes und gönnt sich eine Pause.
In meinen Vorträgen demonstriere ich dieses Gespräch und empfehle immer, dass die Teilnehmer sich an dieses Drehbuch halten. Es lohnt sich, denn der Patient stellt anschließend kaum noch Fragen, da alle Teile seines Gehirns bedient wurden – das kritische Katastrophenmodul, das Lösungsmodul und das Handlungsmodul.
Wie können wir nun Vorfreude, den zweiten Dopamin-Pusher, erzeugen? Sie könnten Ihre Terminerinnerung folgendermaßen formulieren: „Sehr geehrte Frau Meier, ich möchte Sie an Ihren nächsten Prophylaxetermin in unserer Praxis/Klinik am kommenden Donnerstag um 14 Uhr erinnern, damit Sie sich heute schon auf uns freuen können. Denn Sie wissen: Prophylaxe macht gesünder und attraktiver.“
Bei der Begrüßung dürfen Sie auch Ihre Patienten fragen, ob sie sich auf den Prophylaxetermin gefreut haben. Wenn nicht, so nehmen Sie dies zum Anlass, Ihre Patienten an den Termin zwei Tage vorher per SMS, Mail oder Sprachnachricht zu erinnern.
Anzeige