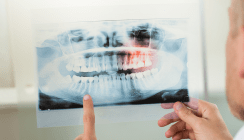Implantologie 15.08.2016
Die laterale Augmentation horizontaler Knochendefekte
share
Teil 1: Vom Knochenerhalt bis zum Knochendefekt
Die Augmentation horizontaler Knochendefekte, sowohl bei einer Spät- als auch bei einer Sofortimplantation, ist eine lang etablierte Methode zur Optimierung des Implantatbettes. In diesem Fachartikel wird eine Fallserie von unterschiedlichen lateralen Augmentationen beschrieben. Die Fälle werden in drei Kategorien unterteilt, wobei Kategorie 1 und 2 in diesem Beitrag näher beschrieben werden. Kategorie 3 wird in der kommenden Ausgabe ausführlich erläutert.
Bei einer Augmentation horizontaler Knochendefekte wird eine ausreichende Knochenbreite angestrebt, damit das Implantat langfristig stabil inseriert und versorgt werden kann. Obwohl das Hartgewebe die primäre Sorge des Operateurs darstellt, bleibt das Weichgewebe die größere Herausforderung. Einerseits muss das neue Volumen gegen das schneller wachsende Weichgewebe abgeschirmt und plastisch gedeckt werden, andererseits braucht der Prothetiker qualitativ gutes Weichgewebe für die periimplantäre Gesundheit und die Ästhetik.
In diesem Artikel werden drei Kategorien der lateralen Augmentation (GBR), außer Sofortimplantationen und vertikale Augmentation, unterschieden. In die erste Kategorie gehören alle Implantate, die in ausreichend breiten Knochen inseriert werden können, d. h. Implantate, die vollständig im Knochen sind, aber vestibulär augmentiert werden müssen, damit eine Knochenbreite von 2 mm gewährleistet werden kann.
In die zweite Kategorie gehören Implantate, die nicht vollständig in den Knochen eingedreht werden können. Mindestens 50 Prozent deren Oberfläche ist im Knochen verankert oder ein Defekt der bukkalen Lamelle vorhanden.
In die dritte Kategorie gehören Implantate, die zweizeitig inseriert werden: Nach der primären GBR erfolgt die Insertion in einem nachfolgenden Schritt.
Fälle, bei denen eine vertikale GBR krestal oder apikal (Sinuslift) durchgeführt werden muss, werden in dieser Fallserie nicht behandelt. Der erste Teil des Artikels hat die ersten zwei Kategorien zum Inhalt. Im zweiten Teil (Implantologie Journal 7&8/16) folgt die Beschreibung der dritten Kategorie.
Materialien und Methoden
Das Operationsprotokoll ist in allen Fällen gleich, beziehungsweise fängt gleich an. Als erstes wird immer bestimmt, welches Flapdesign angewandt wird. Dabei ist es immer möglich, je nach Situs, dieses Design zu erweitern, um intraoperative Befunde und Komplikationen versorgen zu können.
Der krestale Schnitt wird in der Mitte des Kieferkamms gesetzt, um die Durchblutung von oral und vestibulär nicht zu unterbrechen. Bei reduzierter keratinisierter Gingiva erfolgt dieser Schnitt nicht am Übergang zu der Mukosa, um Risiken bei der Durchführung des Verschlusses zu vermeiden. Nach dem krestalen Schnitt erfolgen die Entlastungsschnitte bis zur mukogingivalen Grenze. Im ästhetischen Bereich wird zunächst nur mesial entlastet, damit die Versorgung von posterior nicht unnötig unterbrochen wird und Papillen geschont werden. An der mukogingivalen Grenze erfolgt die Trennung der Mukosa vom Periost. Das Periost bleibt am Knochen. Je nachdem, welches Volumen aufgebaut werden muss, können die Entlastungsschnitte in die Mukosa verlängert werden. Anschließend wird, bei Bedarf, das Periost gehoben und eine Tasche gebildet, welche das Augmentat aufnehmen kann. Bei größeren Augmentationen verbleibt das Periost am Lappen und wird erst nach Vollendung des Lappens von der Mukosa getrennt, damit die notwendige Elastizität zum Verschließen erreicht werden kann.
Alle Implantate der Kategorie 1 wurden mit Hydroxylapatit augmentiert, bis eine Knochenbreite von 2 mm vestibulär gewährleistet werden konnte. Die Implantate der Kategorie 2 wurden mit einer Mischung von Xenograft (HA) und Allograft augmentiert (Verhältnis: 20 zu 80 Prozent). Freiliegende Implantatareale wurden zuerst mit autonomem Knochen bedeckt. In der dritten Kategorie erfolgte die Augmentation mit einer Mischung von Xenograft und Allograft (Verhältnis: 40 zu 60 Prozent), welche in Schichten angebracht wurden. In allen Fällen wurde das Augmentat mit einer lang resorbierbaren Membran (18 bis 24 Monate) abgedeckt.
Der Lappenverschluss erfolgte mit 5-0 pseudomonofilem und monofilem Nahtmaterial oder 4-0 ePTFE-Nahtmaterial, während die Papillen mit 6-0 Monofilamenten adaptiert wurden. Nähte mit Spannung (vor allem der Kategorie 3) wurden nach zwei Wochen entfernt. Nähte ohne Spannung (Papillae, Entlastungsschnitte) wurden nach einer Woche entfernt. Die Art der Knoten variierte abhängig davon, welche Lappen durchgeführt wurden, wo ihre Lokalisation war und wie die Freilegung erfolgen sollte. Im Einzelnen werden wir in den folgenden Fällen alle angewandten Nahttechniken sehen können.
Kategorie 1: Augmentation lateral zur Optimierung der Knochenbreite notwendig
Die Frage nach der Notwendigkeit eines Knochenaufbaus stellt sich vor allem in diesen Situationen. Der laterale Defekt ist eindeutig, intraoperativ zeigt sich allerdings eine Situation, die mit einem durchmesserreduzierten Implantat eventuell lösbar wäre. Das Implantat muss einerseits den fehlenden Zahn ersetzen und die entsprechenden Kau- und Funktionskräfte tragen, auf der anderen Seite einen Durchmesser und eine Abutmentmorphologie aufweisen, welche das richtige Emergenzprofil realisieren lassen. In diesem Fall (Abb. 1) wäre ein Implantat kleiner als 3,8 mm unvorteilhaft – wegen des Emergenzprofils. Das inserierte Implantat, mit 3,8 mm, war vollständig von Knochen ummantelt. Dennoch war ein Knochenaufbau notwendig, damit mindestens 2 mm Hartgewebe vestibulär gewährleistet werden können. Zum einen ist dieses Knochenvolumen notwendig, um das Weichgewebe zu stützen, zum anderen essenziell für langfristige Stabilität der Gewebe.
Noch bevor die Implantation anfängt, liegt das primäre Augenmerk an dem tief einstrahlenden Wannenbändchen. Potenziell üben solche Bänder Zug am Lappen aus und müssen entlastet werden. In diesem Fall wurde das Durchschneiden des Bandes präferiert (Abb. 2) und die Fixierung mit Einzelknopfnähten durchgeführt. Anschließend erfolgte die Lappenbildung (Abb. 3). Nach dem krestalen Schnitt wurden die Papillen durch einen Papilla base-Schnitt belassen. Dieser erfolgte mit 45-Grad-Schnitten, um Narbenbildung durch vertikale Schnitte in die keratinisierte Gingiva zu vermeiden. Die Entlastungsschnitte erfolgen bis zur mukogingivalen Grenze und bei Bedarf dieser Grenze entlang – in diesem Fall nur mesial, um die Versorgung von distal nicht zu unterbrechen. Bei weiterem Bedarf wird vertikal in die Mukosa entlastet, um Narbenbildung durch horizontale Schnitte in der Region zu vermeiden.
Bei der Implantatinsertion (Abb. 4) sieht man eine unzureichende Knochenbreite lateral von circa 0,5 mm. Diese wurde mit HA verbessert und mit einer Kollagenmembran isoliert. Der Lappenverschluss erfolgte leicht, durch Adaptation der eckigen Schnitte, mit 5-0 Monofilamenten und 6-0 für die Papillae. Einzelknopfnähte waren ausreichend für den Verschluss (Abb. 5).
Die Situation eine Woche postoperativ und vor der Freilegung zeigte optimale Weichgewebsqualität und eine narbenlose Ausheilung (Abb. 6). Mittels Former erfolgte die Ausformung des Emergenzprofils (Abb. 7–9). Die richtige Gestaltung des Approximalkontaktes garantiert optimale Ästhetik (Abb. 10). Alle chirurgischen und prothetischen Schritte sind wichtig für eine langfristige Gewebestabilität.
Kategorie 2: Horizontaler Defekt – bukkale Lammelle fehlt teilweise
In diesem Fall lag eine Freiendsituation im 3. Quadranten vor (Abb. 11a und b). Neben der Sofortimplantation 35 mit teilweise fehlenden bukkalen Lammellen waren die Implantate 36 und 37 nur lingual im Kontakt mit dem krestalen Knochen und circa 20 bis 30 Prozent deren Oberfläche außerhalb des Kieferknochens. Das Implantat 36 war circa 1 mm suprakrestal gesetzt. Die fehlende Knochenbreite betrug bei Zahn 35 6 mm lateral, bei Zahn 36 7 mm lateral und bei 37 7,5 mm lateral (Abb. 12).
Die Lappenbildung erfolgte wie bei der Kategorie 1. Durch das höhere Augmentationsvolumen wurde der Lappen nach mesial und distal, entlang der mukogingivalen Grenze, und anschließend vertikal in die Mukosa verlängert (Abb. 13). Die dadurch erhaltene Elastizität war ausreichend, um die Augmentationsstelle spannungsfrei verschließen zu können. Zuerst wurden Fixationsnähte platziert und der Rest des Lappens wurde mit horizontalen Matratzennähten verschlossen. Die
Entlastungsschnitte in der Mukosa wurden mit Double loop single knot-Nähten vernäht.
Bei der Freilegung waren alle Implantate vom Knochen bedeckt, sodass dieser zuerst entfernt werden musste (Abb. 14), um an die Deckschrauben zu gelangen (Abb. 15a und b). Lateral wiesen alle Implantate 2–3 mm Knochen auf. Der maximale Knochengewinn lateral betrug 8 mm. Zwischen den Implantaten war der Knochen erhaben und bat eine optimale Unterstützung für die Papillae. Ein apikaler Positionierungslappen verschaffte circa 4 mm keratinisierte Gingiva vestibulär. Mittels Former erfolgte die Ausformung des Emergenzprofils (Abb. 16).
Diskussion
Dieses Protokoll bietet die Möglichkeit, den Lappen jederzeit zu erweitern. Intraoperative Komplikationen können integriert werden, da alle Schritte gleich anfangen und in der gleichen Reihenfolge erfolgen. Zugleich bietet die Schnittführung minimales Narbenrisiko und erleichtert die Adaptation der Lappenränder. Generell sollte es vermieden werden, in die keratinisierte Gingiva vertikal und in die Mukosa horizontal zu schneiden. Der Kompromiss von 45 Grad bietet eine gute Alternative.
Die Hebung der Papillen muss sehr sorgfältig entschieden werden. Wiederholte Hebung führt zu Rezessionen. Basisschnitte um die Papillen müssen knöchern unterstützt sein. Andererseits ist das Vernähen schwierig, Spannungen kommen zustande und das Rezessionsrisiko steigt.
Der Fall in Kategorie 2 zeigt bestimmte anatomische Gegebenheiten, die für das Verfahren vorteilhaft sind. So ist ein breiter Kiefer günstig für die Augmentation mit Knochenchips, da die Stabilität des Transplantats dadurch erhöht wird. Es ist ratsam, mit Membranen zu arbeiten oder Schrauben zu befestigen, um zusätzliche Stabilität zu erhalten. Gleichzeitig helfen diese Befestigungen vor allem im Unterkiefer gegen die Schwerkraft.
Auch die Verwendung von nicht resorbierbaren Membranen wie PTFE oder Titannetze sind verlässliche Optionen zur Behandlung von massiven Defekten, vor allem wenn Muskeln oder Bänder die Stabilität des Augmentats gefährden.
Die Unterstützung des Weichgewebes mit Knochen hilft bei der Ausformung der Papillen. So ist es möglich, auch im Seitenzahnbereich Pseudopapillae aus keratinisierter Gingiva zu formen und dadurch den krestalen Knochen zu erhalten. Gleichzeitig kann die Gestaltung der Suprakonstruktion optimal durchgeführt werden – ohne die Notwendigkeit von rosafarbener Keramik, verschlossenen Zwischenräumen oder Putzkanälen.
Besonderes Augenmerk muss auf die Techniken zur Steigerung der Weichgewebsqualität gelegt werden. Je nachdem welche Technik zur Deckung der Augmentation angewandt wird, z. B. Höhe der Periostschlitzung, können Lappen wie freie Schleimhauttransplantate, apikale Verschiebelappen, apikale Repositionslappen nicht appliziert werden. Bedenkt man, dass ein freies Transplantat aus dem Gaumen am Periost vernäht werden muss, so muss bei der Durchführung dieses Schrittes an der entsprechenden Fixationsstelle auch Periost vorhanden sein. Bei der Augmentation muss eine tiefe Periostschlitzung erfolgen.
Zuletzt ist wichtig zu betonen, dass genaue Planung und Verständnis der Biologie unerlässlich sind. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist elementar für den Erfolg. Jeder weitere Schritt im Rahmen einer Behandlung kann die vorangegangenen Schritte nichtig machen. Die erste Entscheidung besteht immer darin, zu erkennen, welche prophetische Lösung realisierbar ist. Anschließend haben Chirurgie (Implantation, GBR, GTR), Prothetik sowie Zahntechnik die gleiche Gewichtung und verlangen nach Kommunikation. Alle Schritte beeinflussen die vorangegangenen.