Parodontologie 24.02.2016
Dialysepatienten in der Zahnarztpraxis: Herausforderung für Zahnarzt und Prophylaxeteam
share
Dialysepatienten sind in der zahnärztlichen Praxis als Risikopatienten
einzustufen. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand sowie die begleitende
medikamentöse und/oder Dialysetherapie macht eine Anpassung der
Behandlung sowie Sicherstellung zielgerichteter Präventionsmaßnahmen
notwendig. Dabei zeigen sich insbesondere in dieser Patientenklientel
deutliche Defizite im zahnärztlichen und Mundhygieneverhalten. Dies
stellt zum einen eine grundlegend verbesserungsfähige Situation und
Verpflichtung für Patienten und das gesamte zahnärztliche Team dar. Zum
anderen ist es als Chance anzusehen, neben der Schaffung gesunder
oraler Verhältnisse den Patienten in einer lebenslangen individuellen
risikoorientierten Prävention zu begleiten.
Für
Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion ist eine
Nierenersatztherapie häufig eine unumgängliche, lebenserhaltende
Maßnahme. Aufgrund des häufig beeinträchtigten allgemeinen
Gesundheitszustandes unter Berücksichtigung einer möglichen multiplen
Medikamenteneinnahme ist dieser Patientenklientel als Risikopatient in
der zahnärztlichen Praxis einzustufen. Des Weiteren bleibt die Tatsache
zu berücksichtigen, dass diese Patienten häufig Kandidaten für eine
Transplantation darstellen. Aus diesem Grund ergibt sich ein besonderer
Stellenwert in einer regelmäßigen Diagnostik, einer abgleitenden
bedarfsorientierten Therapie und vor allem einer risikoorientierten
Prävention oraler Erkrankungen. Eine umfassende Übersicht zu
allgemeinmedizinischen Besonderheiten niereninsuffizienter
(dialysepflichtiger) Patienten und deren zahnärztliche Relevanz
lieferten bereits Klenke et al. (2013).1 Zudem zeigen Ergebnisse
verschiedener klinischer Studien die Komplexität verschiedener Faktoren,
wie z.B. oraler Erkrankungen, aber auch Besonderheiten im
Mundgesundheitsverhalten und deren Zusammenhang mit Patienten unter
Dialyse (Tab. 1).2–4
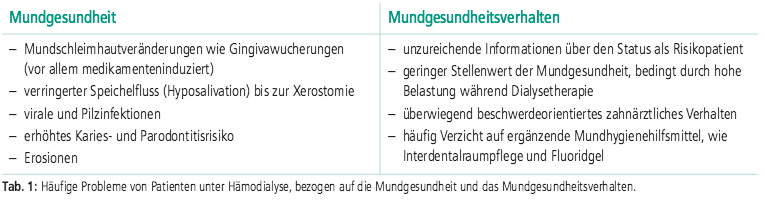
Der vorliegende Beitrag soll für den Zahnarzt und das Prophylaxe-Team wesentliche Informationen über allgemeine und mundgesundheitsbezogene Faktoren sowie einen Überblick über vorliegende Studienergebnisse zur Mundgesundheit- (-sverhalten) und zahnärztlichem Verhalten von Patienten unter Hämodialyse liefern und abschließend einige Empfehlungen für die zahnärztliche Arbeit mit diesem Klientel geben.
Ursachen und Formen der Nierenersatztherapie
Die
physiologische Funktion der Nieren besteht in der Eliminierung von
Giftstoffen und deren Ausscheidung über den Urin. Daneben spielen auch
blutdruckregulierende und hormonelle Funktionen eine Rolle. Jede Niere
besteht aus etwa einer Million Untereinheiten, den Nephronen. Die
irreversible Schädigung funktionstüchtiger Nephronen führt zur
Verringerung der sogenannten funktionellen Kapazität der Nieren mit
Reduktion der glomerulären Filtrationsrate (GFR).5 Ursächlich hierfür
können verschiedene Erkrankungen sein, von denen Diabetes mellitus,
Glomerulonephritis, arterielle Hypertonie und polyzystische
Nierenerkrankungen die bedeutendsten darstellen.6 Sinkt die funktionelle
Kapazität (GFR) der Nieren unter 5–10 % des Normalwertes, wird eine
Nierenersatztherapie als lebenserhaltende Maßnahme notwendig.2,3 Hierbei
kann zwischen Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation
unterteilt werden. Davon findet die Hämodialyse (HD) am häufigsten
Anwendung und das Langzeitüberleben von Patienten mit chronischem
Nierenversagen wird erheblich erhöht.7
Besonderheiten von Patienten unter Hämodialyse
Allgemeinmedizinisch
Im
Vergleich zu allgemeingesunden Patienten weisen Patienten unter
Hämodialyse verschiedene Besonderheiten auf. Aufgrund einer oder
mehrerer Grunderkrankungen und der daraus resultierenden
Niereninsuffizienz sowie der entsprechenden Therapie mit einer Vielzahl
von Medikamenten ist ein großer Teil dieser Patienten multimorbide. Eine
entscheidende Ursache und dementsprechend häufig vorliegende
Komorbidität ist der Diabetes mellitus. Aufgrund der Relevanz der Nieren
in der Regulierung des Blutdruckes ist ebenso gehäuft mit einem
erhöhten Blutdruck (Hypertonie) der HD-Patienten zu rechnen. Weiterhin
ist die Hemmung der Blutgerinnung mittels Heparin (Heparinisierung) zu
bedenken, da es bei Nichtbeachtung zu Blutungskomplikationen kommen
kann. Besonders wichtige anamnestische Punkte in Ergänzung zur
standardmäßigen Anamneseerhebung liefert die dargestellte Checkliste.
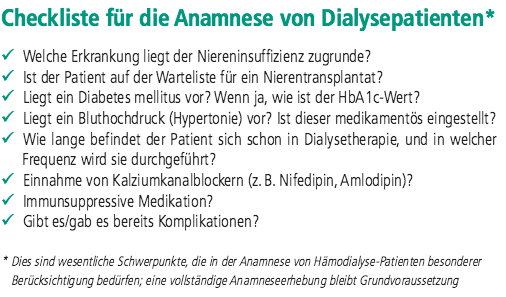
Zahnmedizinisch
Generell
scheint diese Patientengruppe eine gewisse Immunkompromittierung zu
besitzen, durch welche sich eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen
ergibt.2 Das Ergebnis sind systemische (wie z. B. systemische
Infektionen), aber auch orale Erkrankungen, wie Karies, Gingivitis und
Parodontitis.8 So zeigen verfügbare Untersuchungen zur Mundgesundheit
von HD-Patienten eine erhöhte Parodontitis- und Kariesprävalenz
auf.2,9,10 Es ist zudem auffällig, dass sich mit zunehmender
Dialysedauer auch eine zunehmende Verschlechterung des
Mundgesundheitszustandes einstellt.9,11 Hierbei kann ebenso ein
Zusammenhang zwischen Hämodialyse und parodontaler Entzündung
festgestellt werden.2,4,11 In eben diesem Kontext ist auch eine durch
Urämie (erhöhte Konzentration harnpflichtiger Substanzen im Blut)
bedingte Änderung des subgingivalen Biofilmes bei Patienten unter
Hämodialyse vorstellbar, was durch eine Verschiebung der parodontal
pathogenen Bakterienflora mit häufigem Auftreten von Vertretern des
roten Komplexes (z.B. Porphyromonas gingivalis) gekennzeichnet ist.12,13
Gesteigerte Bildung von Zahnstein, virale und Pilzinfektionen sowie
Erosionen sind weitere Veränderungen, die bei diesen Patienten verstärkt
beobachtet werden können.3,14,15 Nicht zuletzt existiert häufig eine
Veränderung in der Speichelmenge und Zusammensetzung, die oftmals in
Hyposalivation oder sogar Xerostomie resultiert.3,14,16,17 Zudem
begünstigt der verringerte Speichelfluss Infektionen, vor allem durch
Pilze wie Candida albicans. Im Weiteren wirken sich unter Umständen
verschiedene Medikamente auf die Mundhöhle aus. So ist besonders die
Auslösung von medikamenteninduzierten Gingivawucherungen anzuführen, die
z. B. durch antihypertensive Therapie mit Kalziumkanalblockern, wie
Amlodipin oder Nifedipin, begünstigt werden. Dies zieht wiederum
verstärkt Erkrankungen der Zähne, aber auch der oralen Mukosa nach sich.
Bei
HD-Patienten handelt es sich demnach um eine Patientengruppe, die zum
einen ein erhöhtes Risiko für die Entstehung oraler Erkrankungen
vorzuweisen hat, aber auch ein erhöhtes Risiko für daraus resultierende
systemische Komplikationen besitzt.
Mundgesundheitsverhalten von HD-Patienten
Die
HD-Therapie stellt für betroffene Patienten eine erhebliche Belastung
dar, da sie mit 2–3-mal wöchentlich mehrere Stunden sehr zeitaufwendig
ist und die Patienten maßgeblich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt
werden. Dies führt im Nachgang oftmals dazu, dass die Mundgesundheit für
die Patienten keine hohe Priorität einnimmt.18,19 Entsprechend zeigt
sich bezüglich des Mundhygieneverhaltens dieser Patienten vor allem eine
geringe Nutzung von ergänzenden Mundhygienemaßnahmen, wie
Zahnzwischenraumbürsten oder Flouridgel.20–22 Zudem ist auffällig, dass
die Mehrzahl der Patienten den Zahnarzt nicht vorsorgeorientiert,
sondern nur im Fall von Beschwerden aufsucht.22 Hieraus ergeben sich
verschiedene Herausforderungen in der Information, Instruktion und
Motivation dieser Patienten für den Zahnarzt und das Prophylaxeteam. Das beschwerde-orientierte Verhalten ist hierbei für alle Seiten
unbefriedigend. Vielmehr sollte es das Ziel sein, den Patienten mehr zur
Eigenverantwortung eines kontroll- und präventionsorientierten
Verhaltens zu sensibilisieren und zu motivieren. Entsprechend ist für
diese Aufgabe das gesamte Praxisteam gefordert.
Besonderheiten bei zahnärztlichen Behandlungen
Der
HD-Patient ist als Risikopatient in der zahnärztlichen Praxis
einzustufen. Hierbei ist in erster Linie die erhöhte Blutungsneigung
durch die Heparinisierung im Rahmen des Dialyseprozesses, aber auch die
erhöhte Infektionsgefahr bei/durch zahnärztlichen Eingriffen zu
erwähnen.
Das Problem liegt häufig in der unzureichenden Kommunikation zwischen Zahnärzten einerseits und den behandelnden Allgemeinmedizinern und Nephrologen andererseits. Darüber hinaus ist dem HD-Patienten häufig nicht bewusst, dass er als Risikopatient angesehen wird. Eine Absprache zwischen den beteiligten Fachdisziplinen (Allgemein- und Zahnmedizin) vor der Therapie und vor der Gabe von Medikamenten erscheint an dieser Stelle notwendig, um Risiken zu minimieren.23 Ebenso ist die Frage einer nötigen Antibiotikaprophylaxe mit dem behandelnden Arzt abzustimmen.
Bei vielen Medikamenten, die in der zahnärztlichen Praxis Anwendung finden, besteht zudem eine Metabolisierung über die Nieren. Eine umfassende Übersicht hierzu liefert Klenke et al. (2013).1 Im Wesentlichen muss auch eine potenzielle Nephrotoxizität von Arzneimitteln berücksichtigt werden, z. B. sollten Tetrazykline, Aminoglycoside und Polypeptidantibiotika nicht oder nur dosisreduziert gegeben werden.24 Zudem muss der Patient zwingend über mögliche Risikopotenziale aufgeklärt und sein Gesundheitsverhalten entsprechend geleitet bzw. sensibilisiert werden.
Zusätzlich
spielt der Zeitpunkt der Behandlung eine Rolle; aufgrund der
Heparinisierung durch die Dialysetherapie ist es wichtig, eine
zahnärztliche Behandlung auf den Tag nach der (Hämo-) Dialyse zu legen.24
Notwendigkeit einer individuellen und risikoorientierten Prävention
Der
Langzeiterfolg einer präventionsorientierten Therapie aller Patienten,
aber insbesondere von zahnärztlichen Risikopatienten, ist von drei
wesentlichen Aspekten abhängig und sollte bei der Patientenführung von
HD-Patienten Beachtung/Anwendung finden.
- Individuell abgestimmtes und kontinuierliches Risikomanagement (Recallsystem) mit Aufklärung zur Notwendigkeit von Schaffung und Erhalt mundgesunder Verhältnisse.
- Umfassende Diagnostik, d.h. kontinuierliches diagnostisches Monitoring (von Zähnen und Parodont), sowie Überprüfung auf reduzierten Speichelfluss und Erkrankungen der Mundschleimhaut, wie das Auftreten von Gingivawucherung.
- Prophylaxe/Präventionsmaßnahmen
mit Motivation und Instruktion des Patienten sowie professioneller
Zahnreinigung mit dem Ziel der Sanierung bzw. Schaffung und dem Erhalt
mundgesunder Verhältnisse.
Unabhängig
davon ist es wichtig, diese Patienten bei entsprechender
Berücksichtigung der Besonderheiten in ein strukturiertes und
individuell-risikoorientiertes Präventionskonzept der zahnärztlichen
Praxis zu integrieren. Dies kann in der Regel ohne apparativen
Mehraufwand adäquat umgesetzt werden. Ein mögliches Therapieschema zeigt
Abbildung 1.
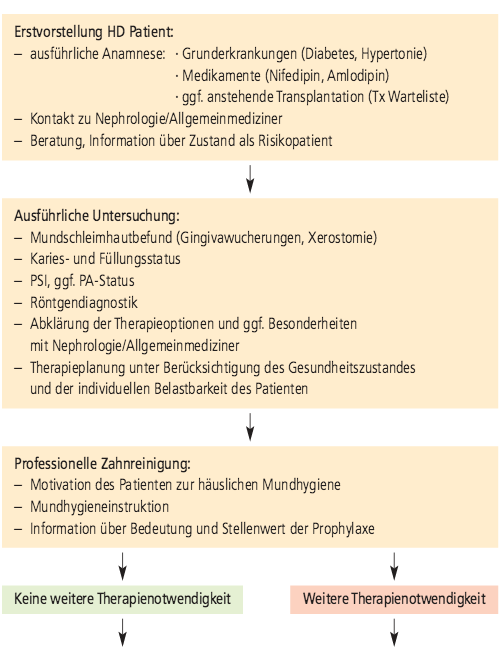
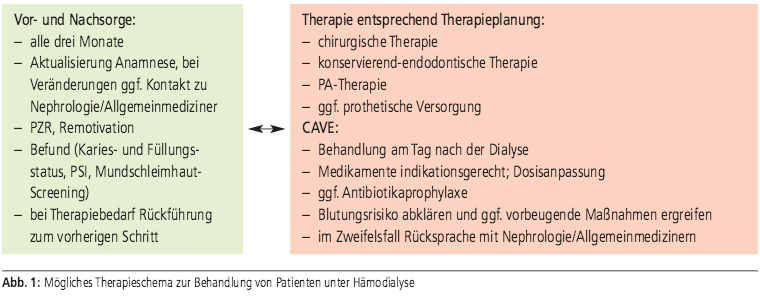
Konsequenzen für die Praxis
Patienten
unter Hämodialyse sind Risikopatienten in der zahnärztlichen Praxis,
deren Versorgung aktuell unzureichend ist. Berücksichtigt man den Fakt,
dass diese Patienten häufig Kandidaten für eine Nierentransplantation
sind, ist eine frühzeitige Therapie und entsprechende Vor- und Nachsorge
oraler Erkrankungen von besonderer Bedeutung.25 Patienten nach
Nierentransplantation sind, wie auch andere Transplantatempfänger,
aufgrund der immunsuppressiven Therapie signifikant gefährdet,
systemische Folgen oraler Infektionen zu erleiden. Die frühzeitige
Sanierung und die prophylaktische Betreuung sind hier also das Mittel
der Wahl (Abb. 1). Seitens von Behandlern (Allgemeinmediziner,
Internist, Zahnarzt) und Patienten ist der Fokus verstärkt auf den
umfangreichen Informationsaustausch sowie die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und Nephrologen bzw.
Allgemeinmedizinern zu legen. In diesem Zusammenhang ist die genaue und
detaillierte Erhebung der Anamnese mit vorliegenden
Allgemeinerkrankungen und begleitender Medikamenteneinnahme essentiell,
ggf. nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Hierbei ist
insbesondere auf das Vorliegen eines Diabetes mellitus, sowie auf eine
suffiziente Einstellung eventueller renaler Hypertonie zu achten.
Medikamente sollten immer unter Berücksichtigung potenzieller
Nephrotoxizität eingesetzt werden, wobei eine strenge
Indikationsstellung und Dosisanpassung bedeutsam sind. Für den Fall,
dass chirurgische Eingriffe notwendig werden, ist ein möglichst
schonendes, atraumatisches Vorgehen unter Beachtung der Hepariniserung
und ggf. unter Antibiotikaprophylaxe angezeigt.1
Zukünftig empfiehlt es sich, spezielle Behandlungs- und Vorsorgekonzepte zu erarbeiten, um HD-Patienten, Patienten nach Transplantation sowie andere Risikopatienten adäquat zu versorgen und somit orale und systemische Komplikationen langfristig zu verhindern.
Zusammenfassend sind bei Patienten unter Hämodialyse die folgenden Punkte zu beachten (Abb. 1):
– detaillierte Erhebung der Krankengeschichte und Medikamentenanamnese
– interdisziplinäre Zusammenarbeit/Abstimmung mit Allgemeinmedizinern/Nephrologen
– zahnärztliche Behandlungen am Tag nach der Dialysetherapie
– ggf. Antibiotikaprophylaxe vor der Behandlung unter Anpassung der Dosierung
– möglichst atraumatisches Arbeiten zur Vermeidung von Blutungskomplikationen
–
Einsatz von Arzneimitteln, vor allem bei der Metabolisierung über die
Nieren, mit strenger Indikationsstellung und dosisreduziert
–
Information der Patienten und Aufklärung über den Status als
Risikopatient, Motivation und Instruktion zur häuslichen Mundhygiene
sowie regelmäßige Präventionstermine
– frühzeitige
zahnärztliche Sanierung und Behandlung, möglichst vor oder am Beginn der
Dialysetherapie; auf jeden Fall vor eventueller Nierentransplantation
– frühzeitige und anhaltende Vor- und lebenslange Nachsorge.
Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.











