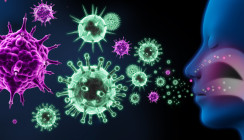Prophylaxe 08.07.2022
Speichel: Wichtig für die Erhaltung von Zähnen und Lebensqualität
share
Einen trockenen Mund hat jeder schon einmal erlebt, beispielsweise in einer Stresssituation. Aber ein dauerhaft reduzierter Speichelfluss kann sehr belastend sein und die Lebensqualität erheblich einschränken. Neben Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme und dem Sprechen erhöht sich mit zunehmender Mundtrockenheit auch das Risiko für Karies. Ungefähr jeder Dritte über 65 Jahre leidet an einer dauerhaften Verminderung des Speichelflusses.1 Der folgende Fachartikel widmet sich der Zusammensetzung des Speichels sowie den Auswirkungen von Mundtrockenheit.
Woher kommt der Speichel?
Der Speichel wird hauptsächlich in den drei großen paarig angelegten Speicheldrüsen produziert (Glandula parotidea, Glandula sublingualis und Glandula submandibularis). Die Glandula parotidea oder auch Ohrspeicheldrüse ist dabei die größte und befindet sich vor sowie unter dem Ohr und reicht vom Jochbogen bis zum Kieferwinkel herunter. Sie produziert ausschließlich serösen Speichel, der über den Ausführungsgang in die Mundhöhle auf Höhe der zweiten oberen Molaren austritt. Die Glandula submandibularis oder Unterkieferspeicheldrüse befindet sich beidseitig am Unterkieferwinkel zwischen Unterkiefer sowie Musculus digastricus und produziert seromukösen Speichel. Der Ausführungsgang mündet zusammen mit dem der Glandula sublingualis (Unterzungendrüse, hauptsächlich muköser Speichel) seitlich des Zungenbändchens. Neben diesen großen Speicheldrüsen gibt es noch ca. 600 bis 1.000 weitere kleine, die sich in der Schleimhaut des Mund-Rachen-Raums befinden. In ihrer Gesamtheit werden pro Tag ca. 0,5–1 Liter Speichel produziert, wobei die Fließrate von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Zum einen unterliegt die Speichelproduktion einem zirkadianen Rhythmus, d. h. die Speichelmenge verändert sich mit unserem Schlaf-Wach-Rhythmus. Zum anderen kann die Fließrate durch emotionale Faktoren beeinflusst werden (z. B. trockener Mund bei Aufregung). Darüber hinaus bewirken die Kautätigkeit selbst sowie eine Reizung der Geschmacksrezeptoren einen Anstieg der Speichelmenge.
Zusammensetzung und Funktionen des Speichels
Speichel besteht hauptsächlich (ca. 99,5 Prozent) aus Wasser. Daneben gibt es eine Reihe weitere Bestandteile, die für die positiven Eigenschaften des Speichels verantwortlich sind. Für die antikariogenen Eigenschaften des Speichels sind anorganische Bestandteile wie Kalzium, Phosphat und Fluorid verantwortlich. Sie dienen beispielsweise der Remineralisation von Zahnhartsubstanzen. Kalzium- und Phosphationen, die während der Demineralisation aus der Zahnoberfläche verloren gehen, werden während der Remineralisationsphase, also zwischen den Mahlzeiten, wieder eingelagert. Darüber hinaus ist der Speichel mit seinen Puffersystemen (Bikarbonat und Phosphat) in der Lage, Säuren zu neutralisieren, und kann somit den pH-Wert nach relativ kurzer Zeit (ca. 30 Minuten) wieder in den Normbereich bringen. Organische Bestandteile wie IgA-Antikörper gegen Streptococcus mutans, Lysozym und Lakotoferrin können direkt antibakteriell wirken und sind somit auch antikariogen wirksam.
Eine weitere Eigenschaft des Speichels ist die Verdauung. Schon in der Mundhöhle wird diese eingeleitet. Die dafür verantwortliche Amylase spaltet bereits Stärke und Glykogen. Muzine (Glykoproteine) sind für die Viskosität des Speichels verantwortlich und begünstigen das Schlucken und Sprechen.
Mundtrockenheit
Mundtrockenheit kommt relativ häufig vor und kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Grundsätzlich wird dabei das subjektiv wahrgenommene Gefühl von Mundtrockenheit von der objektiv messbaren reduzierten Speichelfließrate unterschieden. Vornehmlich sind Senioren betroffen, die aufgrund von Allgemeinerkrankungen viele verschiedene Medikamente einnehmen. Leider wird eine Mundtrockenheit bei älteren Patienten häufig entweder als „normal“ abgetan oder nicht ernst genug genommen. Dazu kommt, dass seitens der Patienten oftmals eine Unsicherheit besteht, an wen sie sich wenden können. Die Symptome können ganz unterschiedlich ausfallen: vom trockenen Mund und aufgesprungenen Lippen bis zu Schwierigkeiten beim Essen sowie Mundgeruch und -brennen. Ein erster Hinweis bei der zahnärztlichen Untersuchung könnte der Mundspiegel sein, der bei der Befundung der Mundhöhle nicht auf der Mundschleimhaut gleitet, sondern oftmals auf der Wangenschleimhaut klebt.
Ursachen
Mundtrockenheit kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, wie z. B. Bestrahlung, systemische und psychische Erkrankungen, Alter, weibliches Geschlecht und Medikamenteneinnahme.2,3 Liegen beispielsweise bei Bestrahlungen im Kopf-Hals-Bereich die Speicheldrüsen im Strahlenfeld, können diese geschädigt werden. Daneben führen Erkrankungen der Speicheldrüsen (Speichelsteine, Mukozelen, Tumore) zu vermindertem Speichelfluss. Auch andere systemische Erkrankungen sind mit Mundtrockenheit assoziiert (z. B. Diabetes mellitus, einige rheumatische Erkrankungen, Alzheimer, Sjögren-Syndrom). Es gibt viele Medikamentengruppen, die mit einer Mundtrockenheit assoziiert sind (z. B. Psychopharmaka, Anticholinergika, Blutdruckmittel [Diuretika, ACE-Hemmer, Betablocker, Kalziumantagonisten]). Dabei kann es vorkommen, dass das gleiche Medikament bei einer Person eine Mundtrockenheit auslöst, während dieser Effekt bei einer anderen nicht eintritt. Je höher jedoch die Anzahl der Einnahme verschiedener Präparate ist, desto höher ist auch das Risiko für Mundtrockenheit.
Auswirkungen
Ein dauerhaft reduzierter Speichelfluss geht mit einer verringerten Lebensqualität einher. Typische Folgen sind ein vermehrtes Auftreten von kariösen Läsionen und Candidiasis, Mund- und Zungenbrennen, schlechter Atem, Geschmacksstörungen sowie Schwierigkeiten beim Kauen, Sprechen und Schlucken4–7, was wiederum bei manchen Senioren einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Allgemeingesundheit und Lebensqualität hat.8
Patienten mit Mundtrockenheit sollten in jedem Fall zu einer optimalen Mundhygiene motiviert und engmaschig in der zahnärztlichen Praxis untersucht werden, um kariöse Läsionen (insbesondere Wurzelkaries) noch im Anfangsstadium behandeln zu können. Darüber hinaus sollten sie über die häuslichen Fluoridierungsmaßnahmen instruiert werden, ggf. kann auch eine Fluoridierungsschiene angepasst werden. Zur Symptomlinderung stehen verschiedene Produkte zur Verfügung, die subjektiv zu einer Besserung der Beschwerden führen. Da es jedoch für den Patienten oft schwierig ist, sich für ein geeignetes Produkt zu entscheiden, sollte die hauszahnärztliche Praxis an der Stelle beratend unterstützen. Es gibt Mundspüllösungen, Mundgele, Sprays als Speichelersatzlösung in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen oder neutral. Da die Wirkung von Patient zu Patient sehr unterschiedlich ist, empfiehlt es sich, verschiedene Applikationsformen auszuprobieren. Darüber hinaus sollte die Erwartungshaltung an den Patienten nicht zu hoch angesetzt werden. Kleine Verbesserungen des subjektiven Empfindens werden sich auf die Lebensqualität deutlich positiv auswirken.
Fazit
Speichel befeuchtet nicht nur die Mundhöhle, sondern hat eine Menge Eigenschaften, ohne die wir massive Probleme beim Sprechen, Schlucken oder Schmecken hätten oder die das Risiko für kariöse Läsionen reduzieren und somit die Lebensqualität aufrechterhalten können. Dennoch gibt es Ursachen für verminderten Speichelfluss, wie z. B. Bestrahlungen im Kopf-Hals-Bereich, einige systemische Erkrankungen und die Einnahme von bestimmten Medikamenten. Sekundärfolgen von vermindertem Speichelfluss sind ein erhöhtes Kariesrisiko (insbesondere Wurzelkaries), Mund- und Zungenbrennen, Candidiasis, schlechter Atem, Geschmacksstörungen sowie Probleme beim Schlucken und Sprechen. Ursächlich ist es oft schwierig, die Symptome zu lindern. Die Patienten sollten jedoch engmaschig zum Recall einbestellt und zu einer optimalen Mundhygiene motiviert und instruiert werden. Bei Bedarf können Speichelersatzlösungen zum Einsatz kommen. Hierzu sollte sich der Patient in seiner hauszahnärztlichen Praxis beraten lassen.
Der Beitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.