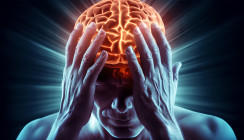Branchenmeldungen 19.09.2023
Ursachen und Herausforderung einer apikalen Parodontitis
share
Die apikale Parodontitis (AP) ist eine häufig vorkommende Erkrankung, bei der sich die Wurzelspitze bakteriell entzündet. Unbehandelt kann sie bis zum Ausfall der Zähne führen. In diesem Interview sprechen Dr. med. dent. Philipp Eble und Dr. med. dent. Sascha Herbst (Charité - Universitätsmedizin Berlin) über Ursachen sowie negative Prognosefaktoren einer AP. Die beiden Experten auf dem Gebiet der Endodontie geben einen Einblick in die Diagnose und Behandlungsoptionen und erklären, welche besonderen Herausforderungen bei der Patientenaufklärung gegeben sein können. Ein Interview mit Dr. Philipp Eble und Dr. Sascha Herbst.
Herr Dr. Eble, Herr Dr. Herbst, in der aktuellen Literatur finden sich Angaben, nach denen 39 bis 41 Prozent der wurzelkanalgefüllten Zähne eine apikale Parodontitis aufweisen. Was können die Ursachen dafür sein?
Philipp Eble: Zunächst sollte im Rahmen der radiologischen Diagnostik apikaler Parodontitiden zwischen bestehenden und ausheilenden apikalen Läsionen differenziert werden. Die Röntgenaufnahme stellt immer nur eine Momentaufnahme dar, welche im zeitlichen Verlauf nach endodontischer Therapie beurteilt werden sollte. Deswegen haben Querschnittsstudien nur eine begrenzte Aussagekraft. Die prädominante Ursache der chronischen apikalen Parodontitis nach endodontischer Behandlung ist eine fortbestehende oder erneut auftretende Infektion des Wurzelkanalsystems. Die chemomechanische Präparation stellt weiterhin eine technische Herausforderung für den Zahnarzt dar. Erst die Präparation, also die Erweiterung des Wurzelkanalsystems, ermöglicht konsekutiv die chemische Reinigung und Desinfektion irregulärer Kanalabschnitte, lateraler Kanäle und apikaler Ramifikationen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufbereitung des Wurzelkanals kann jedoch individuell stark variieren. Die unvollständige Aufbereitung und Desinfektion des Wurzelkanalsystems kann je nach Infektionsgrad des Endodonts die Entstehung einer apikalen Parodontitis zur Folge haben. Hilfreich können hierbei Risk Assessment Tools wie das Endodontic Case Difficulty Assessment Form der AAE sein, mit dessen Hilfe der Zahnarzt den individuellen Schwierigkeitsgrad einer endodontischen Therapie anhand definierter Kriterien bestimmen kann.
Gibt es Patientengruppen, bei denen eine apikale Parodontitis häufiger zu beobachten ist?
Sascha Herbst: Der Zusammenhang zwischen apikaler Parodontitis und systemischen Erkrankungen ist Gegenstand aktueller Diskussionen, und die entsprechende Studienlage ist heterogen. Die am häufigsten hierzu untersuchte Erkrankung ist der Diabetes mellitus. Einige Studien konnten keine signifikant erhöhte Prävalenz bei an Diabetes erkrankten Patienten feststellen, wohingegen andere Arbeiten das Gegenteil veranschaulichten. Es konnte insgesamt gezeigt werden, dass die apikalen Läsionen bei Diabetespatienten insgesamt eine größere Extension aufwiesen als bei der gesunden Vergleichsgruppe. Die pathophysiologischen Prozesse, wie Veränderungen der Immunzellfunktionen und Hochregulation von proinflammatorischen Zytokinen bei gleichzeitiger Herunterregulierung von Wachstumsfaktoren von Makrophagen, können zudem die Ausheilung einer apikalen Parodontitis negativ beeinflussen. Somit ist das Behandlungsergebnis weniger gut vorhersagbar. Des Weiteren werden auch das Rauchen und kardiovaskuläre Erkrankungen kontrovers hinsichtlich eines Einflusses auf den Therapieerfolg diskutiert, jedoch ist hier die Studienlage ebenfalls heterogen. Generell können Erkrankungen mit einem Einfluss auf das Immunsystem als negativer Prädiktor bei der Behandlung einer apikalen Parodontitis angesehen werden
Welche Bildgebungsmöglichkeiten eignen sich am besten zur Diagnostik von apikalen Parodontitiden?
Sascha Herbst: Grundsätzlich stehen in der Praxis drei Verfahren zur Verfügung, welche sich im weiteren Sinne ergänzen und gemäß dem ALARA-Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) gegeneinander abgewogen werden müssen: die Panoramaschichtaufnahme, das Einzelbild und das digitale Volumentomogramm, kurz DVT. Der aktuelle Standard für die Routinediagnostik der apikalen Verhältnisse ist das Einzelbild, welches eine hinreichende Akkuratheit aufweist und für die meisten Fälle ausreichend ist. In einigen Fällen kann aufgrund von möglichen Überlagerungseffekten eine zweite Einzelbildaufnahme aus einem anderen Winkel indiziert sein. Die Panoramaschichtaufnahme ist eher für ein grobes Screening angezeigt und eignet sich nicht für die spezifische Einzelzahndiagnostik. Sie weist die geringste Sensitivität der genannten Verfahren auf und der Frontzahnbereich ist in der Regel nicht auswertbar. Das DVT weist die höchste Sensitivität und Spezifität hinsichtlich der Detektion von apikalen Läsionen auf. Jedoch wird hierbei auch die höchste Strahlendosis freigesetzt, abhängig vom eingestellten Field of View und dem jeweiligen Gerät. Dementsprechend sollte das DVT nur in Einzelfällen verwendet werden und nicht in der Routinediagnostik. Hierfür bleibt das vollständige Einzelbild der Goldstandard in der täglichen Praxis.
Für die Behandlung einer apikalen Parodontitis stehen abhängig von der Ausgangssituation mehrere Behandlungsoptionen zur Verfügung. Welche Behandlungsreihenfolge empfiehlt die aktualisierte S2-Leitlinie zur Wurzelspitzenresektion?
Philipp Eble: Die aktualisierte S2-Leitlinie zur Wurzelspitzenresektion sieht weiterhin eine kausale Therapie der apikalen Parodontitis vor, bei der nicht-chirurgische Verfahren zunächst Vorrang vor invasiveren chirurgischen Maßnahmen haben. Nach Feststellung der Erhaltenswürdigkeit eines Zahns sollte zunächst die primäre endodontische Therapie eingeleitet werden. Bei nicht ausheilenden apikalen Läsionen an bereits endodontisch behandelten Zähnen wird ebenfalls unabhängig von der Größe und der radiologischen Darstellung zunächst eine orthograde Revision empfohlen, da eine zystische Raumforderung weder radiologisch nachgewiesen noch ausgeschlossen werden kann. Je nach histologischer Form der Zyste kann auch hier eine nichtchirurgische Therapie Erfolg bringen. Nur in wenigen Ausnahmefällen sollte unter Abwägung der Invasivität eine Wurzelspitzenresektion anstelle einer orthograden Revision erfolgen. Bei adhäsiven Stiftaufbauten und starker iatrogener Schädigung der Wurzelkanalanatomie muss der nötige Substanzverlust zur Ermöglichung der vollständigen chemomechanischen Reinigung der Invasivität des chirurgischen Eingriffs gegenübergestellt werden.
Der Verlauf einer apikalen Parodontitis kann zunächst durchaus schmerzfrei für den Patienten sein, bis eine Symptomatik auftritt. Welche Auswirkungen hat eine Nichtbehandlung für den Patienten und speziell dessen Zahn?
Sascha Herbst: Die chronische apikale Parodontitis ist charakterisiert durch das Vorhandensein eines persistierenden Entzündungsreizes (bakterielle Infektion), die Anpassung der Immunantwort des Patienten an diesen Stimulus und die Initiierung von Reparaturprozessen. Typischerweise werden bei chronischen Entzündungen Zellen des angeborenen und erworbenen Immunsystems involviert, wodurch es zu einer Hochregulation der proinflammatorischen Mediatoren kommt. Diese Phase kann schmerzfrei sein, jedoch zudem akut exazerbieren. Auch wenn diese Entzündungen zunächst schmerzfrei verlaufen, müssen wir unsere Patienten darauf hinweisen, dass eine Entzündung vorliegt, die wir allerdings nicht direkt sehen – und das kann eine Herausforderung bei der Patientenaufklärung sein. Wir müssen darlegen, dass eine vorliegende chronische Entzündung am Zahn möglicherweise andere chronische Entzündungen im gesamten Körper bidirektional negativ beeinflussen kann. Ferner kann es passieren, dass die chronische Entzündung in eine akute Entzündung übergeht. Dies kann durch eine Änderung der o. g. Einflussfaktoren geschehen, z. B. bei einer fortschreitend undichten Restauration oder einer neu auftretenden (systemischen) Erkrankung des Patienten. Dann kann es zu der berühmten dicken Wange mit starken Beschwerden führen. Damit es weder zur Aufrechterhaltung chronischer Entzündungen noch zu schmerzhaften Abszessen kommt, sollte eine Behandlung der apikalen Parodontitis immer empfohlen werden.
Eine Ursache für eine apikale Parodontitis am wurzelkanalbehandelten Zahn kann u. a. eine nicht- adäquate Desinfektion oder insuffiziente Instrumentation sein. Wie kann man in Zukunft die Wurzelkanalbehandlung optimieren und gibt es vielleicht entsprechende Spüllösungen oder Medikamente, die dabei unterstützen könnten?
Philipp Eble: Der Erfolg der endodontischen Therapie hängt maßgeblich von der vollständigen chemischen Reinigung und Desinfektion des Wurzelkanalsystems ab. Hierzu stehen dem Zahnarzt bereits evidenzbasierte Leitlinien wie die Quality Guidelines der Europäischen Gesellschaft für Endodontologie (The European Society of Endodontology, ESE) zur Verfügung. Vorhandene Protokolle und Spülmedien sind effizient, müssen jedoch korrekt angewendet werden, um hohe Erfolgsraten zu erreichen. Um eine adäquate Keimreduktion zu ermöglichen, ist zunächst die Infektionskontrolle von höchster Bedeutung. Die Kontamination des Zahns während und nach der Behandlung steht jeglichen Bemühungen der Desinfektion im Wege. Grundlegend zählen zu Maßnahmen der Infektionskontrolle die Arbeit mit sterilen Instrumenten, die Verwendung von vorsterilisierten Einmal-Nickel-Titan-Feilen und natürlich der Einsatz von Kofferdam. Kofferdam verhindert die Speichelkontamination des Arbeitsfeldes während der Behandlung, schützt Patienten vor Aspiration und verhindert den Kontakt mit Spülflüssigkeiten. Des Weiteren sollte zwischen Behandlungssitzungen immer ein dichter, möglichst adhäsiver provisorischer Verschluss erfolgen. Basierend auf diesen Überlegungen sollte das Offenlassen von Zähnen grundsätzlich keine Anwendung mehr finden.
Herr Dr. Eble, Herr Dr. Herbst, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Interview ist im EJ Endodontie Journal 3/2023 erschienen.