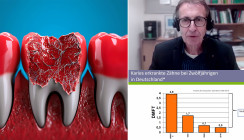Patienten 14.11.2025
Zurück zu den Wurzeln – Dentale Erkrankungen patientengerecht erklärt
share
In der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten erhalten wir fundiertes Wissen über die vielfältigen Aufgabenbereiche in der Zahnmedizin. Doch ein Aspekt kommt oft zu kurz: die verständliche und empathische Kommunikation mit unseren Patienten. Viele Patienten werden beim Zahnarzt mit Begriffen wie „Karies“, „Gingivitis“ oder „Parodontitis“ konfrontiert. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Wie entstehen diese Erkrankungen? Und vor allem: Wie lassen sie sich vermeiden?
Mit der Einführung der in der PAR-Richtlinie enthaltenen Abrechnungsziffern ATG und MHU hat die „sprechende Zahnmedizin“ endlich (neben der Abrechnungsposition IP2 im Rahmen der Individualprophylaxe) Einzug in den Praxisalltag gefunden. Diese Entwicklung sollte jedoch nicht auf Parodontitis und die Individualprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen beschränkt bleiben. Auch bei Karies und Gingivitis im Erwachsenenalter lohnt es sich, Zeit für Aufklärung zu investieren. In einer Sprache, die unsere Patienten wirklich verstehen. Doch wie gelingt das? Wie erkläre ich komplexe Zusammenhänge einfach, ohne in Fachchinesisch zu verfallen und schaffe es gleichzeitig, meine Patienten für mich und die Praxis zu gewinnen?
Erstmal vorweg: Zucker macht die Zähne nicht kaputt und die Bakterien fressen auch nicht den Knochen weg! Das ist zwar einfach und verständlich erklärt, entspricht jedoch nicht dem, was wirklich passiert.
Aber ich weiß doch, was da passiert!
Fachwissen ist unsere Basis – Kommunikation unsere Stärke!
Natürlich wissen wir, was bei Karies, Gingivitis und Parodontitis vor sich geht. Begriffe wie Biofilm, Cavität, Polysaccharide, Lipopolysaccharide oder toxin- und säurebildende Bakterien gehören zu unserem beruflichen Alltag. Doch für die Patientenaufklärung gilt: Weniger ist oft mehr. Es kommt nicht darauf an, möglichst viele Fachbegriffe zu verwenden, sondern darauf, welche Informationen wirklich beim Patienten ankommen. Eine gute Aufklärung bedeutet, Inhalte so zu vermitteln, dass sie verstanden und angenommen werden. Denn wenn unsere Kommunikation nicht patientengerecht ist, sind Zeit und Mühe vergebens.
Wie erkläre ich es meinen Patienten?
Biofilm: organisierte Mikroorganismen, die für fast alle Erkrankungen in der Mundhöhle verantwortlich sind.
Wer kennt es nicht: Die glitschigen Steine beim Durchqueren eines Flussbettes. Oder Sanitäranlagen, die eine schleimige Schicht entwickeln. Das ist Biofilm. Biofilm kann auf allen Flächen entstehen, die mit Wasser in Berührung kommen. So auch in unserem Mund. Es schließen sich mehrere Mikroorganismen zusammen, die diese klebrige Schicht entwickeln, auf welcher sich weitere Mikroorganismen festmachen können. Diese Mikroorganismen entwickeln eine Schutzschicht, kommunizieren untereinander und ernähren sich gegenseitig, sodass sie von äußeren Einflüssen so gut wie unbeeinflusst bleiben. Wird Biofilm nicht regelmäßig, gründlich und schonend zugleich entfernt, können dadurch folglich weitere Erkrankungen entstehen.
Karies: das Loch im Zahn
Ein Loch im Zahn entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist ein schleichender Prozess und beginnt mit etwas ganz Alltäglichem: Zucker, doch der macht die Zähne nicht direkt kaputt. Bakterien lieben den Zucker aus unserer Nahrung und ernähren sich davon. Die Ausscheidungen der Bakterien sind Säuren, welche dem Zahnschmelz Mineralien entziehen. Folglich wird der Zahn porös und nach und nach entsteht das Loch im Zahn.
Man kann sich das vorstellen wie eine Backsteinmauer, aus der zunehmend der Mörtel schwindet. Die Mauer wird instabil und bricht irgendwann in sich zusammen.
Eine weitere Herangehensweise ist der Vergleich mit einem verkalkten Wasserkocher. Um den Wasserkocher wieder kalkfrei zu bekommen, wird mit Säure gearbeitet. Diese löst den Kalk auf. Der Zahn besteht vereinfacht gesagt ebenfalls aus Kalk. Die säurehaltigen Ausscheidungen der Bakterien lösen den Kalk zunehmend auf und machen den Zahn porös.
Je öfter den Bakterien Zucker zur Verfügung stehen, desto schneller löst sich der Zahnschmelz auf. Daher ist es besser, seine „Zuckerration“ auf die Hauptmahlzeiten zu verteilen, als beispielsweise den ganzen Tag über zuckerhaltige Softdrinks zu konsumieren.
Die aktualisierte S3-Leitlinie zur Kariesprävention bei bleibenden Zähnen fasst sieben ineinandergreifende Maßnahmen zusammen, die gemeinsam eine wirksame Vorsorge ermöglichen: Mechanische Biofilmkontrolle, chemische Plaquekontrolle, strukturierte Prophylaxeprogramme, Fluorid, Ernährung, Speichel und Fissurenversiegelungen sollen daher gezielt eingesetzt werden, um Karies zu verhindern.
So, und nun denken die Patienten bei Karies direkt an ein schwarzes Loch. Aber Schmelzkaries beginnt ganz anders: Nämlich weiß!
„Aber Karies ist doch ein schwarzes Loch?! Was hat der weiße Fleck auf meinem Zahn damit zu tun?“
Der weiße Fleck ist das, was wir sehen, wenn der Zahn durch die Säuren der Bakterien porös wird. Jetzt bricht sich dort das Licht aus der Umgebung anders, dadurch wird diese Stelle milchig. Wenn nicht spätestens jetzt eingeschritten und der Biofilm nachhaltig entfernt wird, verfärbt sich diese Stelle nach und nach durch Farbstoffe aus unserer Nahrung. Der Zahn wird zunehmend poröser, bis schließlich ein echtes Loch entsteht.
Und welche Rolle spielt Fluorid dabei?
Fluorid unterstützt die natürlichen Reparaturmechanismen des Zahnes, indem es die Remineralisation fördert, also das Einlagern von Mineralien wie Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Solange sich Demineralisation (das Herauslösen von Mineralien) und Remineralisation in Balance halten, bleibt der Zahn gesund. Gerät dieses Gleichgewicht jedoch ins Wanken und es gehen mehr Mineralien verloren als zurückgeführt werden, entsteht ein Loch. Ohne die regelmäßige Anwendung von fluoridhaltigen Produkten in der Mundhygiene verläuft die Reparatur langsamer und das Risiko für Karies steigt.
Gingivitis: wie die Reaktion des Körpers auf einen Holzsplitter im Finger
Eine Zahnfleischentzündung entsteht durch ausgeschiedene Giftstoffe von Bakterien, die sich am Zahnfleischrand sammeln. Der Körper reagiert darauf mit den typischen Entzündungsreaktionen, die dieselben sind wie bei einem Holzsplitter: Der betroffene Bereich wird rot, dick, warm, beginnt zu schmerzen und wir schonen diese Stelle. Der Körper bekämpft also diesen Fremdkörper. Dasselbe passiert mit unserem Zahnfleisch. Sobald die Bakterien entfernt werden, heilt die Zahnfleischentzündung auch wieder komplett ab.
Parodontitis: der Körper möchte den Zahn loswerden
Wenn eine Zahnfleischentzündung nicht behandelt wird, kann daraus ein Knochenabbau entstehen. Dabei geht das Zahnbett verloren, das aus Knochen und Fasern besteht und den Zahn festhält: die Parodontitis.
Das kann man sich vorstellen wie einen Muskel, der nicht belastet wird. Nur, dass der Muskel durch Training wieder komplett aufgebaut werden kann. Bei unseren Zähnen ist das leider anders. Wenn der Knochen erst einmal verschwunden ist, kommt er nicht wieder zurück. Auch nicht, wenn die Bakterien entfernt sind. Und er geht immer weiter verloren, wenn die Bakterien sich wieder neu organisieren.
Wenn wir jetzt nochmal an den Holzsplitter denken, der trotz Entzündungszeichen nicht entfernt wird, passiert Folgendes: Der Körper möchte den Holzsplitter loswerden und versucht ihn herauszueitern. Gleiches auch bei der Parodontitis: der Körper möchte sich lieber von dem Zahn trennen, als den Bakterienangriff weiter bekämpfen zu müssen. Die Folgen sind mehr Blut, Eiterbildung, Zahnlockerung und folglich Zahnverlust.
Nun können wir durch eine Parodontitisbehandlung die Bakterien größtenteils entfernen. Dadurch, dass sich aber Zahnfleischtaschen durch den Knochenverlust gebildet haben, organisieren sich die Bakterien dort nach einer gewissen Zeit wieder neu und können zu weiteren Entzündungsvorgängen führen. Daher ist eine regelmäßige Unterstützende Parodontitistherapie im Anschluss an eine Parodontitisbehandlung erforderlich, um die Bakterien rechtzeitig wieder zu entfernen, bevor sie weiteren Schaden anrichten.
Reaktionen auf Patientenaussagen:

„Super, dann entfernen wir die Bakterien einmal in der Professionellen Zahnreinigung, dann bekomme ich keine Löcher und keine Zahnfleischentzündungen mehr!“
“Ganz so ist es leider nicht! Die Bakterien kommen wieder zurück, die Gesunderhaltung der Zähne ist Teamwork. Heute entfernen wir die Bakterien gründlich von den Zähnen. Zu Hause liegt es an Ihnen, die Bakterienansammlung in Schach zu halten. Dazu habe ich noch ein paar Tipps für Sie, die Sie direkt umsetzen können!“
Was nun folgt ist eine individuelle Mundhygieneaufklärung, damit der Patient weiß, wie er seine Mundhygiene optimal gestalten kann.
Damit ist es aber noch nicht getan. Bestandteil jeder Präventionssitzung sollte eine aufeinander aufbauende Mundhygieneinstruktion sein, um die Patienten auch zu remotivieren und Erfolge aufzuzeigen. Nur dadurch können fest eingesessene Prozesse langfristig verändert werden und die Gesundheit unserer Patienten wiederhergestellt bzw. erhalten bleiben.
Verstehen schafft Vertrauen
Die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten vermittelt ein breites Fachwissen, doch erst durch eine klare, empathische Kommunikation wird dieses Wissen für unsere Patienten wirklich wertvoll. Karies, Gingivitis und Parodontitis sind für viele Menschen abstrakte Begriffe und oft mit Angst verbunden. Umso wichtiger ist es, diese Erkrankungen bildhaft und alltagsnah zu erklären, ohne Fachchinesisch, und bestenfalls fachlich korrekt.
Denn: Nur wer versteht, was im eigenen Mund passiert, kann Verantwortung für seine Mundgesundheit übernehmen. Kommunikation ist dabei kein „Extra Zuckerl“, sondern ein zentrales Werkzeug für Vertrauen, Motivation und langfristige Zahngesundheit.