Praxismanagement 18.04.2012
Wie Zahnärzte ganzheitlich entscheiden können
share
Zahnärzte stehen zunehmend vor der Herausforderung, Entscheidungen unter sehr komplexen Rahmenbedingungen treffen zu müssen. Ob es darum geht, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, das Dentallabor zu wechseln, einen neuen Lieferanten ins Programm aufzunehmen oder die Praxisräume neu auszustatten bzw. zu wechseln … Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich: Die einen verlassen sich nur noch auf ihr Bauchgefühl, die anderen allein auf ihren Verstand, eine dritte Gruppe reagiert mit Unentschlossenheit – entscheidet also gar nichts mehr. Keiner der drei Lösungswege führt zum Ziel. Denn klug wird eine Entscheidung erst durch das Zusammenspiel unserer rationalen und emotionalen Kompetenzen.
Doch warum müssen wir heute eigentlich mehr Entscheidungen treffen als die Generationen vor uns? Ganz einfach, weil wir mehr Auswahl haben. Zahnärzte arbeiten nicht mehr nur mit Dentallaboren aus der Region zusammen, sondern vergeben Aufträge immer öfter global. Sie wickeln Behandlungen nicht mehr nur selbst ab, sondern arbeiten mit anderen Experten zusammen. Zu den fachlichen Entscheidungen, die Zahnärzte gemeinsam mit ihren Patienten meist souverän treffen, kommen zahlreiche andere Entscheidungen: Telefondienstleister, Computerprovider, Handyverträge u.a. Manch einen treibt die Überfülle an Wahlmöglichkeiten in einen höchst angespannten Stillstand, einen Zustand, der als „Multioptionsparalyse“ bezeichnet wird.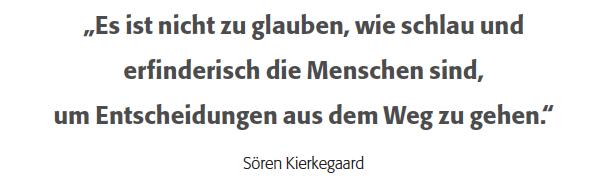
Entscheiden nach dem Bernoulli-Prinzip
Im 18. Jahrhundert glaubte man noch, weise Entscheidungen mit rationalen Formeln abbilden zu können. Der Schweizer Mathematiker und Physiker Daniel Bernoulli, Spross einer berühmten Gelehrtenfamilie, entwarf zahlreiche Formeln zur Entscheidungstheorie, die aber so kompliziert sind, dass wir uns hier mit einer einfachen Fassung (ich bitte die passionierten Mathematiker unter Ihnen um Nachsicht) begnügen wollen:
wE = P(Z) x N(Z)
wE = die weise oder auch gute Entscheidung
P(Z) = Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung
N(Z) = der subjektive Nutzen (= erwarteter Ertrag), den wir mit diesem Ziel verbinden
Bernoulli geht es um eine Maximierung des Nutzens für den Entscheider auf Grundlage rationaler Denkprozesse. Das Problem dabei ist, dass wir es dennoch mit subjektiven Einschätzungen von Wahrscheinlichkeiten zu tun haben und auch den Nutzen des erwarteten Ertrags oft nur subjektiv einschätzen können.
Wo sind die Wegweiser?
Schon Charles de Gaulle war davon überzeugt, dass es besser sei, „unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird“. Wir glauben, Entscheidungen möglichst „rational“ und „logisch“ treffen zu müssen. Dabei macht uns gerade dann, wenn wir das versuchen, unsere emotionale Komponente gern einen Strich durch die Rechnung, wie folgende Beispiele beweisen:
Versenkte Kosten: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine innovative Behandlung entwickelt. Nun stellt sich in Ihrer Praxis aber nicht der erwartete Erfolg ein. Was tun Sie, stoppen Sie die neue Idee? Oder treiben Sie das Projekt weiter voran, weil Sie schon so viel Zeit und Geld investiert haben? Viele Zahnärzte tun genau dies. Sie orientieren sich bei ihren Entscheidungen an der Vergangenheit, obwohl Entscheidungen immer die Zukunft betreffen. Letztendlich lassen sie sich durch ihre Angstvor Verlusten führen oder durch ihren Ärger über die versenkten Kosten. Ist das rational? Wohl kaum. Endloses Maximieren: Viele Menschen unternehmen große Anstrengungen, um die bestmögliche Wahl zu treffen. Sie analysieren Tonnen von Tests, listen Plus- und Minuspunkte auf, halten sich möglichst lange alle Türen offen – und werden doch nicht glücklich. Laut Barry Schwartz, Professor für Psychologie am Swarthmore College in Pennsylvania, sind nicht die „Maximizer“ schlussendlich zufrieden mit ihren Entscheidungen, sondern eher die „Satisficer“. Diese hören einfach mit der Suche auf, wenn sie gefühlsmäßig das Richtige gefunden haben und machen sich weiter keine Gedanken. Das mag zwar nicht besonders rational sein, dafür aber pragmatisch.
Kluge statt richtige Entscheidungen
Richtige Entscheidungen lassen sich heute gar nicht mehr treffen, ist Maja Storch überzeugt. In komplexen, dynamischen Szenarien seien immerhin kluge Entscheidungen möglich, so die promovierte Diplompsychologin und Psychoanalytikerin. Diese entstehen dann, wenn wir nicht nur auf unseren Verstand zurückgreifen (der langsam und gründlich arbeitet), sondern auch auf unser emotionales Erfahrungsgedächtnis: das Bauchgefühl, das seine Bewertung in Millisekunden abgibt, und zwar mit inneren Bildern, Körperempfindungen (Schmetterlinge im Bauch, Klotz am Bein) oder als „innere Stimme“. Auch der niederländische Wissenschaftler Ap Dijksterhuls empfiehlt, auf die unbewusste Informationsverarbeitung zu vertrauen. Der Verstand sei häufig überfordert, sehr viele und widersprüchliche Informationen zu verarbeiten. Wer aber ohne Aufmerksamkeit über eine Entscheidung nachdenke und Entscheidungen auch einmal spontan treffe, sei mit dieser Entscheidung später oft zufriedener als jene, die sehr viele Überlegungen anstellen. Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem eigenen Unbewussten ist, dass wir diesem Raum und Zeit geben. Aber Achtung: Das viel gepriesene Bauchgefühl kann auch in die Irre führen, z.B. durch frühere Erfahrungen, denn oft lassen sich die im emotionalen Erfahrungsgedächtnis gespeicherten Muster nicht auf unsere aktuelle Situation übertragen. Wer als Kind zum Beispiel häufig von seiner jüngeren Schwester übertrumpft wurde, sollte sich klarmachen, dass die jüngere Assistentin eben nicht Teil der früheren Familie ist und keine Bedrohung darstellt.
Praktischer Tipp: Richtig entscheiden
Wenn wir kluge, vielleicht sogar weise Entscheidungen treffen wollen, tun wir gut daran, unsere Rationalität und unsere Emotionalität zu pflegen und zu nutzen. Die Autorin Suzy Welch hat ein sehr einfaches Modell entwickelt, mit dem wir unsere Entscheidungen im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüfen können. Dazu brauchen wir lediglich drei Fragen. Welche Auswirkung hat meine Entscheidung in … zehn Minuten? … zehn Monaten? … zehn Jahren?
Stellen wir unsere Entscheidung auf diesen Prüfstand, so zeigt sich zum Beispiel, dass die Vergabe eines langfristigen Laborauftrags an einen guten Freund bei mir und ihm in den nächsten zehn Minuten eine Art Partystimmung auslösen würde, dass wir aber nach zehn Monaten wahrscheinlich genervt voneinander wären (er von meiner Pedanterie, ich von seiner Unzuverlässigkeit oder umgekehrt) und unsere Freundschaft wahrscheinlich nicht erst nach zehn, sondern schon nach ein bis zwei Jahren stark angeschlagen wäre.
Ganzheitlich entscheiden
Jede Entscheidung fällt im Spannungsfeld zwischen Seele, Herz, Geist und Körper. Wenn wir verantwortungsvoll und umsichtig entscheiden wollen, sollten wir auf diese ganzheitliche Entscheidungsfindung setzen: Wenn wir an eine bevorstehende Entscheidung denken, wie fühlen wir uns körperlich? Wie gehen wir rational mit der bevorstehenden Entscheidung um? Was meldet unsere lntuition? Empfinden wir starke Gefühle der Lust oder Unlust? Setzen Sie sich ganz bewusst mit den verschiedenen Aspekten auseinander, die in Ihre Entscheidung hineinspielen. Lassen Sie sich Zeit, um eine gute Balance innerhalb des Spannungsfeldes zu erreichen. Dabei spielt die Tragweite der aktuellen Entscheidung natürlich eine wesentliche Rolle. Sie können mittags ganz spontan entscheiden, ob Sie gerade eher Lust auf Pizza oder auf Pasta haben. Wenn es um den Kauf einer Praxis oder um die Einstellung einer neuen Mitarbeiterin geht, sieht die Sache schon anders aus. Wichtig dabei ist: Lassen Sie sich bei wichtigen Entscheidungen nicht unter Druck setzen, sonst geben Sie Ihrer Ratio (blindes Vertrauen in Zahlen) oder Ihren Emotionen (Angst, Lust) zu viel Macht und riskieren eine Fehlentscheidung!











