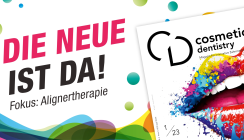Cosmetic Dentistry 20.05.2024
Sanierungskonzept im Fokus der Ästhetik und Funktion
share
Multiple kariöse als auch nicht kariöse Zahnhartsubstanzdefekte führen in den meisten Fällen zum Verlust der vertikalen Höhe und/oder damit verbunden zu einer Kompression im Bereich der Kiefergelenke (Malokklusion).1 Als Folgeerscheinung kommt es häufig zum Anstieg des Stresslevels im Organismus (Kauorgan), was beispielsweise mit Parafunktionen (Pressen und Knirschen) als auch Verspannungen im Kopf-, Schulter- und Halsbereich (Halswirbelsäule, Schultergürtel) einhergeht.
Der immer höhere Anteil von Patienten mit Abrasionen/Attritionen/Erosionen und/oder Parafunktionen fordert ein Umdenken in der Behandlungsweise im Sinne einer biologisch minimalinvasiv2 und okklusionsprophylaktisch orientierten Therapievariante,3 um letztendlich die Sicherung der statischen als auch dynamischen Okklusion zu gewährleisten.4-7 Dabei ist hervorzuheben, dass auf Gelenkebene lediglich ein Spielraum von 0,6–0,8 mm vorliegt8,9 und die Taktilität des Kausystems noch empfindsamer reagiert (0,02–0,03 mm).10 Für die Rekonstruktion von Zähnen/Kauflächen wird als Behandlungsziel eine Defensivgestaltung der Kauflächen angestrebt, um die bei der Parafunktion (Stressventil) auftretenden Kräfte „aufzufangen“ und damit das Risiko einer Überlastung/Schädigung des Kauorgans, respektive des Zahnersatzes, zu minimieren.
Erhöhung der vertikalen Dimension (Problematik)
Eine Veränderung der vertikalen Dimension stellt bei Myoarthropathie, Zahnverlust sowie parodontaler Entzündung in Kombination mit Attachmentverlust eine zusätzliche Hürde dar, insbesondere, wenn „nicht taktiler“, implantatgetragener (Einzel-)Zahnersatz vorgesehen ist.11 Das nachfolgend vorgestellte ganzheitliche Behandlungskonzept soll nun zeigen, wie diese Hürde überwunden wird. Das Hauptaugenmerk richtete sich auf die Funktion, Phonetik und Ästhetik.12,13
Patientenfall
Spezielle Anamnese
Eine 35-jährige Patientin stellte sich auf Empfehlung eines Kollegen mit einem sanierungsbedürftigen, parodontal (Parodontitis apicalis) geschädigten Gebiss vor. Zudem zeigten sich Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Sie wies darauf hin, dass sich aufgrund einer angefangenen prothetischen Sanierung in der jüngsten Vergangenheit das Kauvermögen deutlich reduziert und die Gebisssituation besonders in der oberen Front immer weiter verschlechtert hat. Laut eigener Aussage „passen die Zähne nicht mehr richtig aufeinander“, und seit der angefangenen Sanierung im UK „wäre das Kauen nur noch eingeschränkt möglich“. Zudem leidet sie an überempfindlichen Zahnhälsen im Bereich der Prämolaren und Molaren beidseits. Vor ungefähr 15 Jahren wurde laut Patientin die erste „Full-mouth-Rekonstruktion“ in Mazedonien durchgeführt. Die klinische Funktionsanalyse zeigt positive parafunktionelle Befunde (Okklusaler Index 1,4 „kompensiert +“), welche der Patientin klinisch regelmäßig Kopfschmerzen sowie starke Beschwerden beim Kauen und Schlucken verursachen (Abb. 4).
Allgemeine Anamnese
Erstbesuch und Erhebung der allgemeinmedizinischen Anamnese am 9.1.2020. Bezüglich Kinderkrankheiten erinnert sich die Patientin an Windpocken und Gelbsucht, die Patientin leidet permanent unter Kopfschmerzen. Medikamenteneinnahme: Aspirin, Zoming (Spray). Anamnese ansonsten unauffällig. Die Patientin ist am 1.7.1984 geboren.
Diagnose
Aus der klinischen und röntgenologischen Befundung leiteten sich die Diagnosen chronische apikale Parodontitiden, Myoarthropathie, Parafunktion – Pressen und Knirschen – mit sichtbarem Zahhartsubstanzabrieb (Attrition) einhergehend mit Verlust der vertikalen Dimension (Kompression der Kiefergelenke), HWS-Syndrom (starke Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, regelmäßig Kopfschmerzen), Störung der statischen und dynamischen Okklusion (Latero- und Protrusionsfacetten FZB und SZB) sowie ein prothetisch und konservierend insuffizient versorgtes Erwachsenengebiss ab. Grundsätzlich stand die Diskussion Extraktion der beherdeten Zähne und Ersatz durch Einzelzahnimplantate oder Brückenrekonstruktionen versus Erhalt (Endo-Revisionen 11, 21, 33, 32, 42 und 43) bei fortgeschrittener apikaler Parodontitis, Alveolarkammdeformation im zahnlosen Kieferabschnitt 22 (Knochendehiszenz), Lockerungsgrad I–II an 12, 11, 21 sowie Rezessionen der Gingiva,14 Verlust der interdentalen Papillen im ästhetischen Bereich, mittelhoher Lachlinie und der ausgedehnte Bedarf an konservierender und prothetischer Behandlung im Raum. Nach Abwägung sowohl ethischer als auch für die Patientin wichtiger psychologischer Aspekte ließ dies den apikal beherdeten und teilweise sekundärkariös geschädigten Zähnen zwar eine fragliche Prognose im Hinblick auf die Langzeitstabilität zuteilwerden, jedoch war durch die umfangreichen Vorsanierungen und das junge Alter der Patientin der Fokus auf Zahnerhalt ausgerichtet. Die Patientin wünschte sich zudem nach Möglichkeit ein anspruchsvolles ästhetisches Erscheinungsbild und war sich des Misserfolgsrisikos der zu revidierenden Zähne bewusst. Dass auch bei parodontal angeschlagenen Zähnen nach entsprechender Vorbehandlung eine vorhersagbare Langzeitprognose formuliert werden kann,15 stand außer Frage, jedoch zu welchem (finanziellen und/oder zeitlichen) Aufwand und auch mit entsprechend (vorhersagbarem) ästhetischem Outcome?
Vorbehandlung
Nach Befundaufnahme inklusive klinischer/instrumenteller Funktionsanalyse (Abb. 4) und professioneller Zahnreinigung erfolgte eine Abformung zur Herstellung von Situationsmodellen, Aufnahme des Fotostatus, Clinometerregistrierung, individueller Gesichtsbogenübertragung, Bissnahme in zentrischer Kondylenposition16 nach Deprogrammierung der Kaumuskulatur mit einem Aqualizer (um die Patientin „zentrikfähig“ zu machen, mittels Frontjig und GC Bite Compound nach Gutowski17 (Abb. 5), Wax-up/Mock-up (Abb. 6), Schienenvorbehandlung in RP und Hygienephase für sechs Wochen. Chirurgisch-konservierende Vorbehandlung:
Zystektomie 21/Alveolarkammrekonstruktion Regio 22 (Abb. 7), plast. Stiftaufbauten 13, 12, 11, 21, 35, 33, 32, 42 und 43 nach vorangegangener endodontischer Revision ggf. Wurzelspitzenresektionen bei Nichtausheilung im Apexbereich. Entfernung 17 und 47 aus finanziellen/strategischen Überlegungen, aufgrund diffuser Beschwerden (manchmal dumpf, leichter Druck, kälteempfindlich „je nach Wetterlage“) und infauster Prognose; Alternativtherapien wurden mit der Patientin ausführlich besprochen und abgewogen. Weichgewebeaugmentation Oberkieferfront Regio 22 sowie eine Verdickung des Weichgewebes/Lippenbandexzision Regio 31/41 mit Bindegewebstransplantaten, Tunnelierungstechnik und SchmelzMatrix-Protein (Abb. 8). Etablierung einer neuen vertikalen und horizontalen Relation des Unterkiefers in RP (zentrischer Kondylenposition) mit CAD/CAM-gefertigten LZP (langzeitprovisorischen Brücken in UK- und OK-Front 13-23; Abb. 9) sowie temporären Kompositaufbauten im OK-SZB (Tetric Evo Ceram, Ivoclar) anhand des Wax-up mittels transparenter Silikonschlüssel (Elite Transparent, Zhermack), begleitende Kieferphysiotherapie zur Unterstützung der Adaptation an die neue VDO.18-20 Reevaluation/Akzeptanz der neuen VDO nach Adaptationsphase von vier (Abb. 10) und acht Wochen. Nach erfolgter Vorbehandlung stellten sich alle außer Zahn 17, 47 für die definitive Versorgung geplanten Zähne im Unterkiefer als sicher erhaltungswürdig dar.
Definitive Versorgung
Als nächster Schritt wurder eine schablonengeführte Implantation fürdie definitive Versorgung im Unterkiefer (NobelGuide, Nobel Biocare) (Abb. 11) mit verschraubten Einzelkronen (Lithiumdisilikat IPS e.max Press, Ivoclar) auf Titanabutments (Universal Base Abutments, Nobel Biocare) geklebt (Multilink Hybrid-Abutment, Ivoclar) gewählt (Abb. 12). Die Implantation (zweizeitiges Vorgehen) fand an den Positionen 036, 045 und 031 statt (Replace Select Tapered RP jeweils 8 mm und NobelActive 3.0 im UK-Frontzahnbereich Länge 10 mm, Nobel Biocare).21 Zeitgleich wurde nach Implantatverschluss mit Deckschrauben eine ortständige Augmentation mit Knochenersatzmaterial (DBBM, Bio-Oss, Geistlich) und Stabilisierung mit Kollgenmembran (Bio-Gide, Geistlich) durchgeführt und anschließend mit 5/0er Naht verschlossen. Prä- und postoperativ wurde eine Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage verordnet. Die definitive Versorgung erfolgte dann nach Einheilphase von sechs Monaten und vorheriger Austestung der Bisslage mit verblockten Langzeitprovisorien. Chirurgisch-ästhetische Kronenverlängerung OK-Prämolaren beidseits nach lokaler Anästhesie (Articain 1:100.000, Aventis), sulkulärer Inzision und modellierender Ostektomie im Bukkalbereich. Ausformung Gingiva mittels externer Gingivektomie sowie Präparation Seitenzahnbereiche 17-14, 24–26 für verblockte Langzeitprovisorien. Reevaluation klinische und instrumentelle Funktionsanalyse nach vier Wochen. Neues Wax-up OK/UK mit Bissabsenkung (Optimierung des Overbite) und Gestaltung einer flacheren Okklusionsebene. Präparation OK zur Herstellung eines CAD/CAM-gefrästen OK-LZP (Anpassung UK-Kauflächen mit durchsichtigen Silikonschlüsseln und Komposit via neuem Wax-up) wahlweise mit „schmalen“ und „breiten“ Frontzähnen. Erneute Reevaluation nach vier Wochen Austestung der Bisslage mittels klinischer Funktionsanalyse. Im nächsten Schritt erfolgte die Insertion eines Einzelzahnimplantats 022 für die definitive Versorgung mit verschraubter Implantateinzelkrone (Creapresskäppchen und feldspatkeramische Verblendung, Creation Willi Geller, KLEMA) auf Titanabutment (A3 Dental) geklebt (Multilink Hybrid-Abutment, Ivoclar), nach erfolgter Einheilphase von sechs Monaten.21 Zusätzlich erfolgte aufgrund einer Kronen/Wurzelfraktur an Zahn 42 ein Ersatz per Sofortimplantation, zweizeitig, mit einem NobelActive 3.0, 10 mm (Nobel Biocare) Implantat nach erfolgter Leitungsanästhesie (Articain 1:100.000, Aventis). Implantatverschluss mit Deckschraube. Weichgewebeaugmentation, primärer Wundverschluss. Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Schmerzmedikation nach Bedarf.
- Präparation für die definitive Versorgung im Unterkiefer 35, 37, 44 und 46 mit Presskeramikteilkronen.
- Verschraubte Implantatkrone 036 und 045 (Abb. 13).
- Anschließend Präparation für die definitive Versorgung im Oberkieferseitenzahnbereich 4, 5 und 6 beidseits mit Presskeramikteilkronen.
- Eingliederung und Nachsorge (Abb. 14).
- WSR 11, persistierende Entzündung nach Wurzelkanalbehandlung im Januar 2020.
- Reentry 031 aufgrund Periimplantitis – Aufbau mit DBBM/Kollegenmembran/Emdogain und Bindegewebstransplantat.
- Abformung UK-Frontsegment 34, 33, 031, 042, 43 zur Herstellung der definitiven Versorgung mit Presskeramikrestaurationen.
- Erneute Freilegung 032 und 042, Eingliederung/Versorgung nach sieben Monaten Wartezeit.
- Abschließende Präparation (nach Hart- und Weichgewebeaugmentation Regio 22 und temporärer Versorgung mit LZP für zwölf Monate) für die definitive Versorgung der OK-Front 13-23 mit Vollkeramikrestaurationen (Presskeramikgerüste Creapress, KLEMA, vollverblendet mit Feldspatkeramik Creation CC, KLEMA; Abb. 15, 16).
- Abdrucknahme, Zentrikbissnahme, Gesichtsbogenübertragung, Anproben und definitive Eingliederung in den Folgesitzungen.
Diskussion/Epikrise
Mit dem Fokus auf die funktionell kompromittierte Ausgangssituation wurde nach knapp 1,5 Jahren eine Condylografie vorgenommen. Insgesamt sind die Bahnen „symmetrischer“ geworden und die geführten Bewegungen haben sich deutlich verbessert. Dies lässt im Umkehrschluss auf eine gesteigerte Effizienz der Muskulatur schließen, welche das strukturelle (internal derangement) Defizit auf Gelenkebene „kompensiert“. Der Unterkiefer „arbeitet“ nach Abschluss der Rekonstruktion „interferenzfreier“ und „muskulär koordinierter“ als je zuvor. Das bedeutet: Die Kaumuskulatur arbeitet mit weniger Kraft (keine Vermeidungs- und Ausweichbewegungen) und mehr Effizienz (verbesserte Okklusion und Artikulation Abb. 17–19). Dies ist der Therapieplanung (i. S. eines „Backward Planning) und deren/dessen gezielte Umsetzung und somit hohe Vorhersagbarkeit für eine langfristige Prognose der Rekonstruktion zuzusprechen. Im Molarenbereich zeigen sich noch dynamische Kontakte, insbesondere bei parafunktioneller Aktivität (siehe BRUX CHECKER; Abb. 20), die sich auch im Erscheinungsbild der Condylografie-Kurven widerspiegeln. Aufgrund der klinischen Beschwerdefreiheit und auch der Tatsache, dass Heilungs- und Umbauvorgänge im Gelenk noch stattfinden können, soll vorerst noch sechs bis zwölf Monate bei regelmäßiger klinischer Nachkontrolle abgewartet werden. Die Patientin ist subjektiv beschwerdefrei (keine Anzeichen einer Dekompensation in der klinischen Funktionsanalyse) und zeigt keine Druckdolenz der (Kau-)Muskulatur und/oder der Gelenke.22,23
Modifizierte Version des Beitrags „Ein ganzheitliches Therapiekonzept. Vier-Quadranten-Rehabilitation nach parodontal-funktioneller und kariöser Schädigung“, erschienen in Zahnärztl Implantol 1:20-27. https://doi.org/10.1007/s44293-024-0011-8
Erstveröffentlicht: Egger S, Greven M, Berg C (2024) Vier-Quadranten-Rehabilitation nach parodontal-funktioneller und kariöser Schädigung. Zahn-Zeitung Schweiz, 11. Jahrgang, Februar 2023, S. 4–6
Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Dieser Beitrag ist in der cosmetic dentistry 1/24 erschienen.