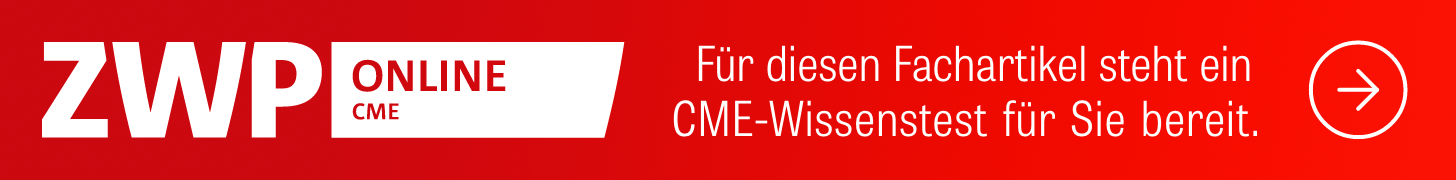Implantologie 06.11.2023
Konsequente Planung für den Implantaterfolg
share
Ein Beitrag von Dr. Juliane Wagner, Dr. Johannes H. Spille, Dr. Dr. Christian Flörke, Priv.-Doz. Dr. Aydin Gülses und Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang.
Implantatgetragener Zahnersatz ist in der modernen Zahnmedizin fest etabliert und stellt einen wichtigen Baustein zur dentalen Rehabilitation dar. In Deutschland werden jedes Jahr über eine Million dentale Implantate inseriert – mit steigender Tendenz. Hierbei zeigt sich zunehmend, dass vor allem eine konsequente Planung, von der Anamnese bis zum Zahnersatz, das langfristige Überleben der dentalen Implantate sichert. Patientenwünsche sollten dabei genauso wie Komorbiditäten stets berücksichtigt werden.
Die 64-jährige Patientin stellte sich zur Implantatberatung in unserer Klinik vor. Es erfolgte die Anamnese und klinische Patientenuntersuchung.
In der Anamnese ergaben sich keine Auffälligkeiten, die Patientin berichtete jedoch von einer Diabeteserkrankung sowohl ihrer Mutter als auch ihres Vaters im mittleren Erwachsenenalter. Um welchen Typ es sich dabei handelte, konnte sie nicht benennen. Zudem sei einmalig bei ihr ein leicht erhöhter Blutzucker festgestellt worden. Klinisch zeigte sich eine Freiendsituation distal des Zahns 34. Weiterhin war das Gebiss konservierend und prothetisch suffizient versorgt. Im Gegenkiefer lag eine Bezahnung bis zum Zahn 28 vor. Die Patientin wünschte einen festsitzenden Zahnersatz im III. Quadranten.
In der durchgeführten digitalen Volumentomografie diagnostizierten wir sowohl in der Höhe als auch in der Breite ein unzureichendes Knochenangebot für eine Implantatversorgung (Abb. 1).
Es erfolgte die Empfehlung zur Konsultation ihrer Hausärztin. Hier erfolgte bei einer Routineuntersuchung die Bestimmung der Nüchternblutglukose, sowie des HbA1c. Beide zeigten sich normwertig. Zudem bestanden bei der Patientin keine diabetestypischen Symptome.
Eine Knochenaugmentation mittels Schalentechnik von der linksseitigen Linea obliqua wurde geplant. Mit dem Piezoinstrument sowie einem Meißel wurde ein Kortikalisfragment von circa 3 cm Länge und 1,5 cm Breite entnommen. Mittels Bone Scraper wurde zusätzlich Knochen vom Kieferwinkel gesammelt, welcher im Sinne einer Schalentechnik zwischen dem zu augmentierenden Unterkiefer und dem Kortikalisfragment platziert wurde. Nach vier Monaten wurden die Fixationsschrauben wieder entfernt und in der Regio 35 (3,8 x 11 mm) sowie Regio 37 (4,3 x 11 mm) jeweils ein Implantat (CAMLOG) inseriert. Vor beiden Eingriffen erfolgte die Anwendung von Chlorhexidin-Mundspüllösung als orales Antiseptikum sowie die perioperative Antibiose im Fall der Augmentation und die Singleshot-Antibiose mittel Ampicillin/Sulbactam im Rahmen der Implantation (Abb. 2–4).
Die Implantatfreilegung erfolgte drei Monate später, im Anschluss wurde die prothetische Versorgung über den Hauszahnarzt angefertigt. Das einjährige Follow-up ist in den Abbildungen 5 und 6 zu sehen. Die Patientin ist mit dem erreichten Ergebnis zufrieden.
Planung
In dem hier vorgestellten Fall erfolgte die Planung zur Knochenaugmentation und Implantatinsertion erst nach entsprechender hausärztlicher Abklärung zum Ausschluss eines Diabetes mellitus. Ist dies übertrieben oder notwendig? Die Leitlinienaktualisierung Zahnimplantate bei Diabetes mellitus gibt hierzu konsentierte Empfehlungen.
Grundsätzlich gelten für die Diagnose des Diabetes die diagnostischen WHO-Kriterien:
- Nüchtern-Plasma-Glukose ≥ 126 mg/dl
- Zufalls-Plasma-Glukose ≥ 200 mg/dl mit diabetestypischen Symptomen
- HbA1c ≥ 6,5 Prozent
Der HbA1c-Wert entspricht dem prozentualen Anteil des glykosylierten Hämoglobins und erlaubt einen Rückschluss auf die Blutzuckereinstellung in etwa der letzten zehn Wochen und gilt als Langzeitwert des Blutzuckers. Die Diagnostik des Diabetes mellitus liegt in der Hand des Allgemeinmediziners, Internisten, Endokrinologen, Diabetologen oder weiteren qualifizierten Fachärzten. Bei Vorliegen intermediärer erhöhter Blutzuckerwerte, welche einen Risikofaktor für die Ausbildung eines Diabetes mallitus darstellen, sollte empfohlen werden, dies weiter abklären zu lassen.
Lange Zeit galt Diabetes mellitus als eine Kontraindikation für die dentale Implantologie, da von Störungen der Wundheilung und knöchernen Integration ausgegangen wurde. Auch eine erhöhte Rate an Periimplantitis und Implantatversagen wurde postuliert. Die Prävalenz des Diabetes mellitus steigt zudem kontinuierlich an und immer häufiger äußern auch diese Patienten den Wunsch nach einer dentalen Rehabiliation mit implantatgetragenem Zahnersatz. Auch Menschen mit intermediär erhöhten Blutzuckerwerten haben bereits ein erhöhtes Risiko, an Diabetes mellitus zu erkranken. In Studien konnte gezeigt werden, dass bei 37 Prozent der Betroffenen innerhalb von vier Jahren ein manifester Diabetes mellitus auftritt; innerhalb von zehn Jahren bei bis zu 50 Prozent.1 Auch die Prävalenz intermediär erhöhter Blutzuckerwerte nimmt weltweit zu und wird ebenfalls als ein allgemeinmedizinischer Risikoindikator diskutiert. Dies wurde bei der Erstellung der aktualisierten Leitlinie erstmalig berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund wurde eine aktuelle S3-Leitlinie, entsprechend den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), entwickelt.
Die Leitlinie gibt Empfehlungen zu notwendigen Untersuchungen und Therapieentscheidungen:
- Vor Behandlungsbeginn soll die Anamnese bezüglich Risikofaktoren inklusive Diabetes mellitus erhoben werden.
- Vor Behandlungsbeginn sollte sich der behandelnde Arzt/Zahnarzt über die Einstellung des Diabetes mellitus informieren. Die Einstellung sollte dem Zielkorridor nach der Nationalen Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes entsprechen.
- Vor Behandlungsbeginn soll der behandelnde Arzt/Zahnarzt bei Patienten mit Diabetes mellitus den parodontalen Gesundheitszustand berücksichtigen. Bei Vorliegen einer parodontalen Erkrankung soll eine adäquate Parodontaltherapie entsprechend der Leitlinie Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III erfolgen.
Bei der Patientin wurden diese Empfehlungen berücksichtigt. Ein Diabetes konnte ausgeschlossen werden. Eine Parodontitis lag ebenfalls nicht vor.
Ist die Implantatinsertion bei Diabetikern möglich?
Die Leitlinie ist hier deutlich. Einer Implantatinsertion steht bei der Einhaltung entsprechender Kautelen nichts im Weg:
1. Diabetes mellitus und Implantatüberleben
Intermediär erhöhte Blutzuckerwerte scheinen keinen Einfluss auf das Implantatüberleben zu haben. Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede der Überlebensraten in den ersten Jahren bei Patienten mit Diabetes mellitus im Vergleich zur gesunden Vergleichsgruppe. Im Langzeitverlauf scheint das Risiko für einen Implantatverlust jedoch erhöht zu sein.
2. Einfluss einer adjuvanten Therapie
Die Studienlage ist hier eindeutig. Die prophylaktische Gabe eines Antibiotikums als präoperative Einmalgabe sollte bei Patienten mit Diabetes mellitus bei der Implantation erfolgen. Die perioperative Anwendung einer desinfizierenden Mundspülung sollte bei Menschen mit Diabetes mellitus zur Implantation außerdem erfolgen.
In unserer Klinik werden beide Empfehlungen standardmäßig und bei allen Patienten durchgeführt. Ein Infektionsrisiko kann so verringert und bestenfalls vermieden werden.
3. Diabetes mellitus und Osseointegration
Patienten mit schlecht eingestelltem Diabetes mellitus scheinen eine verzögerte Osseointegration nach der Implantation aufzuweisen, während die Angaben zur Osseointegration bei gut eingestelltem Diabetes mellitus heterogen sind. Nach einem Jahr scheint es jedoch keinen Unterschied in der Implantatstabilität zwischen Patienten mit Diabetes mellitus und gesunden Patienten zu geben.Aufgrund von Hinweisen auf eine verzögerte Osseointegration sollte die Indikation für eine Sofort- und Frühbelastung insbesondere bei Patienten mit schlecht eingestelltem Diabetes mellitus kritisch gestellt werden.
4. Diabetes mellitus und Periimplantitis
Der unmittelbare Einfluss von Diabetes mellitus auf die Entstehung periimplantärer Infektionen ist aufgrund einer heterogen Datenlage unklar. Im zeitlichen Verlauf scheint das Risiko für periimplantäre Infektionen anzusteigen.
Deshalb wurde die folgende evidenzbasierte Empfehlung mit einem starken Konsens beschlossen: Da Patienten mit Diabetes mellitus ein höheres Risiko für Periimplantitis aufweisen, sollte
A. der Patient hierüber bereits vor Beginn der Therapie aufgeklärt werden.
B. eine risikoorientierte Nachsorge nach der Implantatinsertion erfolgen.
5. Diabetes mellitus und Knochenaufbau
In den letzten Jahren wurden einige hochwertige Studien zur Augmentation bei Diabetikern durchgeführt.2–4 Dabei zeigte sich zusammenfassend sowohl in Bezug auf die Knochenaugmentation, das Implantatüberleben sowie eine periimplantäre Knochenalteration kein Unterschied. Es erging ein evidenzbasiertes Statement bezüglich des Knochenaufbaus bei Diabetes mellitus. In der Literatur finden sich keine Hinweise darauf, dass Augmentationsverfahren wie Guided Bone Regeneration und Sinuslift eine höhere Komplikations- und Fehlerrate bei Patienten mit gut eingestelltem Diabetes mellitus im Vergleich zu Patienten ohne Diabetes mellitus aufweisen.
6. Einfluss der Güte der Blutzuckereinstellung
Mindestens genauso wichtig wie die Feststellung, ob ein Patient an Diabetes mellitus erkrankt ist oder nicht, ist die Frage, wie gut die Einstellung des Blutzuckers durchgeführt wird. Die Nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes gibt einen Zielkorridor für den HbA1c von 6,5 bis 7,5 Prozent vor.5 Insgesamt zeigt sich bezüglich der Güte der Blutzuckereinstellung eine äußerst heterogene Studienlage.6–8
Somit ergingen folgendes Statement sowie evidenzbasierte Empfehlungen:
- Es ist aufgrund der heterogenen Studienergebnisse unklar, ob die Güte der Blutzuckereinstellung einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg der Implantattherapie zeigt.
- Im Rahmen der Nachsorge von Menschen mit bekanntem Diabetes mellitus sollte der behandelnde Arzt/Zahnarzt sich über den HbA1c-Wert des Patienten informieren und bei Bedarf weiter ärztlich abklären lassen.
7. Einfluss der Erkrankungsdauer
Es ist plausibel, dass mit längerer Erkrankungsdauer an Diabetes mellitus die systemischen Auswirkungen zunehmen. Der Einfluss der Erkrankungsdauer auf die Ergebnisse der Implantation ist jedoch nur unzureichend untersucht. Es liegt insgesamt keine ausreichende Evidenz über den möglichen Einfluss der Erkrankungsdauer des Diabetes mellitus auf die Implantattherapie vor.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dentale Rehabilitation mit Zahnimplantaten bei Menschen mit intermediär erhöhten Blutzuckerwerten und Diabetes mellitus bei korrekter Indikationsstellung und einem risikoorientierten Vorgehen ein sicheres und vorhersagbares Verfahren ist. Außerdem legt die hier vorgestellte Leitlinienaktualisierung einen besonderen Schwerpunkt auf die Vorbereitung und Nachsorge.
Zahnärzte sollen bereits bei der Anamnese vor Beginn der Behandlung die Patienten fragen, ob erhöhte Blutzuckerwerte oder ein Diabetes mellitus vorliegen. Bei Patienten mit Diabetes sollen Zahnärzte den parodontalen Status erheben, untersuchen und ggf. eine leitliniengerechte Therapie einleiten. Bei der Nachsorge sollen Zahnärzte sich bei Patienten mit Diabetes über den HbA1c-Wert informieren.
Außerdem konnte festgehalten werden, dass intermediär erhöhte Blutzuckerwerte keinen Einfluss auf das Überleben von dentalen Implantaten zu haben schienen. Unklar ist, aufgrund der heterogenen Studienergebnisse, ob die Güte der Blutzuckereinstellung einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg einer Implantattherapie hat. Zudem bleibt weiterhin zu beobachten, ob die Dauer einer Diabeteserkrankung einen Einfluss auf die Implantattherapie hat.
Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Dieser Beitrag ist im IJ Implantologie Journal erschienen.
Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren.