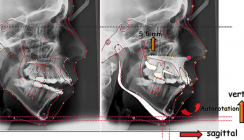Oralchirurgie 24.02.2016
Kurze Implantate mit hydrophiler Oberfläche als Verankerungselemente von Orbitaepithesen
share
Enossale Implantatsysteme als Verankerungselemente von Orbitaepithesen sind bislang in Bezug auf Makro- und Mikromorphologie kaum weiterentwickelt worden. Neue, kurze Implantate aus Roxolid mit hydrophiler Oberfläche versprechen einen ggf. besseren Nutzen. Prof. Dr. Thomas Weischer et al. beschreiben in diesem Zusammenhang anhand eines Fallbeispiels die Möglichkeiten von Kurzimplantaten.
Nach ausgedehnter chirurgischer Behandlung orbitaler Malignome und ggf. adjuvanter Strahlentherapie werden zur Gesichtsharmonisierung und zur sozialen Rehabilitation der Patienten in den meisten Fällen Epithesen benötigt.2,3,6,9 Orbitaepithesen erhalten in der Regel erst durch enossale Implantate die zur kosmetischen Rehabilitation zwingend notwendige sichere Lagestabilität.10–12 Vermutlich aufgrund der im Vergleich zur Mundhöhlenanwendung geringen Anzahl verwendeter extraoraler Implantate haben diese bislang in Bezug auf die Materialwahl und Oberflächenkonditionierung nicht die gleiche rasante, positive Entwicklung durchgemacht wie die primär für den Mundhöhleneinsatz entwickelten Fixturen. Insbesondere neue, hydrophile Oberflächen scheinen eine schnellere Osseointegration und damit verkürzte Einheilzeit der Implantate und, bei entsprechender Makromorphologie und Materialwahl, eine bessere Primärstabilität bei reduzierter Knochenqualität und -quantität zu erlauben.1,7,8
Mit dem primär für die intraorale Anwendung entwickelten 4 mm langen und 4,1 mm breiten Implantat aus Roxolid® mit einer hydrophilen SLActive® Oberfläche (Standard Plus, Straumann) scheint jetzt auch ein Implantatsystem für den extraoralen Einsatz zur Verfügung zu stehen, das die Qualität der intraoralen Systeme impliziert. Im Folgenden wird die Versorgung einer Patientin mit vier Straumann Standard Plus Implantaten als Halteelemente einer Orbitaepithese vorgestellt.
Fallbericht
Bei einer 64-jährigen Patientin wurde ein Melanom der rechtsseitigen Konjunktiva – bei Zustand nach Radiatio einer ausgedehnten vaskulären Malformation der rechten Gesichtshälfte im Alter von zehn Jahren – diagnostiziert. Therapeutischerseits erfolgte eine rechtsseitige Exenteratio orbitae sowie die Defektdeckung mit einem paramedian gestielten Stirnlappen. Sechs Wochen später wurde der Lappenstiel durchtrennt und zurückverlagert sowie eine Hämangiomreduktion der Glabella paramedian rechtsseitig durchgeführt. Nach Abschluss der eigentlichen Tumorbehandlung stellten sich schwierige hart- und weichgewebliche anatomische Verhältnisse dar, die auf konventionellem Weg keine hinreichende epithetische Versorgung erlaubten. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, enossale Implantate als epithetische Halteelemente einzubringen. Drei Monate später erfolgte in Intubationsnarkose die primärstabile Inser-tion von vier Implantaten mit einer Länge von 4 mm und einem Durchmesser von 4,1 mm in den supraorbitalen bzw. lateralen Orbitarand. Nach drei Monaten wurden die Implantate in Lokalanästhesie freigelegt und Healing-Abutments aufgeschraubt. Die Periotestwerte betrugen von kranial nach kaudal –4, –4, –3, –4. Zwei Wochen danach wurden die Healing-Abutments gegen Magnete der Länge 4 mm ausgewechselt und die rechte Orbita samt Implantate abgeformt. Weitere zwei Wochen später konnte die implantatgestützte Epithese eingegliedert werden. Durch das vorgestellte Konzept war es möglich, die Patientin trotz der schwierigen Ausgangslage hinreichend epithetisch zu rehabilitieren.
Diskussion
Bislang sind in der Essener Klinik drei Patienten (ein bestrahlter und zwei nicht bestrahlte Patienten im Alter zwischen 53 und 80 Jahren) nach exenteratio orbitae, bedingt durch orbitale Tumore, mit jeweils vier 4 mm langen und 4,1 mm breiten Implantaten versorgt worden. Trotz teilweise qualitativ und quantitativ reduzierter knöcherner Verhältnisse gelang es in allen Fällen, die Implantate primärstabil in epithetisch versorgbarer Position im Bereich der lateralen Orbita bzw. des Supraorbitalrandes zu inserieren. Die Implantatfreilegung erfolgte bereits nach drei Monaten. Alle Implantate wurden mit Magneten als epithetische Haltelemente versorgt. Über den bisher kurzen Beobachtungszeitraum von sieben Monaten ist keine Fixtur verloren gegangen.
In der Literatur existieren bislang nur wenige Studien über die Langzeitergebnisse von Implantaten genutzt als Halteelemente von Orbitaepithesen.4,5,12 Auch wenn diese Ergebnisse durchaus günstige Langzeitprognosen der extraoralen Fixturen, wie z. B. eine kumulative Implantatverweildauer von 77 Prozent nach sechs Jahren5 bzw. 86 Prozent nach zwölf Jahren4, beschreiben, so erreichen die Ergebnisse jedoch keine Implantatüberlebensraten, wie sie für die oral angewendeten Implantate bestehen. Durch die jetzt mögliche qualitative Gleichschaltung der extraoralen Fixturen mit den intraoral genutzten Implantaten durch kurze Roxolidimplantate mit hydrophiler Oberfläche scheint somit eine Option zu bestehen, die Prognose extraoraler Implantate, genutzt als Halteelemente für Orbitaepithesen, zu optimieren. Die Anschlussgeometrie bzw. -optionen des hier verwendeten Implantatsystems scheinen die Voraussetzungen für eine hinreichende epithetische Versorgung zu erfüllen. Weitere Studien an einem größeren Kollektiv und über einen längeren Zeitraum sind jedoch notwendig, um diese ersten Anwendungsbeobachtungen verifizieren zu können.
Hier gehts zur vollständigen Literaturliste.
Autoren: Prof. Dr. Thomas Weischer, Matthias Klein, Claus Schmeling, Prof. Dr. Dr. Christopher Mohr