Parodontologie 10.09.2013
Kardiovaskuläre Erkrankungen und Parodontitis
share
Gelingt es, zu beweisen, dass durch
parodontale Behandlung eine Verbesserung der Gefäßerkrankungen zu
erreichen ist, wäre das ein wichtiger Therapieansatz für die
demografisch gesehen stetig älter werdende Bevölkerung. Von Dr.
Behrouz Arefnia und Univ.-Doz. Prof. Dr. Gernot Wimmer, Medizinische
Universität Graz
Atherosklerotische vaskuläre Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Etwa 30
Prozent aller Todesfälle sind Folge einer Atherosklerose. In
Österreich führen die Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems
deutlich und mit großem Abstand die Statistiken der Todesursachen
mit über 40 Prozent (Krebserkrankungen als zweithäufigste mit 26
Prozent) an (Abb. 1) und nehmen mit steigendem Alter am raschesten zu
(Abb. 2). In der Schweiz liegen besonders
deutlich in der älteren Bevölkerung die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache an erster Stelle (Abb. 3).2 Wenn man, aufgrund mangelnder Daten
aus Österreich, die Prävalenz der Parodontitis anhand
epidemiologischer Erhebungen aus Deutschland heranzieht, ist
festzustellen, dass in der Altersgruppe der Senioren die Anzahl der
parodontal erkrankten Menschen unverkennbar ansteigt (Abb. 4).3 Regionale Erhebungen aus der Schweiz
konnten zeigen, dass fortgeschrittener Attachmentverlust und
erhöhte Sondierungstiefen vor allem in den älteren Bevölkerungsschichten auftreten.4,5 Konkludierend könnte man sagen, dass
mit zunehmendem Alter die Anzahl der Prävalenz der Parodontitis und
kardiovaskuläre Erkrankungen als Todesursache Nummer 1 ansteigt. Der Verdacht, dass
beide Erkrankungen nicht nur nebeneinander koexistieren, sondern sich
auch wechselseitig beeinflussen, erhärtet sich mit zunehmendem
Verständnis ihrer Ätiopathogenese.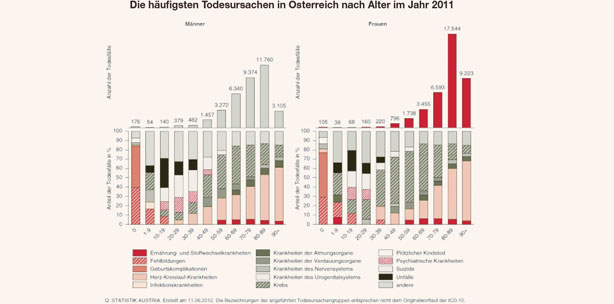
Abb. 1: Todesursachen Österreich (Vollansicht)
Auch sozioökonomisch ist dieser
Krankheitskomplex eine große gesellschaftliche Belastung.
Schätzungen in den USA aus dem Jahre 2008 berechnen direkte und
indirekte Kosten aufgrund von atherosklerotischen vaskulären Erkrankungen auf 298 Milliarden
US-Dollar.6 Zum Vergleich betrug das Bruttoinlandsprodukt in
Österreich im Jahr 2008 281,9 Milliarden Euro.7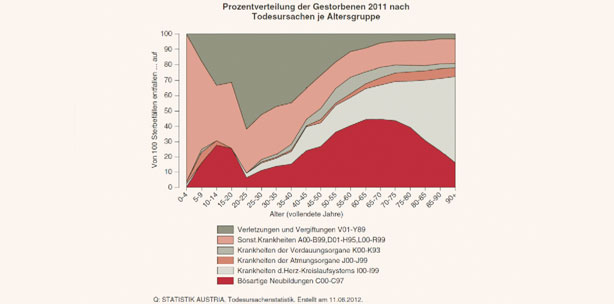
Abb. 2: Prozentverteilung Todesursachen Österreich (Vollansicht)
Die Beziehungen zwischen vielen sog.
systemischen Erkrankungen und Erkrankungen des
Zahnhalteapparates werden in den letzten Jahren immer besser
untersucht. Dabei stützt sich die Theorie, dass beide Krankheitskomplexe miteinander korrelieren können, auf eine stetig breitere
Zustimmung in der rezenten Literatur und wurde durch Metaanalysen
durchaus bestätigt.8,9
Entzündung als bindendes Glied
Atherosklerotische Veränderungen,
welche das Herz und die Blutgefäße betreffen, sind ursächlich
für ischämische Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen und periphere vaskuläre Erkrankungen. Begünstigend für die
Entwicklung von atherogener Plaque in den Gefäßen sind neben den
durch Cholesterin induzierten Mechanismen auch inflammatorische
Prozesse. Es kann jedoch nicht von einem
einfachen, konsequenten Zusammenhang zwischen der Entzündung des
Parodonts und des Vorhandenseins von vaskulären Veränderungen
ausgegangen werden; die Vorgänge, wie sich diese beiden
multifaktoriellen Volkskrankheiten beeinflussen, sind durchaus
komplex.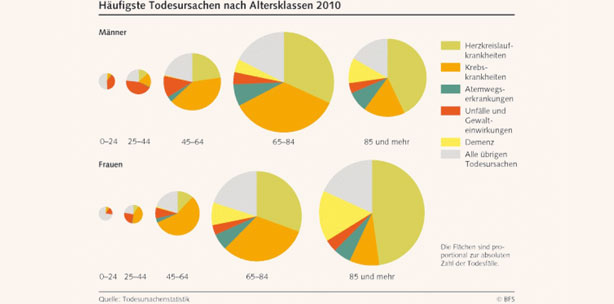
Abb. 3: Todesursachen Schweiz. Quelle: Statistik Austria, www.statistik.gv.at, Stand: 14. Mai 2013 (Vollansicht)
Atherogenesis durch Entzündung
Endotheliale Dysfunktion ist eine der
ersten Anzeichen für eine atherosklerotische Veränderung.
Endothelzellen reagieren auf entzündliche Stimuli mit der Ausbildung von bestimmten Adhäsinen (ICAM-1, VCAM-1 etc.), welche die
Anlagerung von Leukozyten an die Zellwand ermöglichen.10 Das
Eindringen von Leukozyten in die Gefäßintima wird begünstigt durch
das Vorhandensein von Matrixmetalloproteinasen (MMP-9). Durch die Ausbildung und das
Vorhandensein von Makrophagen, welches durch Makrophagen
stimulierende Faktoren (M-CSF) induziert wird, kommt es zur Ausschüttung einer Reihe von proinflammatorischer Zytokine (IL-1
beta, TNF-alpha), die das lokale entzündliche Geschehen verstärken.
Lipide, welche in das Zytoplasma der Makrophagen aufgenommen werden,
führen zur Ausbildung sogenannter Schaumzellen. Nach dem Absterben
der „foam cells“ verbleiben Lipide in der Gefäßintima und
können dort akkumulieren.11 Diese Prozesse sind begünstigend für
die Ausbildung atherosklerotischer Veränderungen und ungünstig
für die Endothelfunktion.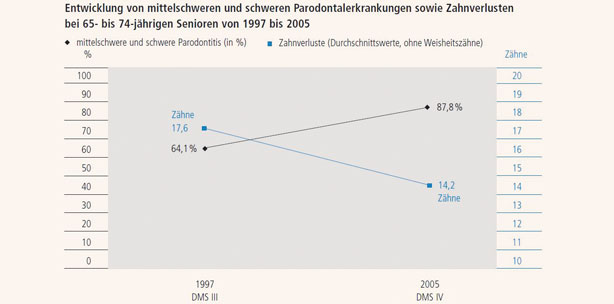
Abb. 4: Entwicklung von mittelschweren und schweren Parodontalerkrankungen sowie Zahnverlusten bei 65- bis 74-jährigen Senioren von 1997 bis 2005. Quelle: BZÄK (Vollansicht)
Interaktion zwischen
parodontopathogenen Keimen und Endothelzellen
Die parodontale Tasche bietet vor allem
anaeroben Keimen einen Ort, wo sie geschützt vor körpereigenen
Abwehrmechanismen und mechanischen bzw. antibakteriellen Reizen
proliferieren und interagieren können. Jedoch kommt es vor allem
durch Mastikation und mechanischer Irritation (Zähneputzen,
Mundhygiene) immer wieder zur Aussaat parodontaler Keime in den
Körper. Ein möglicher Translokationsmechanismus in den
Gefäßkreislauf über die Lymphbahnen wird diskutiert.12
Der Nachweis von Parodontitisleitkeimen in atherogener Plaque wurde mehrfach in der Literatur
bestätigt. Pathogene Keime infiltrieren humanes Gewebe, um sich
der Immunabwehr zu entziehen, und Gewebe-Invasion ist ein häufiger
Virulenzfaktor vieler krankheitserregender Keime.
Besonders gut untersucht hinsichtlich
seiner Interaktion mit Endothelzellen ist der parodontopathogene
Erreger Porphyromonas gingivalis. Infektion mit P. gingivalis führt
zu einer Reihe von bereits oben genannter Entzündungsprozesse, wie
etwa Monozyten-/Makrophagenmigration und Ausbildung
proinflammatorischer Zytokine,13 welche die Endothelfunktion empfindlich stören können.
Einfluß von Parodontaltherapie auf
kardiovaskuläre Erkrankungen
In einem erst kürzlich von der
American Heart Association (AHA) publizierten Statement wurde
festgestellt, dass anhand der Studien der letzten 30 Jahre bis heute
kein kausaler Zusammenhang zwischen Parodontitis und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beweisbar ist.14 Jedoch erhärtet sich
immer mehr der Verdacht, dass entzündliche Prozesse eine Schlüsselrolle spielen bei der Entstehung von atherosklerotischen Veränderungen. Parodontitis, eine (meist) chronisch verlaufende, bakterieninduzierte entzündliche Erkrankung, hat sehr viele gemeinsame
Risikofaktoren mit kardiovaskulären Erkrankungen. Die prominentesten und am besten untersuchten sind klassische Risikofaktoren wie
Rauchen, Alter, Diabetes, Bluthochdruck, Geschlecht, sozioökonomischer Status und Übergewicht.
Oben genanntes Statement der AHA
kritisiert aber nicht den Effekt der Parodontaltherapie auf die
Gefäßerkrankungen; sie fordern vielmehr neue, gut durchgeführte
und geplante Studien, welche den Einfluß der Parodontalbehandlung
auf die Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems besser verständlich
machen könnten. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass die
Parodontalbehandlung erkrankter Patienten einen positiven Einfluß
auf die Gefäßfunktion und eine signifikante Abnahme von
C-reaktiven Proteinkonzentrationen im Blutserum hat.15 Interessant ist die Tatsache, dass
unmittelbar nach der Parodontaltherapie eine akute, kurz andauernde
entzündliche Reaktion im Körper ausgelöst wird.16 Jedoch bringt
die verringerte entzündliche Belastung im Mund zumindest mittelfristig eine Verbesserung der endothelialen Funktion.
Parodontalbehandlung und Verringerung
der Gefäßentzündung bei Patienten mit peripheren arteriellen
Verschlußkrankheiten (PAVK) – eine Grazer Studie
Bis heute gibt es jedoch lediglich
eine einzige multizentrische randomisierte Pilotstudie, welche die
Durchführbarkeit einer größer angelegten Studie zum Einfluß von
Parodontaltherapie auf vaskuläre Ereignisse untersucht hat.17 Die
Autoren kommen zur Schlußfolgerung, dass, wenn angemessene
Rekrutierungsmaßnahmen angewendet werden, die Durchführung solch
einer Studie durchaus Sinn macht. So kam es dazu, dass angeführt von der
klinischen Abteilung für Angiologie, unter der Mitwirkung der
klinischen Abteilungen für Zahnersatzkunde, Nuklearmedizin und
medizinisch-chemischer Labordiagnostik der Medizinischen
Universität Graz, ein Projekt gestartet hat, welches den Einfluss
parodontaler Therapie auf die Entzündungen in Gefässen bei
Patienten mit einer PAVK untersucht.
Die Rekrutierung der Patienten wird
seitens der klinischen Abteilung für Angiologie sichergestellt.
Es werden nach sorgfältiger Überprüfung der Einschlußkriterien
90 Patienten in drei Therapiearmen eingeschlossen. Umfassende
internistische Voruntersuchungen sind Voraussetzung für eine Vorstellung an der Grazer Zahnklinik, wo in einem Screeningverfahren
wiederum zahnmedizinisch anamnestisch die Einschlußkriterien für
die Zulassung zur jeweiligen Therapiegruppe geprüft werden. Wenn alle Kriterien geprüft und
erfüllt sind, wird der/die Patient/-in, nach umfangreicher
Aufklärung und Einweisung in das Studienprocedere, einer jeweiligen Therapiegruppe mittels PC-gestützter Randomisierung
zugeteilt. Ein detaillierter Parodontalstatus
aller Patienten der Therapiegruppen wird von einer einzigen,
kalibrierten, geblindeten Fachkraft erhoben. Es werden unter Zuhilfenahme von elektronisch unterstützten druckkalibrierter Sonden
folgende Parameter an sechs Stellen des Zahnes erhoben:
- Vorhandensein/Fehlen von Plaque
- Vorhandensein/Fehlen von Blutung auf Sondierung
- Vorhandensein/Fehlen von Suppuration
- Sondierungstiefe
- gingivale Rezessionen und
- klinischer Attachmentverlust.
Die Parodontaltherapie wird von einem
einzigen, ebenfalls geblindeten Behandler durchgeführt. Es erfolgt
eine nicht chirurgische Standardtherapie mit supragingivalem Scaling
und Polieren und eingehenden Mundhygiene-Instruktionen. In einer
oder zwei weiteren Sitzungen wird eine one stage full mouth disinfection (OSFMD) nach genauem Protokoll18,19 durchgeführt, und der
Patient bzw. die Patientin wird angehalten, für zwei Monate nach
der letzten Behandlungssitzung zweimal täglich mit 0,2 %
Chlorhexidin- Lösung zu spülen.
Jeder Patient der Therapiegruppe wird
unmittelbar vor der ersten und nach der letzten
Parodontaltherapiesitzung einer Ganzkörper-Fluorodeoxyglucose
Positron-Emissions-Tomografie und Computertomografie (FDG-PET/CT)
unterzogen. Diese Technologie erlaubt die gleichzeitige Beurteilung
metabolischer (FDG-PET) und morphologischer Begebenheiten. Die
Anwendung von FDG-PET bzw. FDG-PET/CT zur Tumorfindung bzw. Staging
in der Zahnheilkunde ist eigentlich die Domäne des MKG-Chirurgen. Es konnte jedoch bereits gezeigt
werden, dass auch entzündetes Parodontalgewebe vermehrt
radiologisch markierte Glukose speichert und ein Zusammenhang zu
atherosklerotisch veränderten Gefässen besteht.20 So ist es sehr
elegant möglich, Entzündungen im Parodont und in peripheren
Gefäßen gleichzeitig „sichtbar“ zu machen. Ziel soll es schließlich sein, zu
zeigen, dass eine Parodontaltherapie die Aufnahme der FDG im
Parodont und in den peripheren Gefäßen vermindert. Zusätzlich
werden von allen Patienten vor bzw. nach der Therapie Proben aus der
parodontalen Tasche bzw. dem Sulkus genommen, um auch ein besseres
Verständnis der mikrobiologischen, sprich bakteriellen
Veränderungen zu bekommen.
Das probateste Mittel zur Diagnose
von Entzündungen im Parodont im klinisch-praktischen Alltag stellt
nach wie vor das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit von Blutung auf
Sondierung dar. Sicherlich ist der Nachweis der Entzündung mittels
aufwendigen radiologischen bzw. nuklearmedizinischen Technologien
nicht für die Standardtherapie geeignet. Es könnte jedoch sehr
schön zeigen, ob bzw. welchen Einfluß die Therapie der
Parodontitis auf Gefäßebene hat.
Konklusion
Kardiovaskuläre Erkrankungen und
Parodontitis sind beide mitunter die häufigsten Erkrankungen der
Welt. Sie teilen sich nicht nur eine Reihe von Risikofaktoren, es
gibt auch immer mehr Beweise dafür, dass sie sich in ihrer
Entstehung gegenseitig beeinflussen. Wenn es gelingt zu beweisen,
dass durch parodontale Behandlung eine Verbesserung der Gefäßerkrankungen zu erreichen ist, wäre das sicherlich ein guter
Therapieansatz in der Bevölkerung, die demografisch gesehen immer
älter wird und damit die Prävalenz und Inzidenz beider
Krankheiten immer weiter ansteigt.
Hier geht's zur vollständigen Literaturliste.











