Prophylaxe 18.05.2011
Der Umgang mit Alleswisser und Zappelphilipp
share
Sie kosten uns Zeit und Nerven, manche Kollegin verdreht die Augen, wenn sie den Namen im Terminbuch entdeckt – komplizierte Patienten, die den Praxisalltag immer wieder erschweren. Wie kann man ihnen entgegentreten und das Miteinander vereinfachen?
Sie sind unbelehrbar, folgen unseren Anweisungen nicht, halten ihre Termine nicht ein, diskutieren über Abläufe oder Rechnungen und kritisieren uns. Sie sind schwer zu behandeln, weil sie den Mund ständig schließen, einen starken Würgereiz haben oder mit ihren Händen eingreifen. Besondere Exemplare sind ungepflegt und wirken unsympathisch. Wie geht man am besten mit diesen „Quälgeistern“ um? Schließlich sind es Patienten. Patienten, ohne die keine noch so qualifizierte Praxis leben kann. Die Kunst besteht also darin, diese „schwierigen“ Fälle genauso zuvorkommend zu behandeln wie unsere Lieblingspatienten.
Ein Perspektivenwechsel lohnt sich
Ein hilfreicher Trick, besser mit unangenehmen Patienten umzugehen, ist ein Perspektivenwechsel. Fragen Sie sich: Was erlebe ich und was erlebt der Patient in dieser Praxis? Als Zahnmediziner und Fachpersonal bewegt man sich ganz selbstverständlich in der dentalen Welt. Gepflegtes Auftreten, blitzblanke und gut versorgte Zähne, Ordnung und Hygiene sind feste Normen. Unsere Arbeitswelt findet in immer denselben Räumen statt, viele Behandlungsabläufe sind klar strukturiert und werden ständig wiederholt. Die Teams kennen sich und arbeiten oft lange Zeit miteinander. Eine Konsequenz aus dieser Schilderung ist, dass es relativ viel Gleichartiges und recht wenig Veränderung gibt. Man arbeitet sehr lokal und nach festen Regeln. Die Erwartungshaltung an die Patienten ist häufig: halte deine Termine ein, sei pünktlich, sei mit uns und mit deinen Behandlungen zufrieden. Zahl deine Rechnungen und, vor allem, sieh gesunde Zähne als mindestens so wichtig an, wie wir das tun, denn wir wollen nur dein Bestes für dich! Unsere Patienten haben hingegen andere, vielfältige und individuelle Hintergründe.
Die Arbeits- und Berufswelt unterscheidet sich bei vielen maßgeblich von der unseren. Zähne und deren Pflege ist ein Thema von vielen im Alltag und hat somit auch ganz unterschiedliche Wertigkeiten bei unseren Patienten. Manchen Patienten ist das bewusst und sie scheuen die Blamage, wenn wir feststellen, dass nicht „richtig“ geputzt wurde. Viele Patienten erläutern dann, warum sie so lange nicht zum Zahnarzt kommen konnten, oder weshalb die Zahnpflege nicht klappt. Manch einer hat auch die Einstellung, dass wir uns nach ihm zu richten haben, denn schließlich gilt in vielen Branchen: „Wer zahlt, schafft an.“ Sich dabei noch anzuhören, was man alles „falsch“ gemacht hat, gefällt sicher nicht. Betreten Patienten unsere Praxis, erleben sie ungewohnte Gerüche, Geräusche und die medizinische Raumausstattung. Diese Eindrücke werden unterbewusst und spontan häufig negativ belegt: In einem 5-Sterne-Hotel riecht es angenehmer, sind die Geräusche gedämpft und die Räume gediegen gestaltet. Selbst die Kleidung des Hotelpersonals ähnelt öfter der Alltagswelt des Patienten als unsere Praxiskleidung. Nicht zuletzt arbeiten wir auch in der Prophylaxe ausschließlich im Intimbereich des Patienten. Überlegen Sie doch mal: Wie viele Personen lassen Sie an bzw. in Ihre Mundhöhle? Und als ob das nicht schon genug Stress für den Patienten bedeutet, beraubt man ihm auf dem Behandlungsstuhl „den Boden unter den Füßen“. Die Wahrnehmung des Patienten unterscheidet sich in vielen Bereichen. Sie erleben sich überwiegend als diejenige, die zu uns kommen „müssen“, die bestimmte Dinge tun oder lassen „sollen“. Nun können wir aus unseren Praxen keine 5-Sterne-Hotels und aus den Behandlungseinheiten keine Kuschelsofas machen, und das sollen Sie auch nicht.
Nehmen wir an dieser Stelle sachlich und nüchtern wahr: Eine unbefangene, lockere Kommunikation ist keine Selbstverständlichkeit. Berücksichtigen wir einfach, dass es so ist und versuchen wir, die Stolperfallen aktiv zu umgehen und statt der Schnittstellen die Nahtstellen zu finden. Akzeptieren wir, dass die wenigsten Patienten wirklich gerne zu uns kommen und die allermeisten froh sind, wenn sie gehen können. Das hat überhaupt nichts mit uns persönlich zu tun! Der Widerstand, den wir bei „schwierigen“ Patienten erleben, hat vornehmlich mit den Diskrepanzen unserer Welten zu tun. Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Eigenarten, Verhaltensweisen, Meinungen, Gewohnheiten usw. Im Laufe eines Lebens entwickelt er diese Eigenschaften weiter und etabliert sie, immer unter dem Aspekt: Womit komme ich am besten klar, was ist aus meiner Sicht richtig, womit habe ich den meisten Erfolg, was bringt mir die meisten Vorteile. Bei uns sympathischen Menschen erkennen wir häufig viel Übereinstimmung, ja manchmal werden solche Menschen auch zu unseren Vorbildern, denen wir nacheifern. Sind uns Menschen nicht sympathisch, erkennen wir vermehrt Unterschiede, die uns stören, die wir für falsch ansehen. Das erschwert den Kontakt und den Umgang mit diesen Menschen in der Folge. Denn der erste Eindruck löst Vorurteile aus, und wir stecken unseren Gesprächspartner in eine Schublade, die geschlossen wird. In der Regel kostet es anschließend sehr viel Kraft, gegen die „falsche“ Einstellung anzugehen oder womöglich den anderen belehren und verändern zu wollen. Und noch seltener wird es dazu kommen, dass sich der andere für uns freiwillig ändert und sich unseren Kriterien anpasst. Wichtige Alarmsignale, dass sich ein Patient durch uns bedroht und unverstanden fühlt (und wir ihn in seine Schublade gezwängt haben!) sind Aussagen wie „zu teuer“, „keine Zeit“, „gehe woanders hin“. Was bleibt ihm auch anderes übrig, als Ihnen mit seinen einzigen Machtmitteln in Ihrem Refugium zu drohen: seine Zeit, sein Geld, seine Anwesenheit. Am einfachsten für Sie ist es, den Blick auf den Patienten zu ändern. Lassen Sie ihn aus seiner Schublade heraus und versuchen Sie, seine Welt zu betrachten und zu verstehen. Gestalten Sie die Kontakte und Gespräche so angenehm wie möglich, geben Sie Ihren Patienten Raum, Zeit und Gelegenheit, anzukommen, auf Augenhöhe zu gelangen und „auch was zu sagen zu haben“.
Zunächst ist also nicht der Patient an sich schwierig, sondern Sie selber definieren für sich, dass Sie ihn als schwierig empfinden. Es gibt folglich etwas im Verhalten, in der Kommunikation, in dem Auftreten des Patienten, welches Sie als unangenehm, nervend, eigensinnig empfinden und als falsch bewerten. Versuchen Sie einmal genau herauszufinden, was Ihnen konkret am Patienten nicht gefällt. Überlegen Sie, welche Gedanken, Vorurteile und Handlungen das bei Ihnen auslöst.
Ein Beispiel
Ihnen begegnet Frau M. Sie redet und bewegt sich schnell. An der Rezeption trommelt sie gerne mit den Fingern auf die Tischplatte, auf dem Behandlungsstuhl zappelt sie mit den Händen und ihre Füße bewegen sich ständig. Diese Erlebnisse sehen und hören Sie. Womöglich löst das Vorurteile aus wie: „Was ist denn das für eine Hektikerin! Wir sind doch hier nicht auf der Flucht!“ Vielleicht denken Sie auch: „Ich habe Mühe, ihr zu folgen und sie zu verstehen.“ Vielleicht löst das nun Gefühle und Meinungen aus wie: „Noch schneller können wir nicht arbeiten; dann muss sie sich halt einmal gedulden; Ich bin doch kein D-Zug für die!“ usw.
Merken Sie, was Ihre Beobachtung, Ihre Gedanken und Gefühle bewirken? Sie sehen in Frau M. eine „schwierige“ Patientin, die Sie mit ihrer Hektik und Ungeduld nervt und stresst. In der Welt des Patienten hingegen kann diese Hektik genau das richtige Verhalten, die passende Kommunikation und das perfekte Auftreten sein! Frau M. hat in ihrem Leben mit dieser Strategie womöglich Erfolg und kommt damit gut klar. Es wäre jetzt müßig, über diese Welt der Frau M. zu spekulieren und sich zu wundern. Drehen Sie doch diese Sie störenden Faktoren um: Was hat Frau M. davon, hektisch, schnell und unruhig zu sein? Was ist ihr Vorteil? Menschen wie Frau M. können sich z.B. gut auf Wesentliches konzentrieren. Sie brauchen weniger Detailinformationen, und sie können rasch Entscheidungen treffen. Sie mögen es, wenn es „zügig vorangeht“ ohne Komplikationen und Diskussionen. Wenn Sie nun versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen (zügiger Behandlungsablauf, keine langatmigen Erklärungen über Beschaffenheit von Politurbürsten, wesentliche Informationen hervorheben), dann sind Sie Teil der Welt von Frau M. Lassen Sie sich durch die „Köder“ (mit Finger trommeln, mit den Füßen zappeln) nicht ablenken. Sie müssen nicht alle Köder schlucken! Klingt kompliziert? Versuchen Sie es einfach mal!
Nehmen wir noch mal Frau M., die an der Rezeption steht und mit den Fingern auf die Tischplatte trommelt. Sie könnten die Dame jetzt ansprechen: „Frau M., ich sehe, dass Sie mit den Fingern trommeln. Ich denke, dass Sie es eilig haben?“ Oder auch: „Guten Tag, Frau M. Ich sehe, dass Sie es heute eilig haben? Kann ich etwas für Sie tun?“
Geben Sie Frau M. jetzt die Möglichkeit zu antworten und vor allem: Hören Sie sachlich und neutral zu! Sollte sich bereits eine innere Stimme bei Ihnen gemeldet haben, die flüstert: „Was ist denn das für eine Hektikerin, die hat mir heute gerade noch gefehlt!“, dann hören Sie nicht darauf. Sonst fällt es Ihnen schwer, Positives zu finden. Möglich wären jetzt viele Antworten: „Oh, tatsächlich, dass ist mir noch nie aufgefallen!“ Oder: „Ja, Sie haben recht, ich muss heute noch dringend wohin, und mein Auto ist kaputt.“ Oder auch: „Entschuldigen Sie bitte, wenn ich hier so unruhig bin. Aber beim Zahnarzt habe ich immer riesige Angst.“
Rechnen Sie mit unerwarteten und vielleicht auch unspektakulären Antworten. Sie geben Ihnen einen Einblick in die Welt des Patienten – und diesen Einblick wollten Sie doch haben! Jetzt ist auch ein idealer Zeitpunkt, ein WAB zu verteilen.
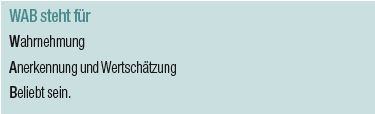
Wahrgenommen haben Sie Frau M. bereits durch Ihre Reflektion. Anerkennung und Wertschätzung könnten jetzt Ihre Antworten sein: Verständnis für den Zeitdruck oder die Angst; eine Idee, wie Sie für eine Entspannung sorgen können. Und wenn Ihnen dazu gar nichts einfällt, funktioniert immer: Zeigen Sie Frau M., dass Sie sie mögen! Jeder Mensch braucht es, geliebt zu sein. Zeigen Sie Frau M. Ihr strahlendstes Lächeln und sagen Sie zum Beispiel: „Okay, schön, dass Sie da sind, und danke für Ihre offene Antwort.“ Probieren Sie es aus: WABs öffnen Ihnen Türen bei allen Patienten! Im Folgenden finden Sie ein paar Ideen zu bestimmten Patiententypen. Achten Sie bitte darauf: Patentrezepte und Garantien für Menschen gibt es nicht! Suchen Sie sich das heraus, was Ihnen gefällt und probieren Sie Ihren persönlichen Weg aus!
Eine kleine Typenlehre
Der Besserwisser
Er redet häufig viel und detailliert. Er legt die Themen und die Regeln gerne fest, kritisiert gerne alles und jeden, hinterfragt mit Vergnügen und erläutert noch lieber seinen Standpunkt. Seine positiven Seiten: Er hat meist großes Interesse, auch am Thema Zahn. Er ist bereit, Zeit und Geld in die Beschaffung von Informationen zu investieren. Häufig zeichnet er sich auch durch ein hohes Sicherheitsbedürfnis aus. Nicht selten will er Bestätigung durch die Fachleute, dass er „richtig liegt“.
Erkundigen Sie sich nach seinen Informationsquellen. Wenn Ihnen diese Quellen gefallen, dann schenken Sie diesem Patienten Anerkennung. Fragen Sie konkret nach, ob er sich mit Ihnen über ein Thema fachkundig austauschen möchte. Trainieren Sie für solche Fälle Ihre Fachkompetenz, und halten Sie gutes Informationsmaterial bereit. Wenn dieser Patient seinen Behandlungsbedarf nicht erkennt, bleiben Sie am besten bei sachlichen Informationen, gerne auch mit Befunden, die durch den Zahnarzt aufgenommen wurden, und versuchen Sie, mit Bildern zu arbeiten (Fotos vorher/nachher, Intraoralkamera etc.)
Der Geizkragen
Ihm ist immer alles zu teuer. Er misst die Zeit bei Ihrer Prophylaxesitzung, diskutiert bei Preissteigerungen, droht mit Wechsel oder holt sich viele Angebote ein, gerne auch am Telefon. Er liebt es, mit Ihnen zu handeln und zu feilschen. „Über den Tisch gezogen zu werden“ ist für ihn eine schlimme Erfahrung. Seine positiven Seiten: Investiert Zeit und Aufwand in Vergleiche. Bestimmte Dinge sind ihm wichtig, in der Regel ist das nicht nur das Geld. Er achtet darauf, sein Geld für Dinge auszugeben, die ihm wirklich etwas nutzen. Finden Sie heraus. was er an Ihnen und Ihrer Praxis schätzt. Dieser Patient freut sich, wenn er ein „Schnäppchen“ gemacht hat. Handeln Sie mit ihm und bieten Sie ihm Angebote an! Sonderaktionen, Jubiläumsnachlässe, PZR-Bonusrabatte, Preis des Vertrauens-Tag und vieles mehr sind dabei möglich. Führen Sie sachlich auf, welchen Behandlungsbedarf er hat und bieten Sie mindestens zwei Lösungen (Standard und hochwertig) mit seinen Vorteilen an. Wichtig ist es auch, die Entscheidung des Patienten zu akzeptieren und seine Wahl nicht abzulehnen! Rechnen Sie ihm die Vorteile auf einem Blatt oder Flyer vor, damit er etwas für sich zu Hause hat. Finden Sie heraus, ob er an der Quantität oder an der Qualität sparen möchte.
Der Desinteressierte, auch Null-Bock-Teenie
Oftmals redet er wenig, will schnell wieder gehen, womöglich nur einmal im Jahr kommen. Ihm ist alles egal, er hat keine Fragen. Seine wesentlichen Interessen liegen auf anderen Gebieten. Es kann auch sein, dass er in der Vergangenheit viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und er sich von Ihrer Behandlung nichts verspricht. Seine positiven Seiten: Das Thema Zähne erscheint ihm oft als lästiger Alltagskram. Häufig ist ihm Zeit sehr wichtig. Dass er überhaupt zu Ihnen kommt zeigt aber, dass er durch Sie seinen „Pflichten“ nachkommen möchte. Er traut Ihnen also zu, dass Sie ihn richtig behandeln. Bedienen Sie ihn mit kompakten Behandlungsangeboten, damit er sich wieder seinen eigenen Interessen zuwenden kann. Stellen Sie sicher, dass er damit zufrieden ist. Versuchen Sie nicht, ihn mit Belehrungen zu einem Interesse zu bewegen. Akzeptieren Sie, dass dieser Patient nur ein Minimalinteresse hat. Das kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern!
Der Nörgler und Polterer
Dieser Patient kritisiert gerne alles und jeden, der ihm in der Praxis über den Weg läuft. Nichts ist ihm recht. Dabei kann er auch laut und ungehalten werden. Seine positiven Seiten: Er nimmt sein Umfeld oft sehr genau wahr. Feste Regeln und Werte sind ihm wichtig. Oft möchte er einfach Beachtung und Anerkennung. Vermeiden Sie insbesondere bei diesem Patienten ein „aber“ als Rechtfertigung. Bleiben Sie konstant höflich und freundlich. Ersetzen Sie Ihr „aber“ durch ein „und“ in Fällen, in denen Sie seine Anliegen nicht erfüllen können. Wenn Sie jedoch der gleichen Meinung wie dieser Patient sind, dann sagen Sie es: „Sie haben recht, ich erlebe das genauso.“ Achten Sie auf eine gelassene, souveräne und offene Körpersprache. Abwehrhaltungen fordern diesen Patienten heraus.
Der Freund vom Chef und andere VIPs
Untergräbt oder hinterfragt gerne Ihre Fachkompetenz und Stellung. Drängelt sich an Ihnen vorbei. Er holt sich ausschließlich die Meinung seines Freundes ein.
Seine positiven Seiten: Persönliche Kontakte und Wertschätzung sind ihm wichtig. Er legt Wert auf seine soziale Stellung.
Treffen Sie konkrete Absprachen im Team: Wie möchte Ihr Chef mit diesem Patienten umgehen, was ist ihm wichtig? Können Sie Ihren Chef auch zwischendurch kontaktieren? Regeln Sie diesen Umgang im kompletten Team. Legen Sie fest, welche Sonderbehandlungen gewünscht und machbar sind, ebenso die Grenzen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Chef seine Kompetenz an Sie in der Prophylaxe weitergibt. Zeigen Sie dem Patienten, dass Sie und der Chef sich gemeinsam auf seine Behandlung vorbereitet haben. Entsprechend der Situation können Sie auch Ihre Arbeit vom Chef kontrollieren lassen, das vermittelt ebenfalls Kompetenz.
Zusammenfassung
Entscheidend ist es für Sie und den Umgang mit Ihren schwierigen Patienten, sich nicht auf die (vermeintlichen) Schwierigkeiten zu konzentrieren. Mit Widerstand, negativer Grundeinstellung, Ärger und Stress ist eine Kommunikation mit diesen Patienten extrem kraftraubend und selten erfolgreich. Versuchen Sie, die andere, positive Seite am Patienten zu erkennen und gehen Sie auf seine Bedürfnisse ein. Nach diesem Muster gelingt es Ihnen sicher besser, mit Ihren ganz persönlichen Fällen umzugehen. Tauschen Sie sich im Team darüber aus, wenn Ihnen wieder eine „Nervensäge“ begegnet ist. Gemeinsam werden Sie bestimmt ein oder zwei Dinge finden, die Ihnen den Umgang mit diesem Patienten erleichtern.










