Prophylaxe 21.02.2011
Keimquelle Wasser: Hygiene in der Praxisplanung
Praxishygiene ist unabdingbarer Bestandteil der Praxisführung, um die Sicherheit von Patienten und Praxisteam zu gewährleisten. Eine älter werdende Gesellschaft, die Komplexität unserer (Reise-)Welt, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und der darauf aufbauende technische Fortschritt fordern vom Praxisinhaber und seinen Mitarbeitern ständige Aufmerksamkeit und flexible, kurzfristige Anpassung an neue Gegebenheiten.
Der Standard für die zahnärztliche Praxisführung wurde zuletzt im April 2006 in den RKI-Richtlinien dokumentiert. Nicht erst die Tatsache der juristischen Beweislastumkehr im Klagefall sollte Anlass zur Überprüfung in jeder Praxis sein.

Überprüfung der Keime im Brauchwasser
Praxisbetreiber tun gut daran, in mindestens jährlichen Abständen ihr Brauchwasser beproben zu lassen. Dazu sei die fachgerechte Entnahme am Hauseingang, an der Etagenwasseruhr, an einem Waschbecken in der Behandlungsetage sowie an mindestens einem Wasserauslass jeder in der Praxis vorhandenen Dentaleinheit empfohlen. Die so gewonnenen Proben können von unabhängiger Seite bebrütet werden. Es ist festgeschrieben, dass an den Ausgabestellen (also z.B. dem Spraywasser aus Instrumenten der Dentaleinheit) 100 keimbildende Einheiten (KBE) pro ml die Obergrenze der tolerierbaren Keimbefrachtung markieren. Die trotz integrierter Entkeimungsanlagen recht verbreitet festzustellende Überschreitung dieses Grenzwertes lässt sich erklären: Tote Wasserstränge, die früher einmal benutzt und dann gekappt wurden oder auf Vorrat angelegte, aber nicht verwendete Wasserstränge in den Hausnetzen der Installation zahnärztlicher Praxen bergen Luftpolster oder Brackwasser und sind aus diesem Grund Brutstätten für Keime. Auch die durch Anpassungsarbeiten, Umbauten oder Modernisierungen innerhalb der Dentaleinheiten entstandenen Tot-Wasserstränge tragen ganz erheblich zu einer Verkeimung bei.
Generell kann in den zuvor beschriebenen Wassersträngen eine Keimpopulation vom Hauswasseranschluss zur letzten Ausgabestelle entstehen, die in normalen Wohnungs-Hauswassernetzen nicht vorhanden ist. Begründet ist dieser Umstand mit dem nur sehr langsamen Wasserwechsel innerhalb der Dentaleinheiten, den hohen Temperaturen, die hier herrschen, und den langen Betriebspausen der Einheiten.
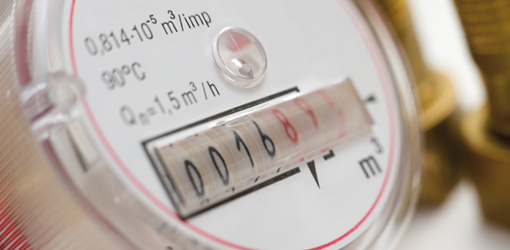
Versorgung der Einheit aus Wasserflaschen
Eine hohe Wasserhärte führt vielerorts zur Integration von Wasseraufbereitungsanlagen auf Salzbasis. Heute wissen wir, dass gerade diese Anlagen regelrechte „Keimfabriken“ sein können.
In den vorangegangenen Jahren führte häufig der Wunsch nach technisch störungsfrei zu betreibenden Dentaleinheiten zu entsprechenden Hygienemaßnahmen. Ausgehend von montags früh auftretenden „Algenwürstchen“ aus den Schläuchen der Dentaleinheiten mussten die technischen Unzulänglichkeiten abgeschafft werden. Bemerkt sei hier, dass nur eine seltene Algenart ohne Licht wächst. Es darf also durchweg von schieren Bakterienstämmen ausgegangen werden! Als Abhilfe im Markt etabliert haben sich hier sogenannte Bottle-Care-Systeme, wie sie beispielsweise von der Firma Alpro Medical angeboten werden. Dabei wird die Dentaleinheit aus Wasserflaschen versorgt und das Netzwasser ist für die schlauchgebundenen Instrumente abgeschaltet. Diesem Bottle-Care-System kann ein innerhalb der Trinkwasserverordnung liegendes Desinfektionsmittel desselben Herstellers zugegeben werden. Von eben diesem Hersteller steht auch ein System zur Intensiventkeimung, das sogenannte Weekend-System, zur Verfügung. Hierbei wird bei Betriebsende am Freitag das System mit konzentrierter Chemie beflutet. Es steht und wirkt über das Wochenende. Am Montag wird die Intensiv-Chemie bei Inbetriebnahme der Einheit entsprechend ausgespült.
UV-Bestrahlung
Eine andere Möglichkeit ist es, an einem zentralen Wasserstamm der Praxis eine UV-Intensivbestrahlung anzubringen. Wegen der vergleichsweise geringen Wasserverbrauchsmenge und der langen Standzeiten hat sich dieses Verfahren in zahnärztlichen Praxen bisher allerdings kaum durchsetzen können.
Mechanische Wasserfilter
Als einfache, aber nur teilweise wirksame, Lösung hat sich das Einbringen von mechanischen Wasserfeinfiltern in den Wasserzufluss zahnärztlicher Praxen bewährt. Wird einem 100 Mikron Vorfilter ein 500 Mikron Nachfilter gesetzt, werden Schwebeteile im Wasser und bestimmte Keime gleichsam „angehalten“. Diese Filter bedürfen aber der regelmäßigen Pflege und des Austausches. Auch zum Schutz der technischen Funktion von Dentaleinheiten haben Hersteller (z.B. Morita) solche Filtersysteme bereits werkseitig integriert.
Beimpfung
Die wohl verbreitetste Maßnahme zum Schutz vor Keimbildung in Dentaleinheiten wird seit mittlerweile rund zwei Jahrzehnten von führenden Dentalherstellern (z.B. KaVo, Morita, Sirona, Ultradent) in Form der „Beimpfung“ installiert. Dabei wird das Flüssigkonzentrat in den integrierten Behälter gefüllt und dem durchströmenden Brauchwasser „zugeimpft“. Im Ergebnis wird bei normalen und günstigen Voraussetzungen die Keimneubildung bzw. Keimreduzierung im brauchbaren Maße erreicht. Im Regelfall werden hier die 100 KBE pro ml (deutlich) unterschritten.

Kontamination durch Rücksaugeffekt
Ein anderes Problem stellt die retrograde Keimbewanderung dar. Gemeint ist die Kontamination, die Dentaleinheiten am patientenseitigen Ende der schlauchgebundenen Instrumente erfahren. Besonderen Nährboden finden sie in den meist oft rauen Innenflächen der wasserführenden Wege. Hier ist die Wachstumsumgebung z.B. für die lungengängigen Keime (Legionärskrankheit) ideal! Diese Biofilme sind gewöhnlich latent vorhanden und mit den gängigen Beimpfungsmaßnahmen nur schwer zu erreichen. Die zuvor erwähnte Weekend-Intensiventkeimung – in Abständen angewandt – kann eine Lösung darstellen.
Als Beispiel für die technischen Zusammenhänge zum Zustandekommen der retrograden Verkeimung können die Bedingungen des Rücksaugeffektes aus Übertragungsinstrumenten (Hand- und Winkelstücke/Turbinen) gelten. Eine wissenschaftliche Untersuchung der TU Dresden beschreibt die volle Wirksamkeit der manuellen, händischen Wiederaufbereitung solcher Übertragungsinstrumente. Das Gutachten ist abrufbar unter: www.jmoritaeurope.com
Chlor gegen Biofilm
Sehr bewährt hat sich in diesem Zusammenhang in jüngerer Zeit (seit etwa 2002) die anodische Oxidation. In diesem Verfahren wird in einer sogenannten Reaktoreinheit mithilfe von etwas elektrischer Energie (Annode/Kathode) aus dem Natrium des normalen Hauswassers ein Chloranteil erzeugt. Dieser Chloranteil ist innerhalb der Lebensmittelnorm, geschmacks-, sicht- und geruchsneutral. Wissenschaftlich und durch Bebrütungs-test vor und nach Integration in zahnärztlichen Praxen bewiesen, werden auch hier – selbst bei nachträglicher Integration – vorhandene Biofilme ausgewaschen, inaktiviert und deren Neubildung dauerhaft verhindert.
Für die Versorgung der Anschlusskästen der Dentaleinheiten wird zur Integration dieser anodischen Oxidation eine Ringwasserleitung gelegt. Da dieser so erzeugte Chlorgehalt sich nach vier bis fünf Stunden wieder neutralisiert, verfällt die Wirkung. Um dem entgegenzuwirken, hat der Hersteller mittels in der Praxis vorhandenen Druckluft eine sich automatisch zuschaltende Pumpe eingebaut. Für etwa zehn Minuten wird pro Stunde einmal das Wasser aus dem Vorratsbehälter umgewälzt und so refreshed. Im Sinne der Umwelt hat das Verfahren den Vorteil, dass sich das Chlor selbst wieder abbaut und so keine Umweltbelastung durch Restchemikalien entsteht. Für den Geldbeutel ist es von Vorteil, dass keine Kosten für Chemikalien entstehen. Die Amortisation der Technik ist bezogen auf drei angeschlossene Behandlungsplätze, gegenüber den gängigen Beimpfungsverfahren, nach rund zweieinhalb Jahren bereits gegeben (www.dwt-gmbh.com).
Dieses Verfahren hat zudem den Vorteil, dass Schwebeteile im Wasser für eine gewisse Zeit nicht anlagerungsfähig sind. Das schützt die Lumen und Ventile vor technischen Defekten. Darüber hinaus ist die freie Fallstrecke (EN 1717) für die Gesamtheit der angeschlossenen zahnärztlichen Behandlungsplätze bereits integriert. Das mag eine Lösung für Betreiber von Dentaleinheiten aus Baujahren vor 2003 sein.
Allen, die eine Lösung im Bereich der zentralen freien Fallstrecke in Verbindung mit einer nicht verkeimenden Wasserenthärtungsanlage suchen, sei ein Blick zur Firma Grünbeck (www.gruenbeck.de) empfohlen.
Allen Auftraggebern unter den Praxisbetreibern sei im Zusammenhang mit ihrem Sanitärinstallateur die umfangreiche Information durch die Firma Viega – Wassertechnik im westfälischen Attendorn – (www.viega.de) empfohlen.
Verkeimungsquellen
Eine weitere Verkeimungsquelle stellen – im Bezug auf die retrograde Verkeimung – die Ansätze der Mehrfunktionsspritzen dar. Sofort nach der Sitzung abgezogen und dem Hygieneprozess zugeführt ist diese Verkeimungsquelle beherrschbar. So ist zum Beispiel in England seit dem 1. Januar 2010 ausschließlich die Verwendung von Einmalkanülenansätzen für diese Mehrfunktionsspritzen vorgeschrieben und wird vonseiten der Behörden kontrolliert. Solche Einmalansätze für Mehrfunktionsspritzen sind auch hierzulande verfügbar (Acteon, Loser & CO)!
Ein Hinweis am Rande: Reist der beauftragte Sanitärinstallateur mit am Anfang und Ende unverschlossenen Wasserrohren zur Baustelle an, dürfen Sie ihn getrost und ganz kompetent wieder nach Hause schicken. Die unterwegs im Rohr eingesammelten Schmeißfliegen hinterlassen Keime, die Sie mit allen vorgeschriebenen Mitteln nie wieder aus dem Leitungssystem herausbringen!
Ausblick
Der Arbeitskreis Dentalinstrumente (AKDI) bei der Bundeszahnärztekammer in Berlin hat in seiner Veröffentlichung vom Dezember 2009 zur Aufbereitung von zahnärztlichen Übertragungsinstrumenten (Hand- und Winkelstücke/Turbinen) Stellung bezogen. Die Firma J.Morita Europe hat in einer wissenschaftlichen Studie des Hygieneinstitutes der Universität Dresden die Gleichwertigkeit der Wirksamkeit der manuellen wie der maschinellen Wiederaufbereitung attestiert bekommen. Abrufbar als Zusammenfassung unter www.JMoritaEurope.com oder komplett per E-Mail anzufordern unter Info@JMoritaEurope.com oder telefonisch unter 0 60 74/8 36-0.
Auch existiert seit Anfang dieses Jahres innerhalb der DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaus-Hygiene) die Arbeitsgruppe „Hygiene in der Zahnmedizin“. Derzeit beschäftigt sie sich mit den Bedingungen zur Erlangung hygienisch einwandfreien Wassers aus Dentaleinheiten. In beiden Arbeitsgruppen AKDI und DGKH sind sowohl Wissenschaftler aus der Hygiene, mit Hygiene besonders befasste Zahnärzte aus der praktischen Berufsausübung sowie Vertreter aus der Dentalindustrie vertreten. Vorbereitend auf einzurichtende Europanormen (EN) holt derzeit auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn (BfArM) detaillierte Informationen zur Ausgangssituation ein.
Empfehlungen zur Wasserhygiene in Dentaleinheiten
Allen am Thema Beteiligten ist klar, dass die Durchführung der Hygienemaßnahmen in der zahnärztlichen Praxis in etwa die Relevanz von 5,00 Euro Mehrkosten pro Sitzung im Vergleich zu den Basis-Hygienemaßnahmen von vor 25 Jahren hat. Wohl gemerkt: Das sind lediglich die Mehrkosten im Vergleich zu den Basishygienemaßnahmen. Standespolitisch ist das sicher ein gutes Argument, um hier einen Ausgleich von den Kostenträgern einzufordern.
Situationsbestimmend kann jeder Praxisinhaber einen Wasserhygienetest in der oben beschriebenen Weise anführen. Das ist kostenmäßig beherrschbar und gibt Sicherheit und ggf. Anlass für die Erforschung der Verkeimungsquelle in der einzelnen Praxis, sowohl in der laufenden Praxis als auch gerade bei Praxisneuplanungen, -modernisierungen und -umbauten, ist der Dentalfachhändler mit kompetenter Praxisinstallationsplanung der geeignete Partner. Ausgestattet mit Routine und Fachwissen ist er es, der den Partnern aus Architektur und Installationstechnik Maßnahmen ins Pflichtenheft schreiben kann. Maßnahmen, die Sie in der Praxisführung letztlich auch in juristisch-forensischer Sicherheit stärken. Denn – es gilt Beweislastumkehr! Wie bei nahezu jeder Tätigkeit am Patienten gilt: Durchführungsplan erarbeiten, niederschreiben, die Mitarbeiter für diese Inhalte schulen, dieses Wissen in regelmäßigen Abständen überprüfen und gerade die dabei festgestellten Abweichungen (Unzulänglichkeiten) dokumentieren und so ggf. den Ablaufplan reformieren.
Autor: Horst Willeweit








