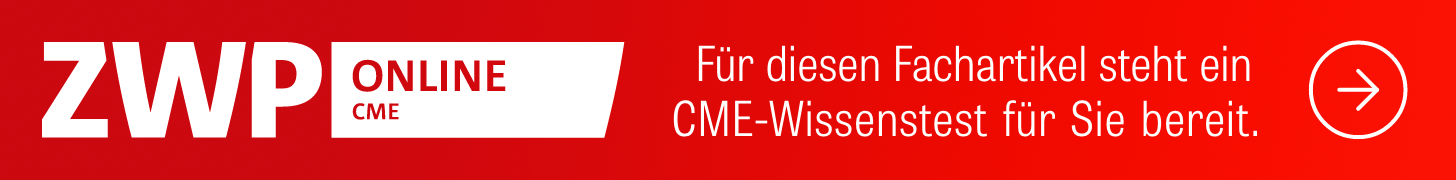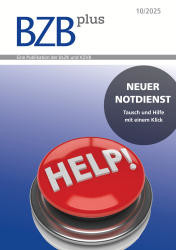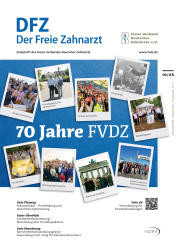Prophylaxe 21.08.2023
Häusliche Interdentalraumreinigung im Rahmen der MHU
share
Die Instruktion und Motivierung der häuslichen Mundhygiene im Rahmen einer parodontalen Therapie stellten zweifelsohne Herausforderungen dar, denn die Instruktionen sollten individuell angepasst erfolgen. Schließlich weist jeder Patient unterschiedliche anatomische und krankheitsbedingte Voraussetzungen sowie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivation auf. Anhand aktueller wissenschaftlicher Studienergebnisse und konsentierter Empfehlungen verschiedener Leitlinien zum Thema Mundhygiene bei Gingivitis und Parodontitis (AWMF-Registernummern: 083-022 und 083-043) soll dieser Artikel zeigen, welche wissenschaftlich fundierten und gleichzeitig individuell adaptierten Instruktionen in der Praxis gegeben werden sollten, um Missverständnissen im Zahnarzt-Patienten-Verhältnis zuvorzukommen und gleichzeitig das dauerhafte Interesse der Patienten an der Verbesserung der eigenen Mundhygiene zu steigern.
Durch häusliche Mundhygiene unter Alltagsbedingungen ist die mechanische Entfernung aller mikrobiellen Biofilme nur eingeschränkt möglich. Auch wenn orale Biofilme immer noch als der wichtigste Faktor für das Auftreten und den Verlauf von Zahnfleischerkrankungen angesehen werden, so führte ein besseres Verständnis der Biofilmökologie1 in den letzten Jahren zu einem Umdenken hinsichtlich der Empfehlungen zur mechanischen Biofilmkontrolle zu Hause. Denn selbst bei gut motivierten und geschickten Anwendern scheint eine vollständige Entfernung des oralen Biofilms aufgrund diverser morphologischer Gegebenheiten wie z. B. Zahnengstände oder Wurzeleinziehungen2 sowie durch Limitationen der verfügbaren Hilfsmittel illusorisch. Aus klinischer Sicht ist verständlicherweise jede Reduktion des Biofilms wünschenswert – insbesondere im Interdentalraum (IDR), welcher gleichwohl als Prädilektionsstelle für Gingivitis und Parodontitis gilt, denn sie senkt die potenziell infektiöse Last und reduziert das Risiko für chronische Entzündungen des Zahnhalteapparats.3 Dies gilt nebenbei auch für dentale Implantate, um periimplantären Entzündungen vorzubeugen.4 Es gibt zwar Unterschiede in der Biofilmbesiedlung einschließlich deren Folgen aufgrund der verschiedenen Materialeigenschaften zwischen Implantat- und natürlichen Zahnoberflächen5 – abweichende Empfehlungen für Implantate lassen sich jedoch derzeitig aufgrund fehlender Evidenz nicht formulieren.
Interdentalraumreinigung – komplex oder simpel?
Alle exponierten Zahnflächen sind mit einem mikrobiellen Biofilm besiedelt. Allein mit der Zahnbürste können gerade Flächen im Interdentalraum nicht effektiv gereinigt werden.6 Es bedarf weiterer Hilfsmittel, bei deren Auswahl sich das Fachpersonal nicht von der Vielzahl der auf dem Markt verfügbarer Produkte verwirren lassen, sondern den Patienten nur zu wissenschaftlich geprüften Hilfsmitteln raten sollte.6 Es ist aber zu bedenken, dass selbst mit der ergänzenden Anwendung von Interdentalraumbürstchen – diese weisen die beste Evidenz hinsichtlich der Reinigungswirkung auf – nur eine eingeschränkte Steigerung der Effektivität im Vergleich zum alleinigen Zähneputzen von circa einem Drittel für die Gingivitis- und Biofilmparameter erwartet werden kann.6 Sie sind es auch, die als primäres häusliches Hilfsmittel für die Interdentalraumreinigung in den Leitlinien zur Prävention und Therapie von Gingivitis und Parodontitis empfohlen werden. Nur wenn aufgrund z. B. morphologischer Gegebenheiten ihre Anwendung nicht möglich ist, sollte auf andere Hilfsmittel ausgewichen werden. Neben Zahnseide wären hier auch neuartige Interdentalraumbürstchen mit flexiblem Kunststoffkern (metallfrei ohne Drahtkern, „wireless“) und elastoformen Borsten alternativ zu empfehlen, für die erste vielversprechende Reinigungsergebnisse und eine höhere Akzeptanz im Vergleich zu allen bisherigen Hilfsmitteln in der Zwischenraumhygiene vorliegen.7 Deren klinische Wirkung bei der Behandlung von Gingivitis und Parodontitis wird zwar noch umfangreich untersucht, kann aber zumindest bei Gingivitis als ausreichend betrachtet werden.8 Egal welches Hilfsmittel schlussendlich empfohlen wird, es ist immer auf eine regelmäßige und vor allem richtige Anwendung (Abb. 1) zu achten. Insbesondere bei ersten Zeichen von Traumatisierungen muss frühzeitig reagiert werden. Da dies eine intraorale Kontrolle voraussetzt, idealerweise verbunden mit einem Anfärben der Plaque und dem Aufzeigen der Putzsystematik (beispielhaft in Abb. 2), kann die patientenindividuelle Auswahl der Hilfsmittel nur in der zahnärztlichen Praxis erfolgen.
Mundhygieneunterweisung – Effektivitätder häuslichen Maßnahmen steigern helfen
Eine Optimierung mittels effizienter Motivierung und Instruktion der Anwender ist schwierig, stellt aber neben vielem anderen, wie der Ernährungslenkung, eine der zentralen Säulen der Prävention und Therapie der Parodontitis dar. Für eine optimale Aufklärung müssen Wirksamkeit und Anwendbarkeit der vielzählig verfügbaren Hilfsmittel, vor allem aber auch persönliche Neigungen der Anwender, berücksichtigt werden, was selbst unter Experten zu Kontroversen führt.9 Hier können Leitlinien helfen, wissenschaftlich gestützte Empfehlungen für eine individuell zugeschnittene häusliche Prävention zu geben. Beispielsweise sollte beachtet werden, dass gerade bei schmalen/engen Interdentalräumen Patienten, die den Umgang mit Interdentalraumbürstchen nicht gewohnt sind, häufig Bürsten mit flexiblem Kunststoffkern präferieren. Auch wenn Zahnseide bei der Behandlung einer Parodontitis nicht das primäre Mittel der häuslichen Interdentalraumreinigung ist, so stellen doch gerade enge Interdentalräume, in denen die Interdentalraumbürstchen nicht anzuwenden sind, eine Empfehlung für Zahnseide dar. Stellt sich heraus, dass trotz mehrfacher Instruktion der Patient mit einem Hilfsmittel nicht zurechtkommt, so sollte überlegt werden, ob ein alternatives Hilfsmittel gewählt wird, das entsprechend der wissenschaftlichen Evidenz nicht die erste Wahl ist, für den individuellen Patienten aber möglicherweise eine bessere Alternative darstellt. Hier können auch Mundduschen und Zahnhölzer infrage kommen.
Anhand der zuvor geschilderten intraoralen Situation ist zu erkennen, wie komplex die Auswahl der Hilfsmittel im täglichen Praxisalltag sein kann. Hier kann nur eine umfassende Befundaufnahme helfen, die Motivierung und Instruktion der Interdentalraumhygiene an die pathologisch veränderte Situation bei parodontalem Attachmentverlust korrekt anzupassen, was geschultes zahnmedizinisches Fachpersonal voraussetzt. Dennoch ist es wichtig, Patienten nicht mit zu vielen Informationen und Anweisungen zu überfordern und schrittweise zu einer besseren Mundhygiene zu verhelfen. Deshalb ist die Mundhygieneunterweisung sicherlich nicht nur an eine Sitzung gebunden, sondern sollte immer wieder in folgenden Behandlungsschritten, ggf. an sich verändernde anatomische Verhältnisse, erneut adaptiert werden.
Eigene vs. Patientenpräferenz
Eine Instruktion und Motivierung der Interdentalraumhygiene muss die patientenindividuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivation des Einzelnen beachten (Patientenpräferenz). Entsprechend des Vorgehens im Sinne der evidenzbasierten Medizin sollten neben (1.) der Patientenpräferenz, (2.) der Kenntnis, welche Hilfsmittel bei bestmöglicher Reinigungseffektivität am schonendsten mit Hart- und Weichgeweben umgehen (externe Evidenz), auch (3.) die Erfahrung des Behandlers, wie die ausgewählten Hilfsmittel richtig instruiert und Patienten motiviert (interne Evidenz) werden, helfen, die Patientenadhärenz langfristig zu sichern10 (Abb. 3). Liegen Reinigungsdefizite vor, so sollte zwar insbesondere auf schwer zugängliche Bereiche bei der Instruktion besonderer Wert gelegt werden, aber auch eine systematische Reinigung aller Flächen muss trainiert werden. Bitte beachten Sie, für das Erreichen einer optimalen Interdentalraumreinigung sind neben den Eigenschaften der Hilfsmittel in jedem Einzelfall die Präferenzen des Anwenders relevant, und die können sich von den Ihrigen deutlich unterscheiden.11 Im Einzelfall kann zwar die eigene Erfahrung helfen, richtig zu instruieren und motivieren, dennoch, die Auswahl der nötigen Hilfsmittel sollte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Gerade Risikofaktoren wie eine erhöhte Kariesaktivität und jegliche Einschränkungen sowie weitere Besonderheiten (z. B. bei Immunsuppression) müssen stets in die Überlegungen zur Auswahl miteinfließen. Sofern nicht evidenzbasierte Gründe für ein bestimmtes Hilfsmittel vorliegen (z. B. Interdentalraumbürstchen bei approximalen Wurzelkonkavitäten5 oder sehr enge Interdentalräume), ist eher das Hilfsmittel zu wählen, mit welchem die Patienten zu Hause am besten zurechtkommen. Deshalb kann keine allgemeingültige Empfehlung für DIE optimale Form der Mundhygieneanleitung oder DAS beste Hilfsmittel gegeben werden. Die Motivierung und Instruktion bei parodontalen Erkrankungen im Rahmen der Sekundärprävention ist immer individuell an die klinische Situation anzupassen.12, 13
Keine mechanische Wirkung ohne Nebenwirkung
Im Rahmen der mechanischen häuslichen Interdentalraumreinigung müssen zwei negative Folgen unterschieden werden14–17; zum einen mögliche Schäden an Zahnhartsubstanzen und umgebenden Weichgeweben und zum anderen körperliche Schäden wie eine Bakteriämie oder das Verschlucken/Aspirieren der Hilfsmittel. Traumatisierungen durch falsche Anwendung sind eher selten und in der Regel lokalisiert. Um Nebenwirkung zu vermeiden, muss unbedingt auf frühe Traumatisierungszeichen wie beispielsweise Schleimhautreizungen geachtet werden. Hierzu gehört auch, dass gerade bei der Reinigung mit Interdentalraumbürstchen diese nicht zusätzlich mit Zahnpasten beschickt oder exponierte Wurzeloberflächen nicht mit abrasiven Zahnpasten geputzt werden. Sollten Sie doch unerwünschte Nebenwirkungen feststellen, so legen Sie großen Wert auf die Bestimmung der Ursache, um im Anschluss durch ein individualisiertes Mundhygienetraining das Putzverhalten so umzustellen, dass weitere mögliche Schäden vermieden werden. Neben diesen mechanischen Folgen kann es in Abhängigkeit des Entzündungszustands des Zahnhalteapparats auch bei der häuslichen Mundhygiene zu Bakteriämien kommen. Es ist gleichwohl zu bedenken, dass eine Abstinenz der Mundhygiene gerade bei Gingivitis zu einem vielfach erhöhten Bakteriämierisiko führt,18 weshalb auf ein individuell angepasstes häusliches mechanisches, ggf. temporär chemisch unterstütztes Biofilmmanagement, nicht verzichtet werden darf.
Fazit
Die Mundhygieneunterweisung kann im Einzelfall zeitintensiv sein und bedarf in der Regel mehrerer Reinstruktionen. Jedoch ist eine effiziente mechanische Reinigung aller Zahnflächen einschließlich im Interdentalraum für die Mundgesundheit nicht nur sinnvoll, sondern derzeitig noch ohne Alternativen. Darum bedarf es in jedem Einzelfall einer plausiblen Erläuterung im Rahmen der Mundhygieneunterweisung, um Verunsicherungen der Patienten vorzubeugen. Dabei ist zu bedenken, dass der Zahnarzt das individuelle Krankheitsverständnis verbessern und die Behandlungsbereitschaft fördern will, weshalb Schuldzuweisungen und Pauschalaussagen in jedem Fall fehl am Platz sind. Wenn Folgendes beachtet wird,10 sollte es klappen:
- Dem Patienten wird erläutert, dass Maßnahmen der häuslichen Mundhygiene erheblich zur Reduktion der gingivalen Entzündung beitragen. Hierfür ist eine individualisierte Auswahl geeigneter Hilfsmittel unbedingte Voraussetzung.
- Im Rahmen der Mundhygieneunterweisung muss besonderes Augenmerk auf die systematische Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, wie den Interdentalräumen sowie des Gingivarandbereichs, gelegt werden.
- Eine Unterweisung hat stets individualisiert und defizitorientiert unter Einbeziehung praktischer Übungen zu erfolgen.
- Für das Erreichen einer optimalen häuslichen Mundhygiene sind neben den Eigenschaften der Hilfsmittel auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Anwenders sowie dessen Präferenzen relevant.
- Dies ist in jeder Mundhygieneunterweisung zu beachten.
Weitere Autoren: Pia Westphal, Ann Kristin Härdter, Dr. Sonja Sälzer
Dieser Artikel ist im PJ Prophylaxe Journal erschienen.
Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.
Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren.