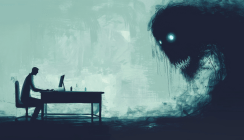Branchenmeldungen 03.09.2025
Vom Konflikt zur Lösung : Mediation im Labor
share
Was sind die Aufgaben eines Mediators?
Im klassischen Sinne unterstützen Mediatoren Konfliktparteien, einvernehmliche Lösungen zu finden. Sie gestalten ein strukturiertes Verfahren, übernehmen die Gesprächsmoderation und sorgen für eine vertrauensvolle Atmosphäre. Durch gezielte Fragetechnik und aktives Zuhören werden gemeinsam die Hintergründe des Konflikts aufgedeckt, um gegenseitiges Verständnis als Basis für eine erfolgreiche Auflösung der Situation zu erarbeiten. Mediatoren sind allparteilich – das heißt, sie stehen beiden Parteien loyal gegenüber.
Das Einsatzspektrum ist groß, denn Konflikte gibt es überall, wo Menschen zusammen sind: in Familien, Partnerschaften, am Arbeitsplatz, im Verein etc.
Warum haben Sie sich für diese Zusatzausbildung entschieden?
Schon seit meiner Jugend kamen Freunde, Bekannte oder Kollegen häufig mit ihren Problemen zu mir. Manchmal war ich ziemlich überfordert damit und entwickelte früh den Wunsch nach professionellem Hintergrundwissen. Meine Arbeit als Zahntechnikerin, als Mutter eines Sohnes und Tochter von kranken Eltern ließ mir zunächst keine Zeit für eine weitere Ausbildung. Doch 2009 war ich dann in der Situation, neue Wege zu gehen und habe mich für einen umfassenden Lehrgang zur Mediatorin für Wirtschafts- und Arbeitswelt in einer renommierten Akademie in München angemeldet.
Die Ausbildung erstreckte sich in Wochenendseminaren und intensiver Peergruppenarbeit, die schriftlich dokumentiert werden musste, über fast zwei Jahre. Drei Supervisionstage unterstützten zusätzlich, das eigene Konfliktverhalten und die Fähigkeit zur Selbstreflektion zu hinterfragen bzw. auszubauen.
Welche Kernkompetenzen sind für Ihre Tätigkeit entscheidend?
Das Wichtigste ist eine grundsätzlich offene und völlig unvoreingenommene Haltung Menschen gegenüber – zusammen mit der Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Dazu sollte der Reflex, anderen ungefragt Ratschläge zu erteilen, sehr gut kontrolliert werden können.
Was sind für Sie typische Konflikte im Labor?
Aus meiner Erfahrung entstehen die meisten Konflikte grundsätzlich aufgrund mangelhafter oder fehlender Kommunikation. Typisch hierfür sind nicht mitgeteilte Fakten über eine anzufertigende prothetische Arbeit, sodass diese dann wiederholt werden muss. Weitere Auslöser können ungeklärte Rollen bei Führungskräften sein. Verteilungskonflikte finden wir bei ungerecht empfundener Arbeitsverteilung, Zielkonflikte entstehen bei unterschiedlich gesetzten Prioritäten.
Um größere Verwerfungen zu vermeiden, ist stets ein klärendes, empathisch geführtes Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Doch wie das anzustellen ist, wissen die wenigsten, weil das grundsätzliche Wissen um Gesprächstechniken viel zu wenig gelehrt wird. So werden solche Gespräche eher vermieden und der Konflikt kann eskalieren.

Wie profitieren Sie von Ihren Kenntnissen in der täglichen Arbeit?
In meinem Amt als Referatsleitung Zahntechnik im vmf kann ich meine Kenntnisse als Mediatorin stets sehr gut umsetzen. Sei es in der Beratung unserer Mitglieder, als Autorin diverser Fachartikel, als Referentin und vor allem im grundsätzlichen Umgang mit Menschen, wenn Fingerspitzengefühl und Diplomatie gefragt sind. Auch in meiner aktiven Zeit als Zahntechnikerin waren diese Kompetenzen gerne gesehen, wenn es im Labor Schwierigkeiten mit einzelnen Kollegen oder Kunden gab.
Bitte skizzieren Sie anhand eines fiktiven Fallbeispiels den Ablauf einer Mediation im Labor.
Grundsätzlich gilt, dass eine Mediation nur dann durchgeführt werden kann, wenn alle Konfliktparteien dazu bereit sind. KonfliktbeispielAnna und Fritz arbeiten seit vier Jahren zusammen in der Keramikabteilung. Das hat immer gut geklappt, doch neuerdings nehmen Spannungen zwischen den beiden deutlich zu, sie streiten sich lautstark um Kleinigkeiten und die Qualität ihrer Arbeiten ist deutlich schlechter geworden. Beide kommen nicht mehr gerne zur Arbeit und nehmen das Angebot ihres Chefs an, sich auf ein Mediationsverfahren einzulassen. Er will beide als gute Fachkräfte behalten, aber beim Versuch, in Gesprächen selbst den Konflikt zu lösen, ist er kläglich gescheitert.
- Phase 1 – Eröffnung: Der Mediator schafft eine angenehme Umgebung, klärt Allgemeines zum Verfahren, Gesprächsregeln etc.
- Phase 2 – Themensammlung und Faktenklärung: Fritz und Anna erhalten nacheinander die Gelegenheit, ihre Sichtweise des Konflikts darzustellen. Dabei können schon mal die Fetzen fliegen. Der Mediator hört aktiv zu, moderiert das Gespräch, erinnert immer wieder an die Gesprächsregeln und fasst das Gesagte in neutraler Sprache zusammen. Nachdem der Dampf raus ist, wird das Gespräch wieder in konstruktive Bahnen gelenkt. Die einzelnen Themen werden z. B. auf einem Flipchart festgehalten. Am Ende dieser Phase werden Fritz und Anna gemeinsam entscheiden, welches Thema als erstes bearbeitet werden muss.
- Phase 3 – Interessen und Bedürfnisse: Verletzte Gefühle, Missverständnisse oder unterschiedlich gewordene Bedürfnisse und Interessen kommen in dieser Phase zum Vorschein und können für Anna und Fritz sehr erhellend sein, denn darüber haben sie zuvor nie gesprochen. Der Mediator arbeitet gemeinsam mit den beiden heraus, um was es bei dem Konflikt eigentlich genau geht. Er fragt nach den Motiven für eventuelle Forderungen und macht den Weg frei zur Lösungsfindung.
- Phase 4 – Lösungsoptionen: Diese Phase kann gut in einer eigenständigen Sitzung stattfinden. Im gemeinsamen Brainstorming sollen möglichst viele Lösungsoptionen erdacht werden. Dabei können auch vermeintlich verrückte und ungewöhnliche Vorschläge entwickelt werden, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Durch die Vielzahl der Optionen entstehen Aus- und Abwahlmöglichkeiten, wodurch die Konfliktparteien die Sicherheit gewinnen, die besten Möglichkeiten für sich zu finden. Der Mediator moderiert und notiert Lösungsmöglichkeiten z. B. auf Pinkarten. Wichtig ist hier, neben Einhaltung der Gesprächsregeln, den Ideenfluss nicht durch Killerphrasen zu bremsen, wie z. B. „Das klappt doch nie!“ oder „Das ist doch viel zu teuer!“
- Phase 5 – Einzellösungen: Nun müssen Anna und Fritz eine brauchbare und für beide akzeptable Lösung finden. Das kann so funktionieren, dass jede Idee von Anna und Fritz je einen Buchstaben bekommt, also z. B. AA, BB, CC, AC oder CD. Die mit AA bewerteten sind somit die interessantesten für beide, die mit CC oder gar CD eher nicht praktikabel.
- Phase 6 – Gesamtlösung: In der Gesamtschau bindet der Mediator die Verhandlungsergebnisse zusammen. Ergebnisse sind gut, wenn sie klar und präzise sind, die Erfüllung nachprüfbar. Vereinbarungen müssen erreichbar und realistisch sein sowie in einem festen Zeitplan umgesetzt werden. Am besten wird alles schriftlich festgehalten, um die Verbindlichkeit für beide Parteien deutlich zu machen.
Was gilt es zu beachten?
Meist geht es darum, Konflikte, deren Entstehung und die einzelnen Rollen darin zu analysieren. Oft sind starke negative Gefühle damit verbunden, die gehört und verstanden werden müssen. Dazu muss man wissen, dass Gefühle immer mit Bedürfnissen verbunden sind. Werden diese erfüllt, fühlen wir uns positiv. Werden sie nicht erfüllt, fühlen wir uns schlecht. Also ist es wichtig, in solchen Situationen herauszufinden, welcher Bedarf nicht befriedigt wurde – geht es z. B. um Ruhe, Wertschätzung oder Aufmerksamkeit, soziale Teilhabe oder Ähnliches? Allein diese Klärung hilft in den meisten Fällen schon, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Als Zahntechniker analysieren wir schließlich auch zunächst die Arbeitsunterlagen bevor wir loslegen. Das ist in der Konfliktklärung nichts anderes.
Wie kann eine Mediation langfristig wirken?
Mediationsverfahren verfolgen stets das Ziel einer gütlichen Einigung, also einer so genannten Win-win-Lösung. Wird ein Konflikt auf diese Weise geklärt, verbessert sich die zwischenmenschliche Beziehung, die Problematik wird bewusst, und die Parteien finden ihre Lösung selbst. Ungeklärte Konflikte kosten Zeit und somit richtig Geld. Dazu gibt es Studien, z. B. die KPMG-Konfliktkostenstudie, die eindrucksvoll belegt, dass 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem Unternehmen für die Konfliktbewältigung verbraucht werden.
Was passiert, wenn trotz aller Bemühungen die Mediation dennoch scheitert?
Dass keine einvernehmliche Lösung gefunden wird, passiert am ehesten dann, wenn der Konflikt schon zu weit eskaliert ist. Dennoch hilft eine Mediation auch hier, um Entscheidungen zu treffen, ob eine weitere Zusammenarbeit noch sinnvoll ist oder eine Trennung wieder Ruhe in den Betrieb bringt. Es spart auf jeden Fall Zeit, um Klarheit darüber zu schaffen, wie es weitergehen soll.
Vielen Dank für das Gespräch!


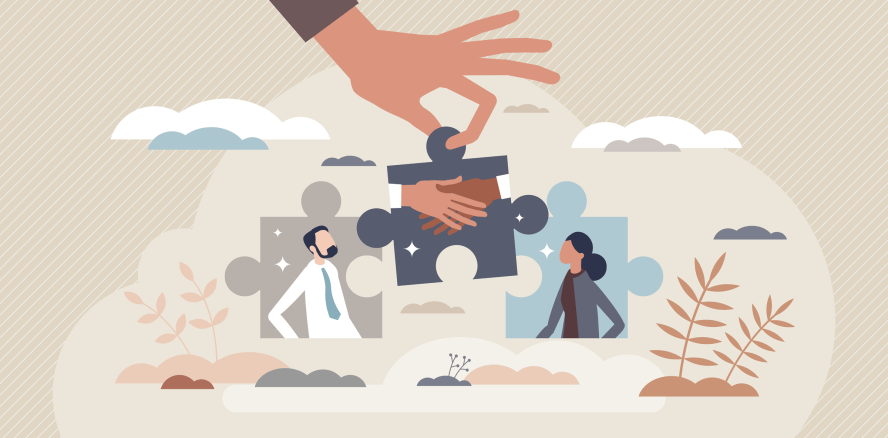

 3-Layer FLEX
3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen
3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML
DD cube X® ML  DD Incisal X
DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben
DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link
DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX
DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI
DD Bio Splint P HI  DD cube case
DD cube case  DD Shade Guide
DD Shade Guide