Businessnews 16.07.2012
Erfolg mit Kurzarbeit - Auf die Rahmenbedingungen kommt es an
In Deutschland hat Kurzarbeit dabei geholfen, während der
Wirtschaftskrise die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. In Italien
haben ganz ähnliche Instrumente weitaus weniger gut funktioniert. Eine
neue Untersuchung zeigt, woran das lag: Unter anderem sorgten eine
aktivere Konjunkturpolitik und durch Mitbestimmung geregelte
Arbeitszeitkonten in Deutschland für ein besseres Umfeld.
Nach dem wirtschaftlichen Einbruch 2009 hat sich der deutsche
Arbeitsmarkt erstaunlich schnell erholt. Ein Bestandteil des "deutschen
Jobwunders" war die Ausweitung der Kurzarbeit. Doch ohne günstige
Rahmenbedingungen hätte sie nicht so gut angeschlagen. Dies zeigt der
Vergleich mit Italien, den PhD Ulrike Stein vom Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung
zusammen mit Dr. Fabio R. Aricò von der University of East Anglia im
englischen Norwich angestellt hat.
Für beide Länder ging die globale Nachfrage 2009 ähnlich stark zurück,
skizzieren die Forscher. Deutsche wie Italiener nutzten das Instrument
der Kurzarbeit seit geraumer Zeit, um in Phasen der Rezession
Beschäftigte im Unternehmen halten zu können. Und beide Länder starteten
mit einer identischen Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent in die
Wirtschaftskrise (siehe auch die Grafik im Böckler Impuls; Link unten).
Hier hören die Gemeinsamkeiten allerdings auf: Trotz des kräftigen
Einbruchs behielten in Deutschland die meisten Arbeitnehmer ihren Job.
Seit Anfang 2010 nahm die Beschäftigung sogar wieder zu, die Wirtschaft
erholte sich. In Italien hingegen gingen sowohl die Zahl der
Erwerbstätigen als auch das Wachstum erheblich zurück. Eine nachhaltige
Erholung ist nicht in Sicht.
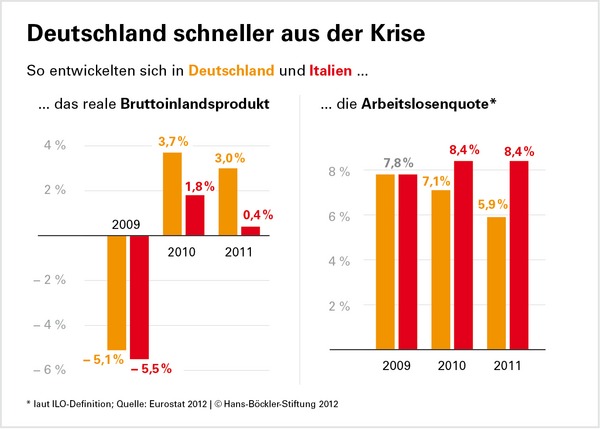
Dass Deutschland besser abschnitt, beruht nach der Analyse von Stein und
Aricò auf den günstigeren Rahmenbedingungen. Angesichts des großen
Ausmaßes der Rezession verließ sich die Bundesregierung nicht allein auf
arbeitsmarktpolitische Instrumente. In kurzer Folge legte sie mehrere
Konjunkturprogramme auf, die dabei halfen, den starken Nachfragerückgang
aufzufangen. Die italienische Regierung unterstützte die Wirtschaft
dagegen kaum; Begründung: Der Staat sei zu hoch verschuldet.
Zudem konnten Betriebe in Deutschland auf weitere Möglichkeiten interner
Flexibilität zurückgreifen, zum Beispiel auf die in der deutschen
Industrie weit verbreiteten Arbeitszeitkonten. Vor der Krise florierte
die Wirtschaft, die Konten der Beschäftigten waren gut gefüllt. Als
Aufträge fehlten, bauten sie ihre Zeitguthaben ab. Darüber hinaus
machten Arbeitnehmer weniger Überstunden und reduzierten ihre
Wochenarbeitszeit. Mehr als drei Millionen Jobs ließen sich so erhalten,
zitieren Stein und Aricò eine Studie des WSI in der
Hans-Böckler-Stiftung.
Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer trug dazu bei, solche betrieblichen
Arbeitszeitverkürzungen effektiv einzusetzen: "Die Sozialpartner hatten
diese Instrumente innerhalb eines verlässlichen Rahmens entwickelt",
erläutern die beiden Wirtschaftsforscher. Arbeitgeber konnten dadurch
gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten
an die Auftragslage anpassen. Entlassungen blieben so aus. In Italien
fehlen solche Möglichkeiten.
Die zusätzlichen Flexibilitätspuffer erleichterten es deutschen
Betrieben auch, die Kurzarbeit weniger intensiv einzusetzen. In
Deutschland waren im Mai 2009 zwar mehr als 1,5 Millionen Beschäftigte
in Kurzarbeit. Die meisten von ihnen reduzierten ihre Wochenarbeitszeit
jedoch lediglich um bis zu 25 Prozent. Nicht einmal zehn Prozent aller
Kurzarbeiter arbeiteten weniger als die Hälfte ihrer üblichen
Arbeitszeit. Im Durchschnitt belief sich die Reduzierung auf 30 Prozent.
Die italienische Regierung hingegen verließ sich fast ausschließlich auf
die verschiedenen Regelungen zur Kurzarbeit, um die Auftragseinbrüche
der Industrie abzufedern. "Diese Programme haben sicherlich dazu
beigetragen, einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern",
so Aricò und Stein. Dennoch habe die Zahl der Arbeitslosen bis ins Jahr
2010 zugenommen. Ein Grund für die Verzögerung: In Italien hat nur ein
kleiner Kreis von Beschäftigten Anspruch auf Arbeitslosengeld. "Da
italienische Beschäftigte weniger davor geschützt sind, im Falle von
Arbeitslosigkeit ohne Einkommen dazustehen, wurde die Kurzarbeit während
der Krise als Ersatz-Arbeitslosenversicherung genutzt", fassen die
Forscher zusammen. Zu Beginn der Krise wechselten viele Arbeitnehmer in
Kurzarbeit Null, waren also eigentlich arbeitslos. Gerade sie tauchten
später in den Arbeitslosenstatistiken auf, als die Wirtschaftskrise
andauerte und ihr Kurzarbeitergeld auslief.
*Fabio R. Aricò, Ulrike Stein: Was Short-Time Work a Miracle Cure During
the Great Recession? The Case of Germany and Italy, in: Comparative
Economic Studies Nr. 54, 2012
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung









