Patienten 21.02.2011
Kinderzahnheilkunde in der Allgemeinpraxis - Vorteil für alle
Die Kinderzahnheilkunde in Deutschland und ganz Europa ist nicht ausschließlich für Spezialisten oder spezialisierte Praxen reserviert, sondern für und in jeder Zahnarztpraxis von Interesse und von Vorteil für alle Involvierten. Hier möchte die Autorin die Auswirkungen der Kinderzahnheilkunde und die Besonderheiten in der Kinderbehandlung innerhalb der Allgemeinpraxis aufzeigen.
Zurzeit findet man immer mehr Veröffentlichungen zum Thema Kinderzahnheilkunde in der deutschen Fachpresse. Die Anzahl an qualitativ hochwertigen Studien im Bereich Milchzahntherapie nimmt zu. Dies mag zu einem Teil daran liegen, dass die Kinderzahnheilkunde 1994 endlich Prüfungsfach in der Approbationsordnung Deutschlands wurde, und zum anderen Teil daran, dass Fachgesellschaften wie die Europäische Akademie für Kinderzahnheilkunde mit über 600 Mitgliedern und die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde mit über 1.400 Mitgliedern Plattformen anbieten, in welchen Kollegen ihren Bedarf an hochwertiger Fortbildung in diesem Bereich kundtun und erfüllen können. Zahlreiche Preise für Jung-Forscher werden von diesen Fachgesellschaften für gelungene Arbeiten in Kinderzahnheilkunde und verwandte Bereiche vergeben. Die neu gegründete Österreichische Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde und die sehr aktive Schweizerische Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde bieten ebenso Fortbildungsmöglichkeiten für deutschsprachige Zahnärzte in allen Bereichen der Kinderzahnheilkunde.
Der Bedarf
In Deutschland sind wir noch weit davon entfernt, alle Kinder von Spezialisten zahnärztlich betreuen zu können; schon allein zahlenmäßig geht das nicht. Nach einigen Rechenbeispielen müssten es mindestens 700 bis 1.000 Kinderzahnarztpraxen geben, um die Bevölkerung flächendeckend mit Kinderzahnärzten zu versorgen. Es gibt heute schätzungsweise 50 derartige Fachpraxen, die sich überwiegend in Ballungsgebieten befinden. Das Karies-Vorkommen in Europa und speziell in Deutschland hat sich im Allgemeinen sehr zum Positiven entwickelt. Trotzdem bleibt ein nicht unerheblicher Anteil der kindlichen Bevölkerung mit hohem Krankheitsanteil bestehen. Nach neuesten Untersuchungen haben die 15-Jährigen einen DMFT-Wert von 2,44, obwohl die 12-Jährigen nur 0,98 DMFT aufweisen. Was bedeutet dies für uns in der Praxis? Sind die „Teenies“ eine vernachlässigte Gruppe? Würden Röntgenbilder bei den Untersuchungen an den 12-Jährigen andere Ergebnisse hervorbringen? Vielleicht beides? Bei den 6-bis 7-Jährigen sieht es noch schlechter aus; der Prozentsatz der kariesfreien Kinder variierte je nach Bundesland zwischen 34,9 und 59,6%. Damit haben 40 bis 65% aller 6- bis 7-Jährigen Karies oder wurden wegen Karies schon behandelt. Bei den Schulanfängern waren durchschnittlich 1,58 bis 2,91 Milchzähne kariös bzw. wegen Karies gefüllt oder sogar extrahiert. Auffällig ist jedenfalls, dass einer Gruppe von Kindern mit naturgesundem Gebiss oder mit nur geringem Kariesbefall eine fast gleichgroße Gruppe mit stark zerstörtem Gebiss gegenübersteht. Gleichzeitig muss man feststellen, dass sehr viele dieser Milchzähne unbehandelt bleiben. Dabei finden immer mehr Kollegen, dass die Vorteile der Kinderbehandlung für die gesamte Entwicklung einer Praxis die Nachteile überwiegen.
Auswirkung der Kinderzahnheilkunde
Es gibt mit Sicherheit keine bessere Strategie, um eine übernommene Praxis mit vorwiegend älteren Patientenstämmen zu verjüngen, als die Kinderzahnheilkunde in einer hohen Qualität anzubieten. Die jüngsten Mitglieder der Familie werden häufig zu „Prüfungszwecken“ vorgeschickt, um die Freundlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Praxis zu eruieren. In der Regel folgen als Patienten dann die Mütter, die Großeltern und die Väter. So ist es nicht nur für die spezialisierte Praxis von Vorteil, eine kindgerechte Behandlung anzubieten, sondern auch Allgemeinpraxen profitieren von Bereichen in der Praxis, die eindeutig positive Botschaften an Kinder schicken. Der „moderne Patient“ ist auch nicht mehr der von vor 30 Jahren. Wir haben in Deutschland jahrzehntelang die hochtechnisch-, leistungsorientierte Zahnheilkunde mit höchsten Qualitätsansprüchen genossen. Das will der Patient weiterhin zweifelsohne. Nur jetzt möchte er sich dabei auch „wohlfühlen“. Die „Spa-Zahnheilkunde“ ist angesagt. Ein Teil dieses Wohlbefindens ist mit Sicherheit der Bedarf an emotional intelligenter Betreuung in der Zahnarztpraxis. Warme Farben und warme Menschen sind gefragt. Wie kann diese Menschenfreundlichkeit in der Praxis besser nach außen vertreten werden, als mit einem gelungenen kinderzahnmedizinischen Konzept innerhalb einer Praxis? Ärzte und Zahnärzte werden immer daran gemessen, wie sie mit den Schwächsten und Hilfebedürftigsten umgehen.
Was ist zu beachten?
Bekannte Eigenschaften, die notwendig sind, um mit Kindern erfolgreich umzugehen, sind Geduld, Freundlichkeit und Konsequenz. Weiterhin nicht so bekannte Besonderheiten sind der erhöhte Dokumentationsbedarf eines wachsenden Patienten, die Notwendigkeit, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern gute Kommunikationstechniken zu pflegen, und eine Grundschnelligkeit, welche es erlaubt, die klinischen Behandlungsmaßnahmen innerhalb einer für das Kind annehmbaren Zeit zu bewältigen. In der Dokumentation ist es von Vorteil, Checklisten in der Erstberatung, bei Kontrollterminen und bei Mundhygiene-Terminen so einzubauen, dass eine Karies-Risiko-Bestimmung relativ schnell und leicht ermöglicht wird. Die folgenden Fragen geben Hinweise darauf, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Kind Karies bekommen wird:
- Haben die Eltern Probleme mit Karies, Zahnfleisch, Zahnarztangst oder viele Restaurationen im Mund? Gibt es eine/n alleinerziehende/n Mutter/Vater?
- Haben Geschwister viel Karies?
- Hat das Kind sichtbare Beläge im Mund? Wie oft putzen die Eltern, wie oft das Kind alleine?
- Gibt es Initial-Läsionen, „white spots“, girlandenförmige Schmelzverätzungen am Zahnfleischrand?
- Wie ist die Speichelbeschaffenheit (viel/wenig, dünn/dick, klebrig)?
- Wie häufig werden zuckerhaltige Nahrungsmittel eingenommen?
- Ist das Hauptgetränk zucker- und/oder säurehaltig?
- Gibt es systemische Risikofaktoren wie z.B. Muskelschwäche; manche genetische Leiden, die mit einer verminderten Abwehr oder veränderten Speichelbildung einhergehen?
- Hat das Kind eine nachteilige Zahnanatomie (tiefe Fissuren; enge, breite Kontaktstellen; Schmelzmissbildungen)?
- Indizes: dmfs, dmfs des Kindes, API, SBI, PSI
Entsprechend können (und müssen) die Hinweise zur Prävention individuell gestaltet werden. Ein Kind sollte vielleicht Zahnseide verwenden, während das andere weniger Apfelsaftschorle trinken sollte. Ebenso dokumentationspflichtig ist eine kleine kieferorthopädische Beurteilung, um etwaige Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Dabei ist auf das Gesichtsprofil (konvex, konkav, gerade), den Lippenschluss (kompetent/inkompetent), eine Zungenfehlfunktion, die Mund- oder Nasenatmung, die Mundöffnung, die Bändchenansätze, die sagittalen und vertikalen Dimensionen der Frontzahnverzahnung, die Eckzahn- und die Molarenverzahnung und die allgemeine Verengung der Zähne zu achten. Das ist eine ganze Menge, die man sich merken muss. Da wir Zahnärzte sind, neigen wir dazu, uns sofort auf die Hartsubstanzbeurteilung (Kariessuche) zu stürzen. Um diesem entgegenzuwirken, sind Checklisten, die abgehakt werden, wie z.B. die Kinder- und Elternanamnesebögen, das Befundblatt und die Erstberatungsbögen der Firma KinderDent sehr nützlich (Abb.). Wenn alles ausgefüllt wird, hat man einen sehr guten Überblick über das Kariesrisiko und aktuellen Gesamtbefund dieses Patienten.
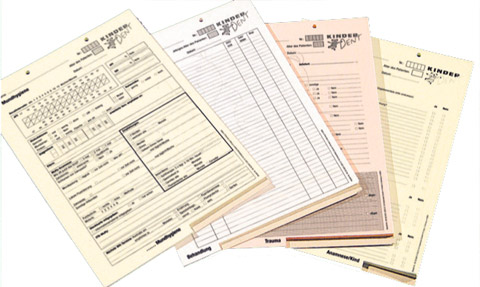
Schmerzen vermeiden
Eine weitere Besonderheit in der Behandlung des kindlichen Patienten ist es, die Schmerzerfahrung zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern. Kinder unter sechs Jahren sind nicht in der Lage, jetzt Schmerzen zu ertragen, damit später „alles gut wird“. Da das Phänomen „Schmerz“ zwei Komponenten hat, nämlich die physiologische und dann die psychologische, ist es wichtig als Zahnarzt, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Vergabe der Lokalanästhesie zur „hohen Kunst“ gehört, und wer sie beherrscht, erzielt in der Kinderbehandlung die halbe Miete. Lokalanästhesie ist entscheidend für eine schmerzfreie Behandlung – auch bei Kindern. Die meisten Behandlungsabbrüche kommen zustande, wenn einem Kind wehgetan wird.
Für die Kontrolle von Schmerzen ist ein entspannter und nicht auf erwartete Schmerzen fixierter Zustand ebenso wichtig wie die lokale Ausschaltung der Schmerzweiterleitung durch Lokalanästhesie. Durch Entspannung und daran gekoppelte Ablenkung vom angstauslösenden Stimulus kann die Schmerzreaktion entscheidend beeinflusst werden. Iatrosedation nennt man die Techniken, die eine Beruhigung und Schmerzlinderung herbeiführen können, ohne die Anwendung von Pharmaka. Beispiele sind die „Audioanalgesie“, die Beruhigung des Patienten durch Hören von Musik oder Geschichten mittels Kopfhörern, Ablenkung durch Bilder an der Decke oder besonders wirksam das Fernsehen. Ein nützliches Werkzeug bei der Ablenkung der Kinder während einer Zahnbehandlung ist „der Zaubersack“. In den Sack können Sie kleine Gegenstände, Trommelsteine, Bohnen oder Ähnliches geben. Und wenn es zeitlich mal wieder zu viel für ein Kind wird, etwas mehr Zeit herausholen, indem Sie das Kind herausfordern, die Hand in den Zaubersack zu legen und „ohne Schauen“ sagen, was drin ist; oder einen „Zauberstein“ herausfinden, welcher warm wird durch seine Berührung und mit nach Hause genommen werden kann. Es gibt eine Vielzahl an Tipps und Tricks, die Kollegen/innen entwickelt haben, um die Behandlung ihren kleinen Patienten weniger belastend zu gestalten. Weiterhin ist die Terminierung der Behandlungen zu berücksichtigen. Je jünger das Kind oder je schwieriger die Behandlung, desto früher am Tag sollte der Behandlungstermin gelegt werden. Auch empfiehlt sich, die Kindersprechstunde blockweise zu gestalten, da sich dann der Zahnarzt, die Mitarbeiter und das Wartezimmergeschehen einheitlich auf die Bedürfnisse der Kinder orientieren können. Mit jedem glücklichen Kind in der Zahnarztpraxis gibt es auch zufriedene Eltern, die Vertrauen zur Praxis haben und sie weiterempfehlen. Die Kollegen, die sich im Thema Kinderzahnheilkunde fortbilden, machen diese Erfahrung tagtäglich.
Autor: Dr. Cheryl Lee Butz







