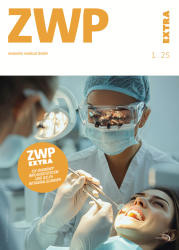Psychologie 21.02.2011
Lernprozesse in der Praxishygiene
share
Das Erlernen und Einhalten von Hygienevorschriften bereitet dem Team in manch einer Zahnarztpraxis Schwierigkeiten. Die Fülle an Informationen und Handlungsanweisungen übersteigen eventuell den Intellekt, die Aufnahmekapazität und in manchen Fällen dadurch bedingt auch den Willen. Aus psychologischer Sicht ist hier von Interesse, Einsichten in Lernmodelle und deren Anwendbarkeit zu gewinnen.
Grundsätzlich ist jedes Teammitglied in der Lage, Hygienevorschriften zu erlernen und einzuhalten – lediglich die Taten überzeugen nicht immer. Instrumente und Apparate sind schlecht gesäubert, Desinfektion ist ein Fremdwort und Arbeitsabläufe wie das Sterilisieren scheinen unbekannt zu sein. Hier ist es an der Zeit, sich einige fundamentale psychologische Lernaspekte ins Gedächtnis zu rufen, um motiviert und ohne Verzweiflung an die Schulung des Teams heranzugehen (z.B. Mamerow, 2008; Winkel, Petermann & Petermann, 2006).
Geduld: Neuroplastizität
Nüchtern betrachtet funktioniert der Mensch entsprechend seiner neuronalen Verbindungen. Es gibt Nervenzellen, Synapsen, Neurotransmitter, Aktionspotenziale und Rezeptoren. Wird eine synaptische Übertragung durch eine bestimmte Handlung besonders häufig ausgelöst, vernetzen sich die neuronalen Strukturen und die Handlung kann schneller und leichter ausgeführt werden („Cells that fire together wire together" – Zellen, die gemeinsam feuern, verdrahten sich; Hebb, 1949). Nehmen wir nun an, die Helferin ist es seit jeher gewohnt, das Essbesteck erst einmal in die Spüle zu werfen und bei späterer Gelegenheit zu säubern. Das Gehirn hat sich hervorragend an diesen Ablauf gewöhnt und alle Neurone daraufhin verdrahtet. Nun kommt jene Helferin in der Zahnarztpraxis in eine ähnliche Situation: Wieder handelt es sich um verschmutztes Besteck. Dass es sich diesmal um Operationsbesteck handelt, differenziert das Gehirn nicht so schnell. Besteck ist Besteck und alle Nervenimpulse starten ihren gewohnten Gang. Das Besteck wird erst einmal zur Seite geräumt.
Das Gehirn muss nun lernen, dass Operationsbesteck eine Sonderform der
Kategorie Besteck ist, das sofort gereinigt und desinfiziert werden muss. Sehr schwierig. Es müssen nicht nur neue neuronale Bahnen geformt werden wie bei einer vollständig unbekannten Handlung (was einfacher wäre). Alte Bahnen müssen gleichzeitig gehemmt und abgebaut werden. Sie sehen, es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Es dauert mindestens sieben Wochen bis zu drei Monaten, bis sich neue Verknüpfungen zuverlässig gebildet haben – und das bei regelmäßiger Rückmeldung. Hier hilft nur Geduld.
Hoffnung: Lernprinzipien nach Carl Rogers
Auch wenn es dem Zahnarzt manchmal nicht so erscheint: jeder Mensch ist lernfähig. Vorausgesetzt, es werden ein paar Bedingungen beachtet (nach Rogers, 1969). Dazu gehören:
1. Menschliche Wesen haben die natürliche Gabe, zu lernen. Es sollte dem Team durchaus leichtfallen, sich die Praxishygiene anzueignen, was schon einmal eine gute Startposition ist.
2. Lernen findet dann statt, wenn der Schüler den Lerninhalt als wichtig für sich selbst einstuft. Die Helferin muss erst einmal davon überzeugt sein, dass die Hygiene ihr selbst etwas bringt. Das könnte Gesundheit sein oder grundsätzlich die Sicherung ihres Arbeitsplatzes.
3. Lernprozesse, die als Veränderung des eigenen Selbst wahrgenommen werden, werden als bedrohlich eingestuft und abgewehrt. Muss die Helferin etwas erlernen, was ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Gewohnheiten widerspricht, stößt das auf instinktive Abwehr. Der Organismus versucht zunächst so zu bleiben, wie er ist, da er bisher auf diese Art und Weise gut überleben konnte. Dazu passend besagen Lernprinzipien vier und fünf, dass leichter und umfassender gelernt wird, wenn keine Bedrohung vorhanden ist.
4. Jene Lernerfahrungen werden leichter wahrgenommen, angenommen und verarbeitet, wenn es kaum äußere Bedrohungen gibt.
5. Wenn es wenig Gefahren für das eigene Selbst gibt, können Erfahrungen in unterschiedlichen Facetten wahrgenommen werden und der Lernprozess kann voranschreiten.
6. Sehr verankert sind Lernerfahrungen, wenn sie durch Handlungen angeeignet wurden. Es hilft im Lernprozess, wenn die neuen (und alten) Hygieneabläufe mehrfach durchgeführt werden können. Es reicht nicht aus, sie aufzuschreiben und abzuheften.
7. Gefördert und erleichtert wird ein Lernprozess dann, wenn ein Schüler (selbst-) verantwortlich daran teilnimmt. Motivieren Sie Ihre Teammitglieder, die Vorschriften aktiv mitzugestalten und zu erproben.
8. Selbst gewähltes Lernen, das die Person als Ganzes inklusive Emotionen und Intellekt fordert, erzeugt die durchdringendsten und nachhaltigsten Lernerfahrungen. Die Teammitglieder müssen sowohl im Positiven als auch im Negativen erfahren, was gute und schlechte Praxishygiene bedeutet. Kultivieren Sie beispielsweise ein paar Bakterien und lassen Sie die Teammitglieder den Ekel spüren – vorzugsweise außerhalb der Praxis. Hygiene nimmt auf einmal einen anderen Stellenwert ein.
9. Unabhängigkeit, Kreativität und Selbstvertrauen werden dann erleichtert und gefördert, wenn Selbstkritik und Selbsteinschätzung von entscheidender und die Beurteilung durch andere von zweitrangiger Bedeutung sind. Teammitglieder, die nur aus Angst vor dem Chef auf Hygiene achten, werden weniger genau sein als jene, die in erster Linie mit sich selbst zufrieden sein möchten. Fördern Sie die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Bieten Sie Weiterbildungsmöglichkeiten und loben Sie.
10. Den größten sozialen Nutzen erbringt das Erlernen von Lernprozessen als solche. Vermitteln Sie ihren Mitarbeiterinnen, dass Lernen an sich positiv bewertet und nicht als zusätzliches Übel empfunden wird. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
Zusammenfassend erscheint die Vermittlung von Praxishygiene sehr einfach. Die Mitarbeiter müssen den Sinn erkennen, Abläufe selbst erarbeiten und trainieren und aus einer Eigenmotivation heraus handeln. Woran könnte es noch hängen?
Verständnis: Lernerfolge Schritt für Schritt
Nachdem wir nun eingesehen haben, dass das Gehirn seine Zeit braucht und die Voraussetzungen an sich optimal gegeben sind, bedarf es nur noch einer Übersicht über die Lernschritte. Damit wir sie auch erkennen, wenn sie gemacht wurden.
Am Anfang befindet sich die nun als lernwillig erkannte Helferin im Stadium des Wissens. Sie muss Fakten erlernen und sich die Abfolge der Schritte einprägen (deklaratives Faktenwissen). Darauf aufbauend kommt sie in das Stadium der Assoziationen und praktischen Übungen. Sie eliminiert Verständnisfehler, einzelne Zwischenschritte werden zu Handlungseinheiten (prozedurales Handlungswissen). Im autonomen Stadium braucht es keine gezielte Aufmerksamkeit oder verbale Beschreibung mehr. Das Besteck wird ohne Überlegung gesäubert und für die nächste Benutzung adäquat vorbereitet.
Dennoch fällt eventuell auf, dass die Lernfortschritte anfangs enorm waren und mit der Zeit nachlassen. Liegt das an mangelnder Motivation? Nicht zwingend. Jede motorische und kognitive Fertigkeit verbessert sich zu Anfang rapide, da sozusagen „das Grobe“ erlernt wird. Für die spätere Optimierung wird immer mehr Übung nötig, um das Feintuning vorzunehmen.
Erlernen, Einprägen und Automatisieren
Das Einhalten von Hygienevorschriften erfordert das Erlernen, Einprägen und Automatisieren von unzähligen Handlungs- und Gedankenabläufen. Klar strukturierte und verständliche Anweisungen erleichtern diesen Prozess. Zusätzliche Faktoren wie Motivation, Einsicht oder Interesse kommen noch hinzu und addieren sich zu den lernpsychologischen Hürden auf dem Weg zur optimalen Praxishygiene. In diesem Artikel wurden Lernvorgänge auf einzelne Aspekte heruntergebrochen mit dem Ziel, Schwachstellen zu erkennen und Praxishygiene aus Sicht der Teammitglieder zu verstehen. Dadurch kann der Zahnarzt Verbesserungsvorschläge anregen. Vor allem aber hilft diese Sichtweise, sich vom emotionalen Ärger wegzubewegen und sich hin zur analytisch-stressreduzier-ten Sichtweise zu begeben.
Referenzen
– Hebb, D. (1949). The Organisation of Behaviour. Wiley: New York.
– Mamerow, R. (2008). Praxisanleitung in der Pflege. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
– Rogers, C.R. (1969). Freedom to learn: a view of what education might become.
Columbus, OH: Charles E. Merrill.
– Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). Lernpsychologie. Paderborn:
Ferdinand Schöningh Verlag.
Autorin: Dr. Lea Höfel