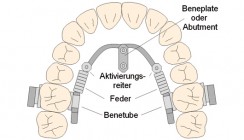Kieferorthopädie 05.09.2013
„Die Methode ist sehr technikabhängig“
share
Beim diesjährigen AAO-Kongress referierte Dr. Thierry de Coster über die knochenverankerte, chirurgisch unterstützte Gaumennahterweiterung. KN traf ihn zum Interview.
KN: Was sind die Hauptvorteile der
skelettal verankerten Methode im Vergleich zur zahngetragenen Verankerung?
Dr. Thierry de Coster: Weil der Zahn nicht betroffen ist, weist die
skelettal verankerte SARME-Methode (Surgically Assisted Rapid
Maxillary Expansion) einige Vorteile gegenüber der zahnverankerten
Methode auf. Diese Vorteile wären:
- kein Risiko eines Verankerungsverlustes
- kein bukkales Tipping der posterioren Zähne und eine geringere Wahrscheinlichkeit für ein dentales Rezidiv
- eine rein skelettale Korrektur
- kein Stress für die parodontale Membran; die Methode kann sogar bei einer parodontal vorbelasteten Situation angewandt werden
- ein geringeres Risiko für eine Wurzelresorption oder Fenestrationen des kortikalen Knochens
- geringeres Tipping des Knochensegments, da die Apparatur direkt auf den Gaumenfortsätzen in der Nähe des Widerstandszentrum der Maxilla platziert wird
- hygienisch
- leicht zu platzieren, ohne laborseitige Vorbereitung erweitert die therapeutischen Möglichkeiten und Indikationen
- erhöht das maxillare Knochenvolumen, sodass das Alignment ohne Beeinträchtigung des Parodontalstatus möglich wird.
Rechtfertigen diese Vorteile einen
zusätzlichen chirurgischen Eingriff bei jungen Patienten?
Die
Behandlung (skelettal verankerte SARME) ist lediglich bei erwachsenen Patienten indiziert,
wenn die orthopädische GNE nicht mehr möglich ist. Sie stellt quasi
eine Alternative zur zahnverankerten SARME dar.
Welche Nachteile der skelettal
verankerten Methode sehen Sie?
Die skelettal verankerte SARME ist
sehr technikabhängig. So sollte die Apparatur ausschließlich
horizontal platziert werden, um vertikale Nebenwirkungen und eine
Neigung der okklusalen Ebene zu vermeiden. Darüber hinaus könnte es zu
entzündlichen Komplikationen im Bereich der Abutments kommen (wo
die Apparatur verankert ist). Diese Probleme können jedoch in den
meisten Fällen mit klassischen entzündungshemmenden Medikamenten
gelöst werden. Darüber hinaus sehe ich bei dieser
Methode keinerlei Nachteile im Vergleich zur zahngetragenen SARME,
die sie in allen Situationen und mit all ihren Vorteilen ersetzen
kann.
Bevorzugen Sie die knochenverankerte
Methode nur bei SARME-Patienten oder auch bei Patienten ohne
chirurgische Unterstützung?
Wie auch die Miniplatten kann die
knochenverankerte Expansion in allen klinischen Situationen
angewandt werden, bei denen die Zähne nicht zur Verankerung genutzt
werden können bzw. sollten (z.B. bei umfangreicherer
Zahnlosigkeit, Nichtanlagen, schwachen Zähnen, multifaktoriellen
kranio-fazialen Syndromen, usw.). Unabhängig davon ist für die
Platzierung der Apparatur eine Vollnarkose notwendig.
Klinische Anwendung
Fall 1 (Abb. 1 bis 5)
Diagnose:
- skelettale und dentale Klasse II
- „Long Face“-Syndrom, „Bird Face“
- mandibulare Retrognathie
- vertikaler maxillärer Excess mit Gummy Smile
- Engstand im OK und UK
Behandlungsplan:
- Extraktion von 34,44
- Ausrichtung und Nivellierung der unteren Zähne
- Chirurgie 1. Phase: SARME
- Ausrichtung und Nivellierung der oberen Zähne
- Chirurgie 2. Phase: maxilläre Impaktion, Autorotation der Mandibula, UK-Vorverlagerung und Kinnplastik
- abschließende kieferorthopädische Behandlung
Wir wenden SARME nicht mit
Mikro-Implantaten an, jedoch kann diese Technik mit klassischen
dentalen Implantaten (z. B. Brånemark) genutzt werden.
Fall 2 (Abb. 6 bis 18)
Diagnose:
- transversale maxilläre Defizienz
- Long-Face-Syndrom
- skelettal offener Biss
- Molarenbeziehung der Klasse III
- dentale Asymmetrie, Abweichung nach rechts
- rechts lateraler und posteriorer Kreuzbiss
- Lippeninkompetenz
Behandlungsplan:
2-Phasen-Chirurgie
SARME
- kieferothopädisches Alignment
- 2. Phase: maxilläre Impaktion, mandibuläre Autorotation, chirurgischer Lückenschluss, Kinnplastik