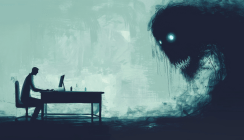Praxismanagement 02.02.2026
Impathie statt Dauerfunktionieren – warum Führungskräfte ohne Empathie zu sich selbst ausbrennen
share
Genau an dieser Stelle wird es spannend, denn hier kommt ein Begriff ins Spiel, der in der Psychologie noch jung, aber ziemlich präzise ist, die sogenannte Impathie, die "Empathie nach innen". Für Führungskräfte, ob in einer Zahnarztpraxis oder innerhalb eines MVZ, lautet die Frage deshalb nicht mehr nur:

Vom Empathie-Hype zur blinden Stelle
Führung soll grundsätzlich immer empathisch gelingen, man soll empathisch kommunizieren, Konflikte innerhalb unterschiedlichster Teams und Charaktere empathisch moderieren und lösen. In der Theorie liest sich das wirklich gut und cozy. In der Praxis bedeutet es oft, dass Führungskräfte immer mehr emotionale Last aufnehmen, ohne gleichzeitig zu lernen, was mit ihrer eigenen Innenwelt in diesem Prozess eigentlich passiert. Studien zeigen, dass gerade sehr empathische Führungspersonen überdurchschnittlich gefährdet sind, in emotionale Erschöpfung und Burnout zu rutschen, wenn sie keine klaren inneren Grenzen entwickeln.
Empathie nach außen ohne Empathie nach innen funktioniert eine Zeit lang erstaunlich gut. Man hält noch eine Extraschicht, noch ein weiteres Projekt, noch einen schwierigen Mitarbeitenden aus, obwohl man innerlich längst am Limit ist. Parallel dazu läuft das Postfach voll. Irgendwann kippt jedoch dieses System. Es folgen Gereiztheit, Rückzug, körperliche Symptome, Zynismus. Das Team erlebt plötzlich eine „schwierige“ oder gar „unberechenbare“ Führungskraft. Innen ist es oft eher eine massiv überforderte Person, die sich selbst schon viel zu lange nicht mehr wirklich wahrgenommen hat.
Was Impathie ist und was nicht
Die Psychologin Prof. Dr. Stefanie Neubrand gilt als wissenschaftliche Stimme der Impathieforschung und beschreibt Impathie als introversive Empathie, also als Fähigkeit, sich in die eigene Gefühlswelt einzufühlen, sie zu teilen und zu verstehen. Anders als bei klassischer Empathie richtet sich die eigene Wahrnehmung und der Fokus demnach nicht nach außen auf andere Menschen, sondern nach innen. Neubrand schlägt vier Bausteine vor, die Impathie greifbar machen.
Wahrnehmen
Eigene Gefühle und Körpersignale überhaupt registrieren. Nicht erst um 22 Uhr auf dem Sofa, wenn man nur noch starrt, sondern mitten im hektischen Alltag, wenn der Patient vor der Tür wartet und im Kopf parallel die Abrechnung und der Schichtplan laufen.
Innere Meta-Position
Einen halben Schritt inneren Abstand einnehmen. Sich selbst kurz wie von außen betrachten. Wie sitze ich hier, wie klingt meine Stimme, was passiert in mir, während ich mit meinem Mitarbeiter spreche und agiere.
Akzeptierende Haltung
Das, was da auftaucht, nicht sofort kleinmachen. Kein „Jetzt stell dich nicht so an“, kein „andere haben es schwerer“. Eine nüchterne Anerkennung: Ja, ich bin gerade angespannt, enttäuscht, überfordert und das ist in dieser Situation zunächst eine nachvollziehbare Reaktion.
Verstehen
Einordnen, woher das Gefühl kommt und was es mit der Situation zu tun hat. Reagiere ich tatsächlich auf das Verhalten meines Gegenübers oder liegt darunter eine alte Erfahrung, ein alter Trigger, eine Angst um Zahlen, Status und Sicherheit.
Impathie hat nichts mit Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber zu tun, aber auch nichts mit rosaroter Selbstliebe. Es geht eher um eine klare, wache innere Beziehung. Ich nehme ernst, was gerade in mir passiert, ohne mich vollständig darin zu verlieren. In der bisherigen Literatur wird Impathie genau in dieser Form als wichtiger Baustein für psychische Stabilität und eine tragfähige Selbstbeziehung diskutiert.
Selbstmitgefühl als Puffer für Belastung
Weil Impathie als Konstrukt noch relativ jung ist, lohnt sich ein Blick auf die Nachbardisziplinen. Gut untersucht ist das Feld „Self-Compassion“, eine mitfühlende, nicht abwertende Haltung sich selbst gegenüber. Meta-Analysen zeigen, das Menschen mit höherer Selbstmitgefühls-Ausprägung weniger depressive Symptome, weniger Angststörungen und insgesamt eine höhere psychische Lebensqualität haben. Selbstmitgefühl ist nicht identisch mit Impathie, aber eng verwandt. Auch hier geht es darum, sich in Belastungssituationen nicht fertig zu machen, sondern freundlich, realistisch und gleichzeitig verantwortlich mit sich umzugehen. In der Forschung wird Self-Compassion zunehmend als Schutzfaktor diskutiert gegen Burnout, gegen übermäßige Scham, gegen das bekannte Gedankenkarussell aus Selbstkritik und Grübeln. Impathie lässt sich somit als präzisere Brille verstehen, durch die diese Mechanismen betrachtet werden. Wer sich selbst empathisch wahrnimmt, also Gefühle richtig registriert, innerlich in eine Beobachterposition gehen kann, akzeptierend bleibt und versteht, was da passiert, schafft damit genau die Grundlage, die Self-Compassion-Studien immer wieder mit besserer psychischer Gesundheit verknüpfen.
Impathie ist die innere Brille, durch die Führungskräfte zuerst auf sich selbst schauen
Für Führungskräfte in der Zahnmedizin, also Praxisinhaber, angestellte Behandlerinnen und Behandler, Teamleitungen, ebenso wie in anderen Organisationen, sind die tagtäglichen Belastungsfaktoren gut bekannt. Hoher Zeitdruck, Spannungsfeld zwischen fachlicher Qualität und wirtschaftlicher Verantwortung, emotionale Themen im Team, dazu ein oft hoher eigener Anspruch. Wer hier nur nach außen empathisch funktionieren soll, ohne inneres Korrektiv, zahlt am Ende einen Preis.
Empirische Arbeiten aus der Medizin und dem Gesundheitswesen zeigen, dass Programme, die Selbstwahrnehmung, Emotionsregulation und einen freundlicheren Umgang mit sich selbst fördern, bei Behandlern und Führungskräften mit einem geringeren Burnout Risiko und besserer Work-Life-Balance einhergehen. In einzelnen Studien blieb die Empathie gegenüber Patienten und Mitarbeitenden dabei stabil, statt unter Stress weiter abzunehmen.
Praktisch bedeutet das zum Beispiel Folgendes: Die Praxisleitung, die merkt, dass sie innerlich auf Rot läuft, weil seit Stunden alles gleichzeitig auf sie einprasselt, und die sich diese Information eingesteht, wird eher sagen „Wir machen hier einen Cut und nehmen die letzten beiden Patienten morgen dran“, als jemand, der nur die Zähne zusammenbeißt und noch schnell alles dazwischenschiebt. Impathie übersetzt sich damit direkt in Entscheidungen, die sowohl die eigene Gesundheit als auch die Teamdynamik betreffen.
Wie sich fehlende Impathie im Alltag zeigt
Das Fehlen von Impathie wirkt von außen selten „krank“, sondern oft erstaunlich leistungsbereit. Typische Szenen, die in vielen Teams vorkommen, ob man sie so nennt oder nicht.
- Die Praxisinhaberin, die jede Zusatzaufgabe an sich zieht, weil „es sonst niemand richtig macht“, und innerlich immer mehr verhärtet, während das Team irgendwann gar nicht mehr nachfragt.
- Der Chef, der bei kleinen Fehlern völlig explodiert, obwohl objektiv nichts Dramatisches passiert ist, und anschließend mit schlechtem Gewissen im Büro sitzt, es aber trotzdem am nächsten Tag wieder genauso macht.
- Die Teamleitung, die Konflikte konsequent ignoriert, weil sie das eigene Unbehagen beim Ansprechen nicht aushält, und sich dann wundert, warum das Team zunehmend passiv oder zynisch reagiert.
- Eine Führungskraft wirkt im Meeting ruhig und lösungsorientiert, hat innerlich aber längst beschlossen, es selbst zu machen, weil die dritte Schleife über dasselbe Thema zu viel ist. Nach außen bleibt alles sachlich, innerlich wächst der Frust, bis er sich an einer Kleinigkeit entlädt.
In all diesen Fällen fehlt weniger Empathie für andere als vielmehr die eigene Impathie. Gefühle werden nicht wahrgenommen oder sofort abgewertet, statt sie als Signal entsprechend zu nutzen. Die Folge dessen sind dann Entscheidungen aus Überlastung, Angst oder Ärger heraus, ohne dass die Person sich selbst innerlich „abholt“. Langfristig erhöht genau das die Wahrscheinlichkeit für Erschöpfung, innere Kündigung oder offene Konflikte im Team.
Wie trainieren wir nun Impathie ohne extra Tag im Kalender?
Die gute Nachricht vorweg: Impathie ist keine magische Fähigkeit oder fest verdrahtetes Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Skill, der sich step by step erlernen lässt. Es braucht dafür ein wenig Übung, aber keinen zusätzlichen Workshop-Tag, den es in der Realität ohnehin selten gibt. Drei einfache Ansätze, die sich in den Führungsalltag einbauen lassen, sofern Sie es zulassen.
Mikro-Check-in mit sich selbst
Drei Mal pro Tag, am besten zu festen Zeiten wie vor der ersten Behandlung, nach der Mittagspause und kurz vor Feierabend, ein innerer Mini-Scan mit zwei Fragen:
- Was fühle ich gerade.
- Wo merke ich das im Körper.
Keine große Analyse, kein „ich müsste aber“. Nur registrieren.
Wer diesen Sensor schärft, erwischt Überlastung früher, nicht erst, wenn der Körper sie über Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder Gereiztheit in "Ihr System" brennt.
Innere Beobachtung im Gespräch
In schwierigen Teamgesprächen oder bei Beschwerden lohnt es sich, parallel einen kleinen inneren Beobachter laufen zu lassen. Wie ist meine Körperhaltung, wie schnell rede ich, was passiert gerade in mir, wenn die andere Seite Kritik äußert oder blockt.
Dieser halbe Schritt Abstand wirkt oft schon deeskalierend. Man merkt, dass man gerade in den Verteidigungsmodus rutscht, die Luft anhält oder lauter wird, und kann entscheiden, ob man in diesem Zustand weitersprechen will oder kurz innehalten muss.
Grenzen ernst nehmen und nicht nur denken
Viele Führungskräfte wissen rational, dass sie Grenzen haben, handeln aber im Alltag so, als gäbe es sie nicht. Impathie heißt, die eigene Grenze nicht nur zu spüren, sondern sie in eine Entscheidung zu übersetzen. Zum Beispiel:
- Einen übervollen Tag nicht noch mit zusätzlichen „Kannst du mal kurz“ zupflastern, sondern bewusst verschieben.
- Delegation wirklich umzusetzen, statt Aufgaben erst abzugeben und sie dann doch wieder heimlich selbst fertigzustellen.
- Im Team offen zu benennen, dass die eigene Belastung gerade hoch ist, ohne sich dafür zu entschuldigen, ein Mensch zu sein.
- Bei Kritik aus dem Team nicht so zu tun, als ginge sie spurlos vorbei, sondern ruhig zu sagen, dass einen das auch fordert und beschäftigt, und dann gemeinsam zu schauen, was daraus konstruktiv werden kann.
Genau an diesem Punkt treffen Impathie, Selbstmitgefühl und professionelle Führung aufeinander. Wer sich selbst innerlich ernst nimmt, kann nach außen klarer, ruhiger und berechenbarer auftreten.

Empathie nach außen braucht Impathie nach innen
Empathie bleibt ein zentraler Baustein guter Führung und gilt zu Recht als Schlüsselkompentenz in medizinischen Berufen. Patienten, Mitarbeitende und Kolleginnen spüren, ob ihnen jemand mit echtem Interesse begegnet und zuhört oder nur ein Skript abspult. Teams spüren, ob ihre Leitung menschlich erreichbar ist oder nur Ansagen durchreicht. Impathie ist kein nettes Extra, das man sich gönnt, wenn gerade mal „Zeit für Selbstfürsorge“ ist. Sie ist eine Kernkompetenz von Führung in jedem Setting, in jeder Praxis, in jedem Team. Erst wer sich selbst innerlich führt, kann andere glaubwürdig, klar und menschlich führen.