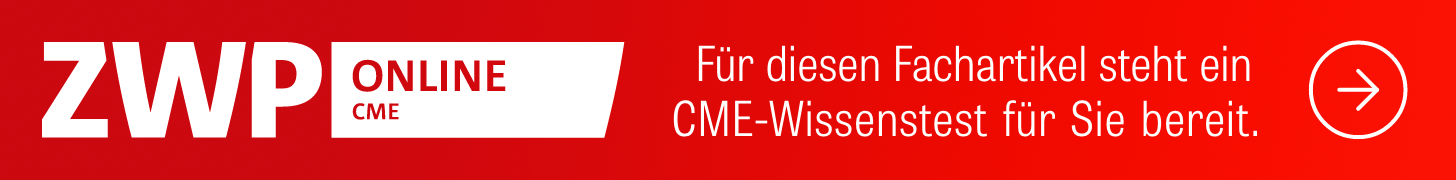Implantologie 07.06.2023
Eigenknochenaufbau im atrophierten Oberkiefer
share
Knochenentnahme mittels der Semilunar-Technik (SLT)
Am Anfang eines implantologischen Eingriffs – speziell in kompromittierten Situationen – steht häufig die Rekonstruktion des intraoralen knöchernen Defekts. Bei diesem vorgestellten Fall wird eine neue innovative Entnahmetechnik namens Semilunar-Technik (SLT) vorgestellt, die möglicherweise eine Vereinfachung der bisherigen Knochenentnahme darstellt. Der folgende Schalenaufbau basiert auf den Prinzipien der Split Bone Block-Technik (SBBT) nach Prof. Fouad Khoury, bei der vorzugsweise patienteneigener vitaler Knochen als sog. „Goldstandard“ zum Einsatz kommt. Der Vorteil liegt in der osteoinduktiven und osteogenetischen Potenz des autologen Knochens.
Eine 62-jährige Patientin stellte sich mit dem Wunsch vor, bei einer schon länger bestehenden Freiendsituation im linken Oberkieferseitenzahnbereich eine geeignete prothetische Neuversorgung für diesen Quadranten zu erhalten. Für die Behandlung war ein horizontaler Knochenaufbau bukkal mittels biologischem Eigenknochenaufbau erforderlich. Die Augmentation wurde mithilfe der Schalentechnik nach Prof. Fouad Khoury und autologen Knochenschalen durchgeführt. Die Knochenschalen wurden mittels der sog. Semilunar-Technik (SLT) im retromolaren Bereich des linken Unterkiefers entnommen. Zeitgleich mit der Implantation konnten die Implantate eingesetzt werden. Nach vier Monaten wurden sie wieder freigelegt. Nach erfolgreicher Osseointegration wurden sie mit einer keramisch verblendeten und okklusal verschraubten Brücke versorgt.
Bei über einem längeren Zeitraum fehlender funktioneller Belastung in einem Kieferabschnitt kann es zu ausgeprägter Knochenatrophie1–3 kommen. Die Rekonstruktion dieser Knochendefekte ist die Grundlage einer dauerhaften Wiederherstellung gesunder Gewebeverhältnisse und prothetischen Restauration.
Zur Schaffung eines ausreichend dimensionierten neuen Implantatlagers können Knochendefekte mit autologen Knochenblöcken, Knochenersatzmaterial oder einer Kombination der beiden Verfahren rekonstruiert werden.4, 5 Im vorliegenden Fall erfolgte die Rekonstruktion des Knochendefekts mittels biologischem Eigenknochenaufbau und der Schalentechnik nach Khoury.6, 7 Dieses chirurgische Protokoll sieht eine Kombination aus autologen Knochenschalen und der Applikation partikulierter autologer Knochenspäne vor.
Ausgangssituation
Eine 62-jährige Patientin stellt sich mit einer schon seit längerer Zeit bestehenden Freiendsituation im Oberkiefer links vor. Ziel der geplanten Behandlung ist die adäquate prothetische Neuversorgung mittels einer implantatgetragenen Brücke (Abb. 1–4).
Chirurgische Maßnahmen
In einem ersten Schritt erfolgt ein externer Sinuslift, um ein ausreichendes vertikales Knochenlager für die späteren Implantate herzustellen. Zeitgleich wurde ein Bone Splitting mittels Meißel durchgeführt, um genügend Primärstabilität für eine simultane Implantation zu erreichen (Abb. 5). Die beiden Implantate konnten erfolgreich inseriert werden. Der Sinus wurde mithilfe der sog. Layering-Technik mit autologen Knochenspänen im krestalen Bereich und Knochenersatzmaterial im kranialen Bereich gefüllt (Abb. 6).
Mittels der Semilunar-Technik (SLT) können mehrere intrakortikale Knochenschalen in der retromolaren Region entnommen werden (Abb. 7). Die Semilunarschalen haben eine Dicke von 2 mm, müssen also nicht mehr zweigeteilt (gesplittet) werden, was einen Zeitvorteil darstellt. Bei der Semilunar-Technik (SLT) kommt der sog. Easy Bone Collector (EBC) zum Einsatz (Abb. 8). Diese neue und patentierte Technolologie kombiniert eine Trepanfräse mit einem Weichgewebeprotektor und erlaubt die schnelle Entnahme von intrakortikalen Knochenschalen. Eine interne Kühlung und ein integriertes Keramiklager beugen Überhitzung vor.
Die Entnahme von mehreren intrakortikalen Semilunarschalen nebeneinander ist möglich (Abb. 9). Es ist darauf zu achten, jeweils eine kleine Knochenbrücke zwischen den Entnahmestellen für den erfolgreichen Einsatz des Easy Bone Collectors (EBC) zu belassen.
Es erfolgt die Knochenentnahme retromolar mittels der Semilunar-Technik (SLT). Danach werden die Schalen mithilfe des sog. Safescrapers weiter ausgedünnt.
Es erfolgt nun die Rekonstruktion des Knochendefekts, wobei die zuvor entnommenen Knochenschalen entsprechend der Schalentechnik nach Prof. Khoury bukkal mit kleinen Osteosyntheseschrauben (TMS-Schrauben) fixiert werden (Abb. 10).
Es ist hierbei eine insgesamte Kieferkammbreite von ca. 8 mm anzustreben. Vorteilhaft bei dieser Methode des biologischen Eigenknochenaufbaus mit autologem Knochen ist, dass nicht überaugmentiert werden muss, da die Resorption äußerst gering ist.
Anschließend wird der bestehende Hohlraum entsprechend der Schalen-Technik nach Prof. Khoury mit partikulierten Knochenspänen aufgefüllt, die beim Ausdünnen der Knochenschalen gewonnen wurden. Durch diese Methode wird im Unterschied zu kompakten Kortikalisblöcken die Oberfläche des Knochens vergrößert, was wiederum zu einer größeren Angriffsfläche für die zuführenden Gefäße führt und damit eine schnellere Ernährung und Revaskularisierung des aufgebauten Knochens erlaubt.
Es sollten bei dieser Art des biologischen Eigenknochenaufbaus keine Membranen verwendet werden, da dies die zuführenden Blutgefäße und die notwendige Revaskularisierung des Knochens behindern würde. Ebenfalls wird auf einer Perforierung bzw. Dekortikation des Kieferkamms verzichtet.
Nach erfolgtem Knochenaufbau wird das Sinusfenster mit einer weiteren zuvor entnommenen Knochenschale abgedeckt. Dadurch kann auf eine Membran verzichtet werden (Abb. 11 und 12). Die Freilegung erfolgt nach vier Monaten. Länger sollte nicht mit dem Reentry gewartet werden.
Die Freilegung erfolgt mittels eines apikalen Verschiebelappens. Bei dieser Technik wird ein Mukosalappen von palatinal nach bukkal verschoben, um bukkal der Implantate wieder keratinisierte Mukosa zu erzeugen und das Vestibulum wieder zu rekonstruieren. Das Periosteum sollte hierbei auf dem Knochen bleiben. Die Osteosyntheseschrauben können einfach durch das Periosteum mittels einer kleinen Stichinzision entfernt werden (Abb. 13). Die Kronen werden auf den Implantaten verschraubt, um einer durch Befestigungszement induzierten Periimplantitis sicher entgegenzuwirken (Abb. 14–16). Die klinischen Abschlussfotos zeigen reizfreies Weichgewebe im periimplantären Bereich sowie eine ausreichende keratinisierte Mukosamanschette periimplantär (Abb. 17 und 18).
Die Verschraubung stellt eine wichtige Prävention gegen das Auftreten einer Periimplantitis dar. Das röntgenologische Abschlussfoto zeigt die knöcherne Regeneration des Defektes und gute Osseointegration der Implantate (Abb. 19).
Diskussion
Im vorliegenden Fall erfolgte die Rekonstruktion des schmalen Kieferkamms nach dem Konzept des biologischen Eigenknochenaufbaus. Hierbei wird retromolar Knochen entnommen und mittels der gewonnenen Schalen (Schalentechnik nach Prof. Khoury6, 7) der Kieferkamm rekonstruiert. Die Knochenentnahme erfolgte hier mittels der Semilunar-Technik (SLT). Dabei kommt der sog. Easy Bone Collector (EBC) zum Einsatz und die Knochenschalen können einfach und schnell entnommen werden. Mittels dieser Knochenschalen wird eine Art Container gebildet und der entstehende Zwischenraum in der Folge mit partikulierten autologen Knochenspänen gefüllt. Im Gegensatz zu Knochenersatzmaterial garantiert die ausschließliche Verwendung von autologem Knochen eine sichere und schnellere Knochenneubildung aufgrund der osteoinduktiven Potenz.
Durch die hohe Präzision, mit denen heute verfügbaren CAD/CAM-Systeme implantatprothetische Gerüste fertigen können, ist eine direkte Verschraubung auf den Implantaten möglich. Dadurch entfällt die Notwendigkeit der Befestigung der Kronen mit Zement, was einer zementinduzierten Periimplantitis sicher entgegenwirkt.
Mit dem beschriebenen Protokoll können schmale Unterkieferkämme sicher rekonstruiert und mit einer verschraubten festsitzenden implantatgetragenen prothetischen Restauration langfristig ästhetisch und funktionell versorgt werden.8, 9
Dieser Artikel ist unter dem Originaltitel: „Biologischer Eigenknochenaufbau im atrophierten Oberkieferseitenzahnbereich“ im IJ Implantologie Journal, 6/2023, erschienen.
Eine Literaturliste steht hier zum Download für Sie bereit.
Bitte beachten Sie, dass CME-Artikel nach zwei Jahren ihre Gültigkeit verlieren.