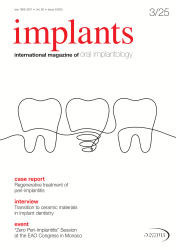Prophylaxe 21.02.2011
Elektrische Zahnbürsten - Die Qual der Wahl
Die große Vielfalt der zwischenzeitlich verfügbaren, unterschiedlichen elektrischen Zahnbürsten stellt unsere Patienten mehr denn je vor ein Entscheidungsdilemma. Die zahnärztliche Praxis ist erster Ratgeber, wenn es sich um Fragen zur Individualprophylaxe handelt. Ein umfassendes Know-how stellt dabei die wichtigste Säule der Beratungskompetenz des zahnärztlichen Teams dar. Dieser Beitrag soll durch eine zusammenfassende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der elektrischen Zahnbürsten Klarheit verschaffen, um die Auswahl des geeigneten Modells zu erleichtern.
In den letzten Jahren hat sich die Einstellung gegenüber elektrischen Zahnbürsten als Alternative zu manuellen Zahnbürsten sowohl auf Seiten des Patienten als auch auf zahnärztlicher Seite deutlich geändert. Eingeschränkte Geduld und Motivation sowie reduzierte manuelle Geschicklichkeit des Patienten führen im Falle der Verwendung einer traditionellen Handzahnbürste zur Etablierung von Putzbewegungen, die keine hohen Ansprüche an die Motorik haben. Dies resultiert häufig in horizontalen Schrubbbewegungen, welche eine eher insuffiziente Plaqueentfernung erreichen und als schädigend für die Zahnhartsubstanz eingeschätzt werden. Elektrische Zahnbürsten scheinen hier durch ihre leichte Handhabung einen Ausweg zu bieten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der elektrischen Zahnbürsten hat dazu beigetragen, dass diese nicht mehr ausschließlich körperlich oder geistig behinderten bzw. manuell ungeschickten sowie kieferorthopädisch behandelten Patienten empfohlen werden; vielmehr übernehmen elektrische Zahnbürsten mehr und mehr die Rolle des grundlegenden Bausteins einer modernen Oralprophylaxe.
Geschichtliche Entwicklung
Die erste elektrische Zahnbürste wurde bereits im Jahr 1885 hergestellt. Seitdem sind mehrere Modelle entwickelt und auf den Markt gebracht worden – im Jahr 1964 wurden über 40 verschiedene Modelle vermarktet. Die nach dem zweiten Weltkrieg weltweit meistverkaufte elektrische Zahnbürste (Broxodent) erzeugte rasche Wischbewegungen, war wasserdicht und wurde direkt an die Steckdose angeschlossen. Broxodent sowie nachfolgende Modelle mit wippenden, vibrierenden oder rotierenden Bewegungen bildeten die erste Generation der elektrischen Zahnbürsten, ohne aber einen eigentlichen Durchbruch erreichen zu können.
Ab 1985 erschienen Modelle mit komplexeren Bewegungen des Bürstkopfes auf dem Markt; sie waren die elektrischen Zahnbürsten der zweiten Generation. Zu den kurzkopfartigen Bürsten dieser Klasse zählen die 1985 von der Firma Bausch & Lomb (Oral Care Division, Tucker, USA) hergestellte, gegenläufig-oszillierende Zahnbürste Interplak sowie die ausschließlich Kreisbewegungen erzeugende Rotadent (ProDentec, Batesville, USA). Die Interplak erreichte in verschiedenen Studien eine effiziente Plaqueentfernung, hatte aber den Nachteil, dass vergleichsweise häufig Verletzungen auftraten. Die Rotadent eignete sich mit drei angebotenen Ansätzen (Lang- und Kurzspitz sowie Kelch) besonders für Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen.
Die heute auf dem Markt befindlichen Rundkopfbürsten erzeugen vornehmlich rotierend-oszillierende Bewegungen. Die von Braun entwickelte, batteriebetriebene Oral-B Plaque Control wurde seit 1991 mehrfach weiterentwickelt. Bei der akkubetriebenen Braun 3D Excel erzeugen die bis zu 8.000-mal pro Minute oszillierenden Borsten zusätzliche Vor- und Rückwärtsbewegungen, während ein integrierter Timer bei der Einhaltung der empfohlenen Putzdauer hilft. Actibrush von Colgate und Dr. Best Brillant von GlaxoSmithKline sind nur zwei von vielen weiteren batterie- und akkubetriebenen, kostenarmen Nachahmer-Bürsten der oszillierenden Rundkopfbürsten. Die in manchen Studien im Vergleich zu Handzahnbürsten festgestellte bessere Reinigungswirkung der elektrischen Zahnbürsten wurde wegen mangelhafter Methodik und Versuchsplanung immer wieder infrage gestellt.
Die elektrischen Zahnbürsten der dritten Generation kommen aus dem Bereich der Schalltechnologie. Die Philips Sonicare gehört zusammen mit der Waterpik Sensonic/Sonic Speed und der Rowenta Dentasonic zu den ersten Modellen, die die Schalltechnik nutzten. Mithilfe gegenpoliger Magnetfelder werden die Borsten in Schwingungen versetzt. In Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass durch eine dynamische Mikroströmungsaktivität und ohne direkten Kontakt Beläge entfernt und Bakterienkolonien (z.B. P. gingivalis, S. mutans, Spirochäten) reduziert werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ungünstige Voraussetzungen wie Dreh- oder Kippstände, Zahnersatz oder individuelle Schwierigkeiten beim Umgang mit der Handzahnbürste das Ergebnis beeinträchtigen können. Darüber hinaus wurde ein proliferativer Einfluss der Schallenergie auf die Fibroblasten beobachtet. Die auf der Ultraschalltechnologie (> 20 kHz) beruhenden Zahnbürsten Ultrasonex und Cybersonic verfügen über zusätzliche Vibrationsbewegungen und sind nicht so verbreitet wie die führenden Schallmodelle.
Effektivität
Die hohe Anzahl an international publizierten Studien, welche die Effektivität sowie das Schadenspotenzial der elektrischen Zahnbürsten untersucht und mit den Handzahnbürsten verglichen haben, erschweren dem direkt interessierten Praktiker den Überblick über den aktuellen Stand des Wissens. Das Cochrane Institut hat aus diesem Grund eine Meta-Analyse durchgeführt, wobei auf Grund der strengen Auswahlkriterien in die tatsächliche Auswertung lediglich 29 randomisierte, klinische Studien aufgenommen werden konnten, welche im Zeitraum von 1966 bis 2002 elektrische Zahnbürsten unterschiedlicher Technologie mit herkömmlichen Handzahnbürsten verglichen haben. Die Analyse des Cochrane Instituts ergab hinsichtlich der Plaque- und Gingivitisreduktion eine sowohl kurzfristige (28 Tage bis drei Monate) als auch langfristige (über drei Monate) Überlegenheit der rotierend-oszillierenden Zahnbürsten (Abb. 1 und 2) gegenüber den Handzahnbürsten. Aber auch die Zahnbürsten mit Schall- bzw. Ultraschallantrieb zeigten einen stärkeren Gingivitis-reduzierenden Effekt im Vergleich zu den herkömmlichen Zahnbürsten.
Sicherheit und Schadenspotenzial
Die Bürstenhärte, der hohe Auflagedruck (> 100 g) und die falsche Methodik (horizontales Schrubben) beim Putzen mit Handzahnbürsten führen zu unerwünschten Effekten (Weichgewebsverletzungen, gingivalen Rezessionen, Zahnhartsubstanzdefekten sowie sensible Zahnhälse). In mehreren Untersuchungen wurde das Schadenspotenzial der verschiedensten elektrischen Zahnbürsten untersucht. Dabei konnten vor allem die schallbetriebenen Modelle ihre Effektivität weichgewebsschonender entfalten. Durch die Schalltechnologie und die erzeugenden Vibrationen brauchen die Borsten mit dem Weichgewebe nicht in Kontakt zu kommen, um die Plaque zu entfernen. Dabei ist der von den Patienten angewendete Druck geringer, was darüber hinaus zur Abnahme der Zahnhalsüberempfindlichkeiten und einer Vermeidung gingivaler Verletzungen führt. Die Meta-Analyse des Cochrane Instituts konnte jedoch hinsichtlich der Verletzungsgefahr zwischen den elektrischen Zahnbürsten und den herkömmlichen Handzahnbürsten keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Auswahl und Anwendung
Die Auswahl und der Kauf der richtigen elektrischen Zahnbürste hängen sehr von den individuellen Bedürfnissen ab. Hinsichtlich der Reinigungswirkung sind vor allem die rotierend-oszillierenden und schallbetriebenen Zahnbürsten zu empfehlen. Bei der Entscheidung spielen immer auch die Kosten sowohl der Zahnbürste als auch der nachzukaufenden Aufsteckbürsten eine Rolle. Hierbei schneiden die preisgünstigen Batteriezahnbürsten schlecht ab, da sie meistens keine Möglichkeit bieten, die Bürsten zu ersetzen und zwangsläufig eine Entsorgung des kompletten Systems erzwingen. Modelle mit kleinen Bürstenköpfen und zugespitzten Borstenbündeln eignen sich gut für Patienten mit Geduld oder kieferorthopädischen Apparaturen und reinigen besonders effektiv die Approximalräume. „Offene“ Zahnzwischenräume lassen sich leicht und schnell mithilfe spezieller Ansätze, die für das entsprechende Modell hergestellt werden, reinigen. Wie zahlreiche Studien zeigen konnten, ist eine ausreichende Putzzeit für die Reinigungswirkung entscheidend, da die Zunahme der Putzzeit (bei korrekter Anwendung) mit der Plaquereduktion korreliert. Demzufolge ist ein Gerät mit integriertem Timer wünschenswert. Bei Patienten mit Rezessionen, keilförmigen Defekten und Zahnfleischverletzungen könnten sich die Schallzahnbürsten als vorteilhaft erweisen.
Eine ausführliche Beratung hinsichtlich der korrekten Anwendung der jeweiligen elektrischen Zahnbürste sollte selbstverständlich sein. Je nach Technologie und Größe werden die verschiedenen Systeme unterschiedlich verwendet. Bei den rotierend-oszillierenden Zahnbürsten wird der Bürstenkopf am Zahn so aufgesetzt, dass die Borsten den Zahnfleischrand gerade berühren. Der Bürstenkopf wird pro Zahn drei bis fünf Sekunden lang leicht nach distal und mesial in die Zahnzwischenräume hineingebracht. Auf dieser Weise wird jeder Zahn systematisch bearbeitet. Abschließend werden die Kauflächen gereinigt. Die Schallzahnbürsten werden so gehalten, dass das Borstenfeld in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zum Gingivarand steht. Kleine Wippbewegungen werden nach distal und mesial durchgeführt, um die Borsten intensiver in die Approximalräume zu führen. Die Putzzeit pro Zahn beträgt fünf Sekunden.
Motivation
Unabhängig von der Verwendung einer manuellen oder mechanisch unterstützten Putztechnik kann die häusliche Mundhygiene nur dann die erwünschten Ergebnisse erzielen, wenn die Zahnbürste korrekt (aber vor allem auch systematisch und regelmäßig) verwendet wird. Mehrere Studien konnten die positive Auswirkung der Anwendung einer elektrischen Zahnbürste auf das Putzverhalten demonstrieren. Die Patienten bevorzugten dabei die elektrischen Zahnbürsten (im Vergleich zur Handzahnbürste); dies wurde vornehmlich mit dem subjektiven Eindruck begründet, dass elektrische Bürsten gründlicher reinigen können. Die Studienteilnehmer empfanden das maschinelle Zähneputzen weniger zeitaufwändig und einfacher. Dies hatte einen eindeutigen Einfluss auf die Motivation, die Compliance der Patienten.
Zusammenfassung
Von der ersten elektrischen Zahnbürste bis zu den heutigen Modellen haben mehrere (Weiter-)Entwicklungen stattgefunden. Hinsichtlich der Reinigungseffizienz und der gingivitisreduzierenden Fähigkeit sind die rotierend-oszillierenden und schallaktiven Zahnbürsten der konventionellen Handzahnbürste überlegen. Die Verletzungsgefahr scheint hingegen bei beiden Zahnbürstenarten (manuell und maschinell) vergleichbar. Da Größe, Form, Ansätze und Kosten der auf dem Markt erhältlichen Zahnbürsten essenziell variieren, kann jeder Patienten-Typus zufrieden gestellt werden. Grundvoraussetzung für den Kauf der indikationsgerechten Zahnbürste und weiterer Pflegeprodukte ist die fachliche Beratung durch ein wissensorientiertes, kompetentes Praxisteam.
Autoren: ZÄ Foteini V. Derdilopoulou, Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa/Berlin