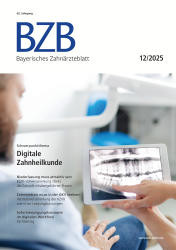Branchenmeldungen 04.09.2015
Krankenkassen-Fusion: Eine teure Idee mit negativen Folgen
Die OÖGKK hat den Fusionsgedanken kritisch hinterfragt und für wenig sinnvoll und ineffektiv eingestuft.
Österreichs Krankenkassen wirtschaften solide, erzielen gute Zufriedenheitswerte bei ihren Versicherten und haben – im internationalen Vergleich – eine vernünftige Größe. Trotzdem kommt regelmäßig der Ruf, die Strukturen zu ändern und die Kassen zu fusionieren. Klar ist: Eine Kassendiskussion ist nur auf Basis von Fakten und erwartbaren Folgen zulässig.
OÖGKK-Direktorin Mag. Dr. Andrea Wesenauer: „Wer an Strukturen herumschraubt, kann ein erfolgreiches System auch schädigen. Wir haben natürlich auch die Fakten geprüft und die Ergebnisse einer Fusion analysiert: Wer diesen Prozess transparent und ohne ideologische Vorbehalte durchleuchtet, stellt fest: Weder können Kosten gespart werden, noch würde die Servicequalität besser“, fasst Wesenauer zusammen. Die OÖGKK prüft in regelmäßigen Abständen zudem auch die Zufriedenheit innerhalb der Versichertengemeinschaft. Entscheidend ist dabei, zu verstehen, woher die Zufriedenheit kommt – und wie man sie erhalten kann.
Verwaltungskosten
Die bestehende Kassenstruktur weist schon heute sehr niedrige Verwaltungskosten auf: Lediglich 2,5 Prozent der OÖGKK-Einnahmen werden für die Verwaltung aufgewendet. Der Rest wird den Versicherten und ihren Angehörigen wieder als Leistungen zurückgegeben. Hinter dem Wort „Verwaltung“ stehen vielfältige und unverzichtbare Arbeitsaufgaben, die für Versicherte und Dienstgeber erledigt werden müssen. So betreuen OÖGKK-Mitarbeiter jährlich rund eine Million Versichertenanfragen persönlich, dazu 770.000 Telefonate und 570.000 Briefkontakte. Sie rechnen Beiträge mit über 40.000 Dienstgebern ab, organisieren ein komplexes Versorgungsnetz mit mehreren Tausend Ärzten, Behandlern und Therapeuten, kontrollieren für die Versicherten die Wirksamkeit von Therapien u.v.a.m. Das Argument, wonach ein großer Apparat effizienter arbeitet als mehrere kleinere Dienstleister, ist mit realen Zahlen und Fakten des deutschen Rechnungshofs widerlegt: Dieser hat 2010 über ein Viertel aller Fusionen deutscher Krankenkassen zwischen 2007 und 2009 eingehend untersucht: Sowohl die Verwaltungskosten als auch die Gesamtausgaben konnten nicht gesenkt werden! Die Schweiz – viel gelobt für ihr effizientes Handeln – hat übrigens 80 Krankenkassen.
Mehr Abhängigkeit, weniger Gerechtigkeit
Schon heute garantiert das ASVG als Grundlage aller Kassenleistungen einheitliche Versorgungsstandards bei Ärzten, Medikamenten und Spitälern. Aber nur im derzeitigen, dezentralen System kann jede Kasse beim Zukauf von Leistungen auf regionale Unterschiede bei Einkommen und Kostenniveau Rücksicht nehmen. Auf Bundesebene ist es schwierig, gute Verträge (gut im Sinne der Versichertengemeinschaft) abzuschließen. Das zeigen schon jetzt jene Bereiche, die bundeseinheitlich geregelt werden, etwa die Zahnversorgung. Hinzu kommt das Problem der verschärften Abhängigkeit: Käme es in einem bundesweiten Vertrag zu einem Honorarkonflikt, ist die Gesundheitsversorgung in ganz Österreich gefährdet. Dieses Risiko ist in der jetzigen Struktur entschärft.
Eine Kassenfusion bedeutet auch: Alle Entscheidungen für Versicherte und Dienstgeber werden in Wien getroffen. Die regionale Zusammenarbeit – etwa bei zukunftsweisenden Versorgungsformen – wird durch Weisungen aus der Bundeshauptstadt ersetzt.
Fazit
- Eine Zusammenlegung kostet Geld, neue Strukturen würden teurer arbeiten.
- Versicherte müssten schlechtere Leistungen hinnehmen!
- Deshalb sollte das bessere System erhalten, aber laufend weiterentwickelt werden.
Quelle: OÖGKK