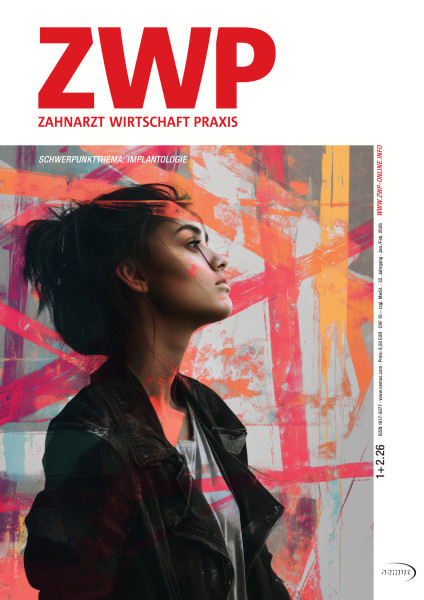Praxismanagement 07.11.2025
Versorgungspioniere: Mobil, kompetenzstark und sinnerfüllt
share
Durch die Einbettung in Strukturen, die auf New-Work-Konzepte (z. B. Vier-Tage-Woche) und ein strategisches Management des Personalwesens setzen, adressiert dieses Modell zudem den drängenden ZFA-Fachkräftemangel. Versorgungspioniere bieten einen wissenschaftlich fundierten, attraktiven Karriereweg, der klinischen Fokus ermöglicht und die benötigte Versorgungssicherheit in versorgungskritischen Regionen gewährleistet. Die Krise der Zahnmedizin ist im Kern eine Identitätskrise, wobei das traditionelle Bild des selbstständigen Einzelkämpfers zunehmend an Anziehungskraft verliert.
Demografischer und versorgungspolitischer Imperativ
Die Realität der zahnärztlichen Versorgung in Deutschland wird von zwei Größen bestimmt: die Überalterung der Ärzteschaft und eine steigende Morbidität der Patienten. Das Durchschnittsalter niedergelassener Praxisinhaber liegt bei 53,4 Jahren, wobei in den östlichen Bundesländern bereits über 50 Prozent der Zahnärzte 55 Jahre oder älter sind. Diese drohende Pensionierungswelle korreliert mit einer sinkenden Zahl an Praxen: die Gesamtzahl der Zahnarztpraxen ist allein zwischen 2013 und 2023 um 12,7 Prozent gesunken. Die Folge sind Unterversorgungsprognosen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Versorgungsgrad bis 2030 voraussichtlich auf 75,2 Prozent sinken wird. Parallel dazu wächst die Patientengruppe mit komplexem Versorgungsbedarf. Ende 2023 waren 5,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Diese Gruppe weist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich schlechtere Mundgesundheitsindizes auf. Im Vergleich zur allgemeinen Gruppe der älteren Senioren (75 bis 100 Jahre) sind Pflegebedürftige häufiger von Karies betroffen und doppelt so häufig zahnlos. Jeder zweite pflegebedürftige Mensch war in der DMS V zahnlos, aber nur jeder dritte in der Vergleichsgruppe der nicht pflegebedürftigen Senioren.
Die drohende Unterversorgung betrifft somit primär die komplexen und mobilitätseingeschränkten Patienten. Der Mangel an Praxisnachfolgern in Flächenländern schafft eine ethische Versorgungsschuld, da gerade die vulnerabelsten Gruppen vom eingeschränkten Zugang betroffen sind. So avanciert die mobile, aufsuchende Zahnmedizin von einem Nischenthema zur gesellschaftlich notwendigen Kernkompetenz.
Versorgungspioniere …
… sind Zahnärzt/-innen, die klinische Autonomie mit gesellschaftlicher Relevanz verbinden und somit dem wachsenden Wunsch nach sinnstiftender Arbeit entsprechen.
Der zentrale Aufgabenbereich des Versorgungspioniers ist die aufsuchende Zahnmedizin. Durch Einsätze in Pflegeeinrichtungen und bei Pflegebedürftigen zu Hause wird Verantwortung für unterversorgte Patientengruppen übernommen. Die extrabudgetäre Vergütung der Leistungen nach § 22a SGB V schafft zudem eine ökonomische Nische, die von
den Budgetierungen der Regelversorgung entkoppelt ist.
Damit wird der Versorgungspionier/-in zu einem Spezialist/-in, der seine Dienstleistung dekommodifiziert. Der Wert der Praxis verschiebt sich von „Wir reparieren Zähne“ zu „Wir managen die Mundgesundheit komplexer Patienten“. Die Bewältigung dieser Komplexität – die neben zahnmedizinischem Fachwissen auch geriatrische Kenntnisse, logistische
Planung für mobile Einsätze und eine sensible Kommunikation mit Angehörigen und Pflegekräften erfordert – wird zur Quelle von beruflichem Stolz und wirtschaftlicher Resilienz.
Finanzielle und administrative Eintrittsbarrieren
Für den zahnärztlichen Nachwuchs sind die Hürden des traditionellen Karrierewegs gestiegen. Die durchschnittliche Gesamtinvestition für eine Einzelpraxisübernahme stieg von 354.000 EUR (2019) auf 463.000 EUR (2023), während eine Neugründung im Durchschnitt 770.000 EUR kostet. Diese Summen implizieren eine erhebliche, 15- bis 20-jährige Verschuldung vor dem ersten Behandlungstag. Gleichzeitig verbraucht die administrative Last klinische Kapazitäten. Analysen zeigen, dass Praxisinhaber 44,1 Stunden pro Woche arbeiten, wovon 11,7 Stunden – oder 26,5 Prozent der Arbeitszeit – auf nicht behandelnde Tätigkeiten wie Verwaltung, Praxisorganisation und Bürokratie entfallen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht führt diese Konstellation zu einer suboptimalen Allokation von Hochqualifikationsressourcen. Die zentrale administrative Steuerung, wie sie im Angestelltenmodell angeboten wird, ist daher keine Komfortfunktion. Vielmehr stellt sie eine notwendige Effizienzsteigerung dar, um klinische Fachkräfte auf ihre Kernkompetenz, die Patientenbehandlung, zu fokussieren und gleichzeitig die finanzielle Risikobereitschaft zu minimieren.
ZFA-Engpass: Personalkrise an der Basis
Die unmittelbarste und existenziellste Bedrohung für den Praxisalltag ist der beispiellose Mangel an qualifizierten Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA). Die Fachkräfteengpassanalyse 2024 der Bundesagentur für Arbeit stuft den ZFA-Beruf als die Berufsgruppe mit dem gravierendsten Fachkräftemangel in ganz Deutschland ein – über alle Branchen hinweg. Dieser Engpass ist kein rein administratives Problem, sondern lähmt den Praxisbetrieb im Kern. Dabei verschiebt die Knappheit die Machtverhältnisse fundamental: Praxisinhaber sind nicht mehr nur Arbeitgeber, sondern Wettbewerber auf einem umkämpften Personalmarkt. Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, reicht eine angemessene Bezahlung allein nicht mehr aus. Konzepte wie eine positive und wertschätzende Teamkultur, klare berufliche Entwicklungsperspektiven und moderne, flexible Arbeitsbedingun-gen werden von „Soft Skills“ zu betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und zentralen Elementen des Risikomanagements.
Prioritätenverschiebung und Bedarf an Flexibilität
Der Wandel im zahnärztlichen Berufsstand wird zudem maßgeblich von einer veränderten Werthaltung der jüngeren Generationen bestimmt. Die Feminisierung der Zahnmedizin – 73 Prozent der Studienanfänger sind weiblich – verstärkt die Nachfrage nach Arbeitsmodellen, die eine bessere Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Während Familie und Partnerschaft für 93 Prozent der Heilberufler als wichtigster Lebensbereich gelten, hat die berufliche Karriere nur noch für 46 Prozent der Befragten hohe Priorität. Diese Verschiebung manifestiert sich in der Erwartung, in Teilzeit zu arbeiten: Knapp zwei Drittel der jungen Frauen und ein Drittel der jungen Männer planen, bis 2030 in Teilzeit tätig zu sein. Die traditionelle 44-Stunden-Unternehmerwoche, verbunden mit hohem Risiko, ist mit diesen Lebensrealitäten strukturell unvereinbar. Karrieremodelle, die keine Flexibilität bieten, werden im Wettbewerb um zahnärztliche Talente zukünftig scheitern.
Operative Merkmale der Versorgungspioniere
Durch den Einsatz voll ausgestatteter, mobiler zahnärztlicher Behandlungseinheiten wird sichergestellt, dass die aufsuchende Versorgung keinen fachlichen Kompromiss darstellt.
Das klinische Spektrum bleibt anspruchsvoll und umfasst Chirurgie, Parodontologie, Prothetik sowie digitale Workflows. Die klinische Konzentration des Versorgungspioniers auf komplexe Fälle ermöglicht es, die Mundgesundheitskompetenz der vulnerablen Gruppen nachhaltig zu verbessern und Barrieren im Gesundheitssystem abzubauen.
New-Work-Konzepte für gesteigertes Wohlbefinden und Produktivität
Innovative Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle sind ein zentrales Element, um den Ansprüchen der neuen Generation von Zahnärzt/-innen gerecht zu werden. Hierzu zählen unter anderem:
Die Vier-Tage-Woche (VTW)
Die Vier-Tage-Woche ist kein Allheilmittel, aber ein kraftvoller Katalysator für die Prozessoptimierung, die Praxen zum Überleben benötigen. Die Notwendigkeit, die gleiche Leistung in weniger Zeit zu erbringen, zwingt zur Überprüfung interner Abläufe – von der Terminplanung über das Materialmanagement bis hin zur Kommunikation.
Pilotstudien in Deutschland belegen, dass die VTW (bei gleicher Vergütung) zu einem erhöhten Wohlbefinden bei 90 Prozent der Mitarbeiter führt. Die mentale und körperliche Gesundheit verbessert sich, während die Produktivi-tät in den meisten Fällen gehalten oder sogar gesteigert werden konnte. Die VTW wird damit zu einem Faktor im Wettbewerb um das Personal und reduziert das Risiko von Burn-out. Das Angebot eines zusätzlichen freien Tages kommt dem Wunsch moderner Arbeitskräfte nach mehr Flexibilität und Work-Life-Balance nach und kann so zum entscheidenden Faktor für die Mitarbeiterbindung werden.
Ergonomisches Arbeitsplatzdesign
Im mobilen Einsatz ist die Einhaltung ergonomischer Standards zur langfristigen Gesunderhaltung des Fachpersonals essenziell. Studien des Fraunhofer-Instituts belegen, dass ergonomische Gestaltungen die Produktivität um bis zu 15 Prozent steigern und krankheitsbedingte Fehlzeiten reduzieren können. Die Optimierung des Designs mobiler Behandlungseinheiten ist somit kein Luxus, sondern ein wesentlicher Faktor für die Aufrechterhaltung der klinischen Qualität und Arbeitssicherheit.
Saisonale und flexible Modelle
Durch die Zentralisierung administrativer Prozesse können Schichtsysteme und saisonale Modelle angeboten werden, die eine flexible Teilzeit- und Job-Sharing-Option ermöglichen.
Co-Autor: Tobias Lippek