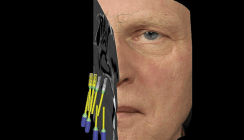Branchenmeldungen 09.04.2015
Das Smile 3D-Konzept in der Dentalfotografie
share
Smile 3D – Röntgendiagnostik 2.0 – Teil 2
Medizinische Abbildungen und Dokumentationen spielen schon in den Anfängen unserer medizinischen Evolution eine wichtige Rolle, respektive gingen Hand in Hand mit dem medizinischen Fortschritt. Wann immer Entdeckungen und Untersuchungen gemacht wurden, so war es schon immer ein Anliegen, diese zum besseren – auch eigenen – Verständnis und zur Weitergabe des eigenen Wissens zu Papier zu bringen.
Frühe Belege gibt es bereits in der Antike von keinem geringeren als Aristoteles, der die Historia Animalium erwähnt, ein Anatomiekompendium über die Arten des Tierreiches.
Im dritten Jahrhundert vor Christus waren es Herophilus und Erasistratos, die umfangreiche Studien an Leichen durchführten und diese dokumentierten. Leider sind diese frühen Belege medizinischer Abbildung bei einem Brand in der Bibliothek von Alexandria im Jahre 47 v. Chr. zerstört worden. In der Renaissance war es dann Leonardo da Vinci, der damit begann, systematisch die Anatomie zu erforschen und bildlich festzuhalten. Seinen ursprünglichen Plan eines Handbuchs der Anatomie verfolgte er jedoch nicht weiter, sodass es bis 1543 dauerte, bis Andreas Vesalios sein „Fabrica“ veröffentlichte. Für seine Sektionen verwendete er – wie auch Herophilus und Erasistratos – die Leichen Exekutierter, die übertags am Galgen gehängt wurden und die er des Nachts heimlich abschnitt.
Während in den Anfängen der Medizin die anatomische Zeichnung oder Skizzen das einzige Mittel der Aufzeichnung waren, so erreichte die medizinische Darstellung im 19. Jahrhundert einen Meilenstein. Die Fotografie war erfunden und somit das Spektrum der Möglichkeiten der Darstellung immens gewachsen. Ein großer Durchbruch und damit einhergehend weitere Erweiterung der medizinischen Darstellung ergab sich sodann 1895 aus der Entdeckung der „X-Strahlen“ von Wilhelm Conrad Röntgen. So wurde es nunmehr möglich, das Innere des Körpers zu betrachten, ohne ihn zu eröffnen.
Über die Zeit entwickelten sich die einzelnen Verfahren immer weiter und wurden weiter verfeinert, neue Unterbereiche entstanden. 1969 wurde von Godfrey Hounsfield die Computertomografie entwickelt, kurz darauf (1975) übrigens auch die erste Digitalkamera. Heutzutage ist man technisch in der Lage, ein schlagendes Herz in Echtzeit auf einem Monitor darzustellen – oder gar herauszufinden, welche Bereiche des Gehirns bei welchen Tätigkeiten die meiste Aktivität aufweisen. Es nicht abzusehen, welche Möglichkeiten in 10, 20 oder 50 Jahren auf uns warten.
Grundlagen der Dentalfotografie
In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf der Fotodokumentation in der Zahnmedizin. Um hierfür die richtigen Voraussetzungen schaffen zu können, sowohl vom Kenntnisstand als auch vom technisch notwendigen Equipment, ist es sinnvoll, ein paar Grundlagen der Fotografie kennenzulernen.
In der heutigen hoch technisierten digitalen Welt, in der fast jeder mittlerweile durch Smartphones, Tablet-PCs & Co. mehrere Kameras besitzt, die noch dazu unkompliziert zu bedienen sind und vollautomatisch funktionieren, macht man sich viel zu selten Gedanken über die technischen Hintergründe, die bei jeder Kamera gleich sind. Weder werden besonders viele Gedanken auf den Bildaufbau verschwendet noch – und dies insbesondere – werden Einstellungen an den Kameras hinsichtlich der optimalen Abbildung eines Motivs verändert. Heutzutage wird erwartet, dass die Technik mit ihren Vollautomatismen quasi von selbst das perfekte Bild schießt. Zwar gelingt dies in der heutigen Zeit immer besser und schafft in vielen Situationen ein durchschnittlichen Qualitätsansprüchen genügendes Bild, doch hochwertige Bilder gerade auch in schwierigen Situationen sind damit nicht möglich. Zudem sind die Anwendungsbereiche der Fotografie so umfangreich, dass es schier unmöglich ist, mit einer gemittelten Einstellung alles abzudecken. Genauso wie niemand auf die Idee kommt, mit einem Sportwagen in schweres Gelände zu fahren, gibt es auch in der Fotografie spezialisierte Ausrüstung und bestimmte Abstimmungen für spezifische Situationen.
Die Breite der unterschiedlichen Aufgabenstellungen oder Gebiete ist dabei so vielfältig wie komplex. Sei es nun die Landschafts-, Personen- oder Gegenstandsfotografie – bei jedem Einzelgebiet gibt es zudem eine große Spanne der Untergebiete. Allein bei der Personenfotografie mit Unterkategorien wie Porträt, Akt oder Sport liegt es nahe, dass hier die Anforderungen grundlegend verschieden sind.
Die zahnmedizinische Abbildung selbst kann als Unterkategorie der Makrofotografie gesehen werden, bei der kleine Objekte originalgetreu abgebildet werden sollen.
In der Fotografie hängt die spätere Abbildung von mehreren Faktoren ab, die das Ergebnis zum Teil sehr stark beeinflussen können:
- Brennweite des Objektivs
- Größe des Bildsensors (oder Films)
- Abstand zum Objekt
- Empfindlichkeit des Bildsensors (oder Films)
- Verschlusszeit
- Blende
- Verfügbares Licht
Das Grundprinzip der Fotografie ist – wie schon eingangs beschrieben – immer gleich. Das Licht des zu fotografierenden Objekts wird durch eine Linse gebündelt und fällt auf einen Bildsensor oder Film. Hierbei bestimmt das Verhältnis von der Brennweite der Linse bzw. des Objektivs zur Größe des Bildsensors die Größe der Abbildung. Je kleiner der Sensor ist, desto größer ist später auch die Abbildung des Motivs. Dies ist auch der Grund dafür, dass in fast allen sogenannten Consumer-DSLRs, also digitalen Spiegelreflexkameras, die Brennweite des Objektivs mit einem Faktor (meist 1,5 oder 1,6) zu multiplizieren ist, um auf die effektive Brennweite zu kommen: Um Kosten einzusparen und die Kameras günstiger anbieten zu können, ist der Bildsensor anstelle des gewohnten Kleinbildformates von 24 x 36 mm häufig deutlich kleiner, etwa 16 x 24 mm, was in diesem Beispiel einen Brennweitenverlängerungsfaktor von 1,5 ergibt. Aus einem an älteren analogen Kameras guten weitwinkligen 28-mm-Objektiv wird so ein 42-mm-Objektiv, welches nun einen deutlich geringen Bildausschnitt einfängt. Dies sollte bei Investitionen in Kameratechnik immer berücksichtigt werden. In hochwertigeren DSLRs stecken daher mittlerweile sogenannte Vollformatsensoren, die dem Kleinbildformat von 24 x 36 mm entsprechen. Die korrekte Belichtung ergibt sich neben der Helligkeit des Motivs aus zwei beziehungsweise drei Faktoren. Neben den klassischen Werten der Verschlusszeit, also der Zeit, da ich Licht auf den Sensor fallen lasse, und der Blendenöffnung gibt es durch die Digitaltechnik eine weitere Möglichkeit: Die Er- höhung der Empfindlichkeit des Bildsensors. Kannte man früher im Wesentlichen Filme mit 100, 200 oder 400 ISO, bei denen man naturgemäß den ganzen Film mit der gleichen Empfindlichkeit für jedes einzelne Foto verwenden „musste“, so haben wir heute die Möglichkeit, die Empfindlichkeit für jedes Bild neu einzustellen – dies zudem in einem deutlich weiteren Bereich. Aktuelle Kameras bieten mittlerweile ISO-Werte von 25.600 und mehr. Je nach Qualität der Kamera nimmt jedoch bei solch extremen Werten das Bildrauschen stark zu und entsprechend die Bildqualität ab.
Die Möglichkeiten der sogenannten „Available- Light-Fotografie“ nehmen damit zwar zu, gleichwohl muss jedoch nach wie vor auf die Ausleuchtung des Motivs geachtet werden.
Nicht weniger wichtig als die korrekte Bildhelligkeit ist die Schärfe des Bildes, hierbei sowohl die Gesamtschärfe als auch die Schärfentiefe. (Die Begriffe Tiefenschärfe und Schärfentiefe werden fälschlicherweise oft analog verwendet. Tiefenschärfe bezeichnet die Schärfe, die ein Bild in der Tiefe [in der Ferne] aufweist, Schärfentiefe jedoch den Bereich, in dem das Bild scharf ist.)
In der zahnmedizinischen Fotografie ist der Punkt der Schärfentiefe ein entscheidender. So möchte man in der Regel den gesamten Bereich von Inzisivien bis hin zu den Molaren scharf abbilden. Bei geringer Schärfentiefe kann es jedoch passieren, dass bereits die Canini keine ausreichende Schärfe mehr aufweisen und die Molaren gänzlich in der Unschärfe verschwinden.
Die Schärfentiefe ist hierbei auch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Oftmals noch bekannt ist, dass die Schärfentiefe maßgeblich durch die Blendenöffnung gesteuert wird: Je kleiner die Blendenöffnung, umso größer der scharfe Bereich – und umgekehrt. Weniger bekannt ist jedoch, dass auch die Größe des Bildsensors, der Abstand zum Motiv und die Brennweite des Objektivs einen großen Einfluss haben. So sinkt die Schärfentiefe bei
- größerem Bildsensor
- größerer Brennweite
- kleinerem Abstand zum Motiv.
Leicht zu beobachten ist dieser Effekt beim Vergleich von Weitwinkel- zu Teleaufnahmen. Während Weitwinkelaufnahmen in der Regel von vorne bis hinten scharf sind, ist es bei Teleaufnahmen meist nur ein kleiner Bereich.
Nun könnte man annehmen, dass man bei den vorgenannten Faktoren einfach eine jeweils kleinere Blende wählt und „das Problem“ damit kompensiert. Dies ist jedoch nicht der Fall, da sich die Blende nicht unbegrenzt verkleinern lässt. Gängige Objektive im Makrobereich erlauben zwar einen weiten Einstellbereich von z.B. Blende f/1.8 bis f/40, also eine Variabilität um Faktor 20, jedoch wird – um im Beispiel zu bleiben – bei Blende 40 demnach 20-mal mehr Licht benötigt als bei Blende 1.8. Kurzum: Die Möglichkeiten der Variation sind vielfältig, sodass es schnell ersichtlich wird, warum automatische Belichtungsprogramme häufig an ihre Grenzen stoßen. Wir möchten in diesem Beitrag daher aufzeigen, wie ansehnliche Dokumentationen entstehen können.
Vorher-Nachher-Bilder in der Zahnmedizin
Nachdem die fotografischen Grundlagen geklärt sind, geht es nun darum, ein standardisiertes Verfahren zu entwickeln, um Vorher- und Nachher-Fotos später auch optimal gegenüberstellen zu können. Hierbei ist es neben den identischen technischen Vorgaben zudem auch von großer Bedeutung, einen Bildaufbau zu verwenden, der sich bei jedem Patienten schnell reproduzieren lässt.
Nur so gelingt es, dem eigentlichen Zweck der aufzunehmenden Fotografien gerecht zu werden. Eine Vergleichbarkeit der Resultate ist nur dann sinnvoll gegeben, wenn alle äußeren Einflüsse eliminiert oder auf ein Mindestmaß reduziert worden sind. Unterschiedliche Bildwinkel, Belichtungsverhältnisse oder Kameraeinstellungen verringern den gewünschten Nutzen zum Teil erheblich. Intention der Zahnmedizin ist bekanntermaßen nicht ausschließlich das Erhalten des Status quo oder das Heilen einer Krankheit, sondern insbesondere auch die Verbesserung der ästhetik, dem persönlichen Wohlbefinden und Selbstwertgefühl. Gerade die Verfolgung eines spezifischen Schön- heitsideals, das in der heutigen Zeit durch Medien und Marketing immer mehr dem eines idealisierten, einheitsschönen Menschen entspricht, lässt bei den Patienten den Wunsch nach einer Veränderung entstehen, die häufig weit über das Maß der reinen „Problemlösung“ hinausgeht. Vielmehr erscheint es mittlerweile immer leichter, durch chirurgische Eingriffe ein gesteigertes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu erreichen, als mit einem vermeintlichen Makel selbstbewusst umzugehen.
Unter Berücksichtigung der hohen Erwartungshaltung vieler Patienten ist es daher nicht nur ratsam, sondern vielmehr geboten, den Behandlungsverlauf und das -ergebnis genau zu dokumentieren, um die geplante und erreichte Veränderung genau darlegen zu können.
Die Zahnarztpraxis jedoch ist eines in aller Regel nicht: ein Fotostudio. So ist es nicht möglich, jede einzelne Aufnahme unter Laborbedingungen herzustellen. Gleichwohl sollten die Abläufe so weit wie möglich vordefiniert bzw. standardisiert werden, um den größten Nutzen aus den Ergebnissen ziehen zu können.
Wir empfehlen als Equipment:
- Nikon DX-Kamera (z.B. Nikon D7100) oder vergleichbar
- Makroobjektiv (Nikon AF-S 105 mm 2.8G VR Objektiv)
- Ringblitz (z.B. SIGMA EM 140 DG)
Smile 3D-Konzept
Das Smile 3D-Konzept wurde entwickelt, um die Vergleichbarkeit von Vorher-Nachher-Aufnahmen zu erhöhen. Hierbei sind bestimmte Kriterien vorgegeben, die eine Umsetzung in der Praxis so einfach wie möglich machen sollen.
Verwenden Sie nach Möglichkeit für alle Aufnahmen einen Lippenexpander, um bequem den jeweiligen Ausschnitt aufnehmen zu können. Zudem erreichen Sie hiermit eine bessere Ausleuchtung, da Sie störende Schatten vermeiden. Zudem benötigen Sie einen Intraoralspiegel (zahnärztlicher Fotospiegel).
Das Konzept Smile 3D gibt es in zwei Varianten:
- Smile 3D: für den Seitenzahnbereich
- Smile 3D+1: für den Frontzahnbereich
- Smile 3D für den Seitenzahnbereich
Perspektive 1: Seitenansicht gespiegelt
Bei dieser Aufnahme wird eine Gebisshälfte komplett abgebildet. Durch die Verwendung des Intraoralspiegels sind die Zähne sowohl von der mesialen wie auch distalen Seite zu sehen.
Setzen Sie den Intraoralspiegel so ein, dass er in Regio 7 (bzw. 8, falls vorhanden bzw. relevant) bündig abschließt. Wählen Sie den Bildwinkel so, dass er nach Möglichkeit rechtwinklig auf den Spiegel zeigt. Der seitliche Bildabschluss sollte auf beiden Seiten exakt intrainzisal liegen. So erreichen Sie einen Bildausschnitt mit optimaler Bildausnutzung. Den Fokuspunkt der Kamera setzen Sie zentral auf den im Spiegel abgebildeten oberen 3er (Abb. 1).
Perspektive 2: Seitenansicht frontal
Bei dieser Aufnahme wird dieselbe Gebisshälfte wie unter Perspektive 1 abgebildet, jedoch direkt von frontal. Somit erreichen Sie eine Dokumentation der Ansicht aus einer üblichen Standardperspektive. In dieser Aufnahme wird kein Intraoralspiegel eingesetzt.
Den Bildwinkel wählen Sie hierbei zunächst so, dass beide Frontzähne abgebildet werden. Gleichzeitig sollte auf der anderen Seite unmittelbar hinter Regio 7 (bzw. 8, falls vorhanden bzw. relevant) das Bild abschließen. Der Fokuspunkt liegt bei dieser Aufnahme auf dem oberen 2er (Abb. 2).
Perspektive 3: Draufsicht
Mit diesem Bild dokumentieren Sie den kompletten Kieferbogen in der Draufsicht. Das Ziel ist, eine Übersichtsaufnahme zur optimalen Vergleichbarkeit zu schaffen. In Abhängigkeit des gewählten Kiefers ist wieder der Intraoralspiegel notwendig. Dieser wird nur im Oberkiefer benötigt, der Unterkiefer wird ohne Spiegel aufgenommen.
Der Bildausschnitt dieser Aufnahme definiert sich durch den Kieferbogen. Seitliche und hintere Begrenzung sind die 7er (bzw. 8er), im vorderen Bereich sollten Sie die Begrenzung unmittelbar vor den Schneidezähnen den Bildschnitt setzen.
Bei dieser Aufnahme ist darauf zu achten, dass der Fokuspunkt nicht in der Bildmitte liegt, sondern optimalerweise auf einem der Prämolaren. Möchten Sie beide Seiten dokumentieren, benötigen Sie demnach fünf Bilder: Schritt 1 und 2 jeweils für beide Seiten, Schritt 3 nur einmal (Abb. 3).
Smile 3D+1 für den Frontzahnbereich
Perspektive 1: Frontalansicht
Das Hauptaugenmerk der Frontalansicht liegt darin, einen ausreichend kleinen Bereich für das Bild zu wählen. So erhalten Sie später die beste Informationsdichte.
Der Bildausschnitt besteht hierbei nur aus Front- und Eckzähnen. Dieses Bild wird direkt von frontal aufgenommen. Setzen Sie die seitlichen Begrenzungen jeweils zentral auf die 14 und 24. Die Bildmitte wird durch die Unterkante der oberen Schneidezähne definiert.
Der Fokuspunkt liegt bei diesem Bild auf einem der oberen Schneidezähne (Abb. 4).
Perspektive 2: Seitenansicht rechts
Mit diesem Bild wird die rechte Seite des Frontzahnbereiches abgebildet. Der Bildwinkel sollte in diesem Fall 45 Grad betragen, Sie nehmen dieses Bild also von schräg vorn auf. Abgebildet werden die Zähne 15–21 bzw. 45–31. Somit liegt die linke Begrenzung des Bildes direkt hinter 15, die rechte Begrenzung direkt hinter 21. Die Bildmitte wird definiert durch die Unterkante der Oberkieferzähne.
Der Fokuspunkt liegt zentral auf 13 (Abb. 5).
Perspektive 3: Seitenansicht links
Mit diesem Bild wird die linke Seite des Frontzahnbereiches abgebildet. Der Bildwinkel sollte in diesem Fall 45 Grad betragen, Sie nehmen dieses Bild also von schräg vorn auf. Abgebildet werden die Zähne 25–11 bzw. 35–41. Somit liegt die linke Begrenzung des Bildes direkt hinter 11, die rechte Begrenzung direkt hinter 25. Die Bildmitte wird definiert durch die Unterkante der Oberkieferzähne. Der Fokuspunkt liegt zentral auf 23 (Abb. 6).
Perspektive 4: Draufsicht
Mit diesem Bild dokumentieren Sie den kompletten Kieferbogen in der Draufsicht. Das Ziel ist, eine übersichtsaufnahme zur optimalen Vergleichbarkeit zu schaffen. In Abhängigkeit des gewählten Kiefers ist wieder der Intraoralspiegel notwendig. Dieser wird nur im Oberkiefer benötigt, der Unterkiefer wird ohne Spiegel aufgenommen.
Der Bildausschnitt dieser Aufnahme definiert sich durch den Kieferbogen. Seitliche und hintere Begrenzung sind die 7er (bzw. 8er), im vorderen Bereich sollten Sie die Begrenzung unmittelbar vor den Schneidezähnen den Bildschnitt setzen. Bei dieser Aufnahme ist darauf zu achten, dass der Fokuspunkt nicht in der Bildmitte liegt, sondern optimalerweise auf einem der Prämolaren (Abb. 7).