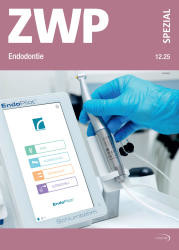Cosmetic Dentistry 12.09.2012
Systemische Wirkungen von Kompositen
share
Teil I
Moderne Zahnheilkunde ohne Komposite ist undenkbar. Ihre Verträglichkeit gilt im Allgemeinen als sehr gut. Warum es dennoch gute Gründe für eine Revision dieser Einschätzung gibt, beschreibt der Praxisbericht von Dr. Just Neiss, Heidelberg.
Obwohl (oder weil?) die biologischen Wirkungen von Kompositen „weitestgehend“ unerforscht sind1 und trotz allen Wissens um das toxische, allergene, mutagene und karzinogene Potenzial ihrer Inhaltsstoffe sowie weltweitem Zunehmen der Allergien wird das Krankheitsrisiko für die Patienten bisher als gering bewertet.2,3,4,5 „Aus Daten über Basismonomere und einige Kompositkunststoffe, vor allem aufgrund der langjährigen Erfahrungen ohne klinisch nachgewiesene Allgemeinsymptome, kann man folgern, dass Kompositkunststoffe systemisch nicht toxisch sind ...“ (Schmalz et al. 2006).6 In diesem Zusammenhang sollte jedoch Folgendes berücksichtigt werden:
- 1. Klinische Untersuchungen liegen anscheinend in der verfügbaren Literatur so gut wie nicht vor (siehe Schmalz et al. 2009).5
- 2. Zur Beurteilung von „Systemischer Toxizität“ werden In-vitro-Tests oder pathohistologische Präparate von Versuchstieren3,5 herangezogen. Da derartige Untersuchungen als nicht direkt auf den Menschen übertragbar gelten, können sie lediglich im Rahmen einer sehr allgemeinen Risikoabschätzung mitberücksichtigt werden.5
In Anbetracht der chemischen Variationsbreite der Komposite im Vergleich zum sehr schlicht strukturierten Amalgam, das dennoch in seiner Wirkung auf den Menschen weiterhin wissenschaftlich kontrovers diskutiert wird, scheint es auch nahezu unmöglich, den um ein Vielfaches komplexeren Metabolismus von Kunststoffmaterialien mit ihren unterschiedlichen Bestandteilen und Strukturen und deren Wirkungen zu erforschen. Trotz dieser Ausgangslage hat sich Reichl (siehe Dental Tribune German Edition 3/12, Reichl: Toxikologie von Zahnkunststoffmaterialien – Was darf ich verwenden?) genau dieses Themas angenommen:
- mit durchaus beunruhigenden Ergebnissen, wie ich meine. Allerdings seien auch diese nicht direkt auf den Menschen übertragbar, da sie „nur auf Zellebene gelten“. „... Das Risiko einer toxikologischen Gefährdung für den Menschen ist heute als sehr gering einzustufen“ (2012).7 Dennoch konstatiert er bei einer steigenden Anzahl von Patienten relevante Nebenwirkungen nach Kompositrestauration, z.B. Atemwegserkrankungen, Ekzeme und anderes7 – jenseits aller toxikologischen Ergebnisse und Bewertungen. Um systemische Wirkungen von Kompositkunststoffen in situ am Menschen untersuchen zu können, bedarf es geeigneter wissenschaftlicher Methoden. Diese stehen – abgesehen von verschiedenen Allergietests – gegenwärtig jedoch nicht zur Verfügung. Infolgedessen können systemische Wirkungen bei Betroffenen auch nicht diagnostiziert werden
- zumindest nicht wissenschaftlich verifizierbar. Da ich nicht in der wissenschaftlichen Forschung, sondern als niedergelassener Zahnarzt tätig bin, kann ich nachfolgend lediglich von meinen Beobachtungen, Erfahrungen und Ergebnissen aus der Praxis berichten und möchte ausdrücklich auf vielfältige Zusammenhänge zwischen Kompositmaterialien und gesundheitlichen Beeinträchtigungen verschiedenster Art hinweisen, die wesentlich häufiger auftreten als es für uns Zahnärzte und unsere Patienten vorstellbar ist.
Fallgeschichte mit Folgen
Auf systemische Wirkungen von Kompositen wurde ich aufmerksam durch einen 15-jährigen Jungen. Sein Zustand: Starke Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Schlappheit und Müdigkeit in ungekanntem Ausmaß, migräneartige Kopfschmerzattacken mit Licht- und Geräuschempfindlichkeit sowie Infektanfälligkeit. In einem Gespräch mit der Mutter entstand die Hypothese, dass die Symptome im Zusammenhang mit seiner Bracketversorgung stehen könnten, denn sie hatten etwa zwei Monate nach Eingliederung begonnen. Aufgrund dieser Hypothese führten wir einen regulationsdiagnostischen kinesiologischen Direkttest an einigen der 28 Klebestellen durch. Das Ergebnis war jeweils eine starke Regulationsstörung – das heißt, das Befestigungskomposit wirkte als starker permanenter Stressfaktor. Nach Entfernung aller Brackets besserte sich die Symptomatik bereits schlagartig auf etwa 50 Prozent des vorherigen Niveaus.
Da nach einigen Wochen keine weitere Besserung eintrat, führte ich den Test noch einmal durch. Ergebnis: Jeder Zahn war noch durch Komposit belastet. In drei Sitzungen wurden anschließend sämtliche noch verbliebenen Kompositreste entfernt, begleitet von ständigen Tests, um die Restbelastung zu minimieren. Das Ergebnis war eine Gesamtbesserung um 80 bis 90 Prozent.
Systemische Wirkungen unterschiedlichster Art
Für mich wurde diese Geschichte zum Impuls, systematisch nach Zusammenhängen zwischen Kompositen und Symptomen jeglicher Art zu fahnden. Zunächst konzentrierte ich mich ausschließlich auf einzelne Füllungskomposite und Befestigungen für keramische Restaurationen. Erst später rückten auch die Befestigungskomposite für Brackets, Retainer, Wurzelstifte und Abutments sowie Versiegelungen, Aufbaumaterialien, ein dualhärten des Wurzelfüllmaterial(!), Desensitizer, „Schutzlacke“, ein Material zur Therapie initialer Karies und lichthärtende Komposite aus der Zahntechnik in den Blick. Im Laufe der letzten sechs Jahre konnten wir unterschiedlichste systemische Wirkungen beobachten, die sich jeweils eindeutig zuordnen ließen (s.u.): Verschiedenste Schmerzsymptomatiken, die meist lokal sehr eng umgrenzt sind, an Kopf, Gesicht, Schulter, Ellbogen, Hand, Rücken, Hüfte, Knie und Fuß, Sensibilitätsstörungen in den Extremitäten („Einschlafen“, Taubheit), inoperable Zyste am Knie, Bein-Ödeme, Engegefühl im Bereich der Brust, Atemnot, Organsymptome an Auge, Herz, Mamma, Prostata und Blase, Hautreaktionen, unterschiedlichste Allergien, verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten, Energiedefizit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, ADS, Schwindel, Übelkeit, menstruelle Dysregulation, Amenorrhoe, Hypertonus und Tachykardie. Eine einzige Kompositrestauration kann auch zugleich (Mit-)Ursache mehrerer Symptome sein – z.B. von Kopf- und verschiedenen Gelenkschmerzen.
Je nach individueller Prädisposition und Immunstatus können Komposite anscheinend zu sehr unterschiedlichen Symptomatiken beitragen bzw. führen – ähnlich einer Virusinfektion, auf die verschiedene Menschen ebenfalls mit sehr unterschiedlichen Symptomen und Verläufen reagieren können. Im Gegensatz zur Virusinfektion, die wir unter Umständen sehr adäquat z.B. durch Fieber selbst erfolgreich therapieren können, verursacht das dauerhaft inkorporierte Komposit permanenten, untherapierbaren Stress an derselben Stelle im Organismus – meist über Jahrzehnte.
Eine weiterführende Hypothese
Auf der Suche nach dem Auslösermaterial oder -bestandteil und Erklärungen für derartig unterschiedliche Reaktionen einzelner Menschen testete ich zunächst nicht inkorporierte Komposite auf ihre regulationseinschränkende Wirkung – mit keinem eindeutigen Ergebnis, wenngleich sich mein Verdacht auf die am Haftverbund beteiligten Materialien zuspitzte. Aufgrund des folgenden Erlebnisses entstand bald eine neue, weiterführende Hypothese: Mehrere UK-Front-Aufbauten eines Patienten testeten zu meiner sehr großen Verwunderung überhaupt nicht stressend – d.h. verträglich, obwohl sie ganz gewiss gebondet waren. Wie sich auf Nachfrage bei der Kollegin in Belgien dann herausstellte, waren dafür nur Materialien verwendet worden, die auch in deutschen Praxen sehr üblich sind. Zur Polymerisation hatte sie jedoch ihren „geliebten“ Argon-Laser eingesetzt, den sie bei ihren USA-Aufenthalten zu schätzen gelernt hatte. Ihre Antwortmail führte dann zu der Hypothese, dass der gute Verträglichkeitsgrad dieser Aufbauten mit einem hohen Polymerisationsgrad korrelieren könnte. Denn je höher der Polymerisationsgrad, desto härter und verträglicher ist bekanntlich das Material.8,9,10
Zunächst experimentierte ich mit Hochleistungs-LEDs und testete zunächst standardisierte, extraoral angefertigte, unterschiedlich lang und oft polymerisierte Proben verschiedener Materialien auf ihre regulationseinschränkende Wirkung – z.B zehnmal 20 Sekunden. Zu meiner sehr großen Überraschung ergab sich jeweils eine eindeutige Korrelation zwischen der Summe aller Belichtungsintervalle und der Regulationsfähigkeit bzw. Verträglichkeit: Je öfter belichtet wurde, desto besser war die Regulationsfähigkeit; durch (sehr) häufige Belichtung konnte letztlich jedes Material in einen Zustand überführt werden, der bei allen Testpersonen zu keinerlei Regulationseinschränkung mehr führte. Das heißt nach meinem Verständnis: Dieses Material wurde durch wiederholte Belichtungsintervalle verträglich. Da ich in den letzten sechs Jahren kein Material gefunden habe, auf das dieses Ergebnis nicht zugetroffen hätte, wage ich bis auf Weiteres anzunehmen, dass lichthärtende Komposite durch genügend häufige Belichtungsintervalle (plus Pausenintervalle) von allen Seiten (!) in einen nicht mehr stressenden, d.h. verträglichen Zustand überführt werden können (s.u.). Doch was heißt „genügend häufig“? Diese Frage lässt sich nicht mit einer einzelnen, allgemein gültigen Angabe beantworten, denn der Polymerisationsgrad eines Komposits ist von diversen Faktoren abhängig:
Leistung und anderen physikalischen Parametern des Polymerisationsgeräts, Belichtungsdauer, Belichtungshäufigkeit, Abstand der Lichtquelle zum Material, Lichteinfallswinkel, Material, Schichtdicke, Farbe, Transluzenz und – das Bonding betreffend – der Porosität des Dentins, Lichtabsorption der Keramik bei indirekten Versorgungen. Auf die üblicherweise empfohlene Belichtungszeit von 20 Sekunden oder womöglich kürzer dürfen wir uns also keinesfalls verlassen. Sie kann nur als unzureichend und irreführend gelten, da keinerlei Differenzierung stattfindet und wichtige physikalische Faktoren während der Verarbeitung unberücksichtigt bleiben (siehe auch unten). 40 Sekunden Belichtungszeit als Goldstandard?
Nach meinen Testergebnissen und Erfahrungen sind mit einem Polymerisationsgerät von 1.000 mW/cm² effektive Leistung (Herstellerangabe 1.500 mW/cm²) je nach Situation Gesamtpolymerisationszeiten von 60 bis 240 Sekunden (!) oder mehr notwendig, um eine Schicht eines Füllungskomposits herzustellen, die die Regulation nicht einschränkt. Anmerkung: Diese Belichtungszeiten sind zu verstehen als Summe von üblichen Belichtungsintervallen wie 20 oder 40 Sekunden aus derselben Richtung, z.B. viermal 40 Sekunden ist gleich 160 Sekunden Gesamtpolymerisationszeit (GPZ) von occlusal. Nach jeder Belichtung folgt eine Pause. Die Summe von Belichtungs- und Pausenintervallen wird als Mehrfachpolymerisation (MfP) bezeichnet (s.u.).
Bondings und Befestigungskomposite für Keramikkronen, -inlays etc. benötigen je nach Situation, Material, Abstand zur LED etc. 140 Sekunden pro Fläche oder (wesentlich) mehr. Sogar für die oberste 2-mm-Schicht einer üblichen Nano-Hybrid-Kompositfüllung sind im Durchschnitt 100 bis 150 Sekunden Gesamtpolymerisationszeit erforderlich, für eine tiefer liegende Schicht entsprechend länger. Werden diese Zeiten unterschritten, können unter Umständen gesundheitliche Beeinträchtigungen die Folge sein.
Diagnostik der Zusammenhänge
Warum behaupte ich, dass die üblichen relativ kurzen Belichtungszeiten, die ja aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen als Empfehlung gelten, im Sinne der Gesundheit des Patienten unzureichend sind? Aus zwei Gründen:
- 1. Die Ergebnisse der von mir durchgeführten regulationsdiagnostischen kinesiologischen Tests und auf deren Grundlage:
- 2. eine sich vielfach wiederholende Erfahrung: Wenn aufgrund eines solchen Tests gezielt bestimmte inkorporierte Komposite so oft nach den Regeln der MfP nachbelichtet werden, bis sie im Test nicht mehr als Stressfaktor feststellbar sind, ist eine sofortige oder zeitnahe Besserung der Symptomatik bis hin zur vollständigen Remission festzustellen.
Mithilfe des sogenannten Zwei-Punkt-Testes ist es kein Problem, Zusammenhänge zu diagnostizieren – z.B. zwischen Rücken- oder Knieschmerzen o.ä. und einem bestimmten Zahn-/Füllungsstörfeld, was meines Wissens mit keinem anderen diagnostischen Verfahren derartig einfach und zuverlässig möglich ist. Dies erlaubt, sehr zielgerichtet vorzugehen und die mit dem Symptom im Zusammenhang stehende(n) Füllung(en) oder Kleber – z.B. für Keramik-Inlays – zu therapieren.
Anhand eines „schlichten“ Beispiels möchte ich dieses Vorgehen erläutern. „Schlicht“ deshalb, weil die Patientin nur ein einziges Mal in meiner Praxis war. Sie kam wegen Schulterschmerzen links, die sie seit eineinhalb Jahren als professionelle Flötistin sehr plagten, und an denen offenbar außer den Kompositen keine weiteren Ursachenfaktoren beteiligt waren. Orthopädische und physiotherapeutische Maßnahmen hatten keine Besserung erbracht. Nach Herstellung aller Voraussetzungen für den Test zeigte sich am maximalen Schmerzpunkt der Schulter eine Regulationsstörung durch Methacrylat. Daraufhin wurde jeder einzelne Zahn im linken Ober- und Unterkiefer mit dem Zwei-Punkt-Test auf einen möglichen Zusammenhang zum Schmerzpunkt der linken Schulter überprüft. Ergebnis: 25 und 26 wiesen einen Zusammenhang auf. Wie sich dann durch Inspektion herausstellte, waren beide Zähne mit Keramik-Inlays versorgt, die seit zehn Jahren problemlos vertragen wurden. Unser Test hatte jedoch eine Beteiligung eben dieser beiden Inlays – genauer gesagt ihres methacrylathaltigen Befestigungskomposits – am Schulterschmerz der Patientin ergeben.
Therapie inkorporierter „unverträglicher“ Komposite
Da wir inzwischen entdeckt hatten, dass sich diese Materialien unabhängig von ihrem Alter durch genügend häufige Wiederholungen von üblichen Belichtungsintervallen in einen biokompatiblen Zustand versetzen lassen, bestand die Therapie genau darin: Genügend häufiges Nachhärten des Komposits von allen Seiten dieser beiden Zähne unter Berücksichtigung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen, um die Pulpa nicht zu überhitzen (s.u.). Als beide Zähne sich im Test schließlich vollständig störungsfrei zeigten, war die Therapie beendet. „Ganz zufällig“ war ab diesem Moment auch der Schulterschmerz vollständig verschwunden. Offenbar war der Zusammenhang zwischen Schulterschmerz und Befestigungskompositen doch sehr real, obwohl er weder für die Patientin spürbar, noch vom Orthopäden oder behandelnden Zahnarzt zu diagnostizieren war.
In der Toxikologie gilt: „Nur resorbierte Substanzen können Schadwirkung auslösen.“6 Betrachten wir auch ein solches Phänomen – wie soeben beschrieben – unter dieser Prämisse, sind wir jedoch außerstande, es zu erklären. Wie könnte an einem so entfernten Ort wie Schulter, Knie, Fuß o.ä. durch Nachhärten von Kompositen in Zähnen eine toxische Belastung sekundenschnell reduziert und dadurch sofortige Schmerzfreiheit hervorgerufen werden? Offenbar können Komposite auch jenseits toxikologischer Grundlagen systemische Wirkungen entfalten, die sich gegenwärtig einer wissenschaftlichen Erklärung entziehen. Machen wir uns jedoch die Denkweise der Akupunktur zueigen, verstehen wir den Schmerz als Störung des „Energieflusses“, die dann durch Nachhärten aufgehoben werden kann. Allerdings ist der Begriff der Energie in diesem Sinn in unserer westlichen Medizin nicht bekannt, was die wissenschaftliche Erforschung derartiger systemischer, aber eben nicht toxischer Wirkungen von Kompositen zusätzlich erschweren dürfte – mit nicht abschätzbaren Folgen.
Polymerisation und systemische Wirkungen
Als beobachtender Praktiker wage ich aus dieser Art von Ergebnissen und Erlebnissen, die sich im Laufe der letzten sechs Jahre in ähnlicher Weise wie soeben exemplarisch beschrieben vielfältig wiederholt haben, zu folgern, dass:
- 1. Kompositkunststoffe wesentlich häufiger systemische Wirkungen entfalten (können) als bisher angenommen,
- 2. für die Biokompatibilität von lichthärtenden Kompositen primär anscheinend nicht ihre Zusammensetzung, sondern ihre Verarbeitung die entscheidende Rolle spielt,
- 3. sie sich sogar im Nachhinein durch übliche 20-, 30- oder 40-Sekunden-Intervalle durch schonende Mehrfachpolymerisation (MfP) in einen biokompatiblen Zustand überführen lassen (siehe aber Abschnitt „Flowables“),
- 4. einem sehr hohen Polymerisationsgrad wahrscheinlich eine immense Bedeutung zukommt,
- 5. zu wenig Polymerisation zu Symptomatiken beitragen kann, die sich einer herkömmlichen Diagnostik vollständigentziehen.
Des Weiteren zeigen derartige, sekundenschnelle, anhaltende Schmerzremissionen auf eindrucksvolle Weise die Möglichkeiten einer präzisen Diagnostik auf. Seit ich ergänzend mit einem Polarisationsfilter und einem Signalverstärker arbeite, erfreue ich mich einer neuen Dimension der Präzision kinesiologischer Testung. Nach vielen Jahren Suche nach einem geeigneten diagnostischen Verfahren ist mir die kinesiologische Regulationsdiagnostik nach Klinghardt (RD) unter Verwendung dieser beiden Hilfsmittel zu einem wichtigen zusätzlichen, verlässlichen und sehr hilfreichen Instrument meiner zahnärztlichen Diagnostik geworden, mit dem sich äußerst differenzierte Aussagen treffen lassen – mit daraus resultierenden sehr effektiven Therapien.
Bei komplexen Symptomatiken wie z.B. vegetativen Störungen lässt sich der Zusammenhang mit unzureichend gehärteten Kompositen leider nicht in der „schlichten“ Weise wie bei Schulterschmerzen eindeutig testen. Zeigen Herz, Vagus oder Hypophyse im Test eine Methacrylatbelastung, kann dieser Belastungsfaktor nur als Hinweis gelten. An solchen Symptomatiken können wenige, aber auch sehr viele Komposite beteiligt sein. So kann bereits durch Nachhärtung einer einzigen Kompositfüllung der ständige, leichte Schwindel verschwunden sein oder sich das Energieniveau erst nach Nachhärtung von über zehn Kompositen deutlich und nachhaltig verbessern.
Einige Fallbeispiele
Eine Patientin, die seit drei Jahren mit Tachykardiesymptomen lebte, berichtete bereits nach der ersten Sitzung, in der wir eine kleine, wahrscheinlich mit „Flowable“ versorgte Füllung sehr oft nachgehärtet hatten, eine spürbare Besserung, und nach der zweiten, in der zwei weitere Füllungen nachgehärtet wurden, eine vollständige Remission dieses Symptoms, während sich ihre Nervosität, ihr Schwindel und ihre Schlafstörungen immerhin um etwa 70 Prozent besserten.
Eine 75-jährige Patientin, deren Schulterschmerzen durch Nachhärtung von Kompositen bereits erfolgreich hatten therapiert werden können, wendete sich erneut an meine Praxis – diesmal wegen unmittelbar nach zahnärztlicher Behandlung in ihrem Heimatort aufgetretener Rücken- und Hüftbeschwerden. Sie war dort mit zwei kleinen Kompositfüllungen versorgt worden. Sofort nach mehrfacher Nachhärtung dieser beiden Füllungen war es ihr möglich, schmerzfrei zum Wasserglas zu greifen, und auch auf dem Weg zum Bahnhof verspürte sie keinerlei schmerzhafte Beeinträchtigung mehr. Eine andere Patientin hatte das Klavierspielen wegen Schmerzen im Handgelenk aufgeben müssen. Inzwischen erfreut sie sich daran, es wieder zu können – als Ergebnis der sechsten Nachhärtesitzung für eine relativ kleine Füllung bei 46.
Diese kleine Auswahl an Beispielen möge an dieser Stelle genügen, um die Unterschiedlichkeit der systemischen Wirkungen zu verdeutlichen, die von Kompositen ausgehen können. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, bei therapieresistenten chronischen Beschwerden spätestens dann auch an eine mögliche ursächliche Beteiligung von Kompositen zu denken, wenn sie im Missverhältnis zur Lebenssituation stehen. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche, die z.B. über Kopf- oder Knieschmerzen klagen, Stichwort: Versiegelungen. Weitere Fallbeispiele finden Sie unter: www.dr-just-neiss.de/fallbeispiele. Trotz aller Unterschiedlichkeit der Fälle und Verläufe treten die beobachteten Wirkungen relativ häufig bereits in den ersten sechs Monaten nach zahnärztlicher Komposittherapie auf, manchmal sogar am selben Tag.
Die systemischen Wirkungen können jedoch auch erst Jahre später manifest werden. An dieser Stelle sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand vorsichtshalber zunächst nur 60 bis maximal 100 Sekunden pro Sitzung nachgehärtet werden sollte, da andernfalls eine Verschlechterung des Gesamtbefindens sonst nicht auszuschließen ist. Schauen Sie dazu bitte auf: www.dr-just-neiss.de/nachhaerten
Hier gibt's die vollständige Literaturliste