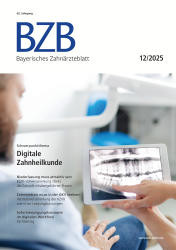Branchenmeldungen 27.05.2015
Neuer SFB Transregio erforscht Schutzmechanismen der Haut
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Heidelberg, Mainz und Tübingen haben sich erfolgreich um die Einrichtung eines Sonderforschungsbereichs Transregio (SFB TR) beworben. Der SFB TR 156 „Die Haut als Sensor und Initiator von lokalen und systemischen Immunreaktionen“ wird ab 1. Juli von der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit mehr als zwei Millionen Euro für vier Jahre gefördert. Die Tübinger Wissenschaftler um Professor Martin Röcken, Ärztlicher Direktor der Universitäts-Hautklinik, stellen insgesamt acht der 19 SFB-Forschungsgruppen, darunter ein in Mainz und Tübingen angesiedeltes Gemeinschaftsprojekt.
Die Haut unseres Körpers hat ein komplexes Schutzsystem entwickelt, das sich als mechanische und immunologische Barriere zur Umwelt etabliert hat. Dazu gehören auch das Nerven- und Gefäßsystem sowie die Haut-drainierenden Lymphknoten, über die das Immunsystem der Haut mit dem Immunsystem des gesamten Körpers kommuniziert. Im neuen Sonderforschungsbereich Transregio untersuchen Wissenschaftler aus der Dermatologie zusammen mit Immunologen und Mikrobiologen die molekularen und zellulären Interaktionen der Haut mit ihrer Umwelt. Erforscht wird, wie das zelluläre Mikromilieu und Wechselwirkungen mit Mikroorganismen auf der Haut krankmachende Mechanismen in Gang setzen, die entzündliche Hauterkrankungen wie atopische Dermatitis, Psoriasis oder Sklerodermie verursachen.
Die in Tübingen angesiedelten Teilprojekte erforschen insbesondere die
Interaktion von Infektionserregern mit der Haut, die frühen Phasen der
Entzündungsreaktion sowie Schutzmechanismen, wie die Verdickung der
Haut, über die sie sich eine Barriere gegen schädliche Reize aufbaut.
Zudem untersuchen die Tübinger Projekte den natürlichen Umgang der Haut
mit ihrer Umwelt, die Mechanismen, die das Gleichgewicht der Haut beim
Umgang mit ihrer Umwelt etablieren, sowie die frühen Alarmsignale über
die Systemreaktionen ausgelöst, reguliert und gesteuert werden, wenn es
zur Verletzung dieses Gleichgewichtes kommt. Ziel des SFB ist es,
gemeinsam neue Therapien für Krankheiten wie Ekzeme, Psoriasis oder
Sklerodermien zu entwickeln, wie es Mitarbeitern der
Universitäts-Hautklinik bereits in der Vergangenheit wiederholt gelungen
ist.
Die Ausbreitung von Wellen verstehen
An einem weiteren neuen Sonderforschungsbereich, SFB 1173
„Wellenphänomene: Analysis und Numerik“, ist Professor Christian Lubich
vom Institut für Mathematik der Universität Tübingen beteiligt. Wellen
sind überall, ob bei der Ausbreitung von Licht oder Schall, beim
Herzschlag oder in der modernen Kommunikationstechnik. Mit
Wissenschaftlern des Karlsruher Instituts für Technologie
(Sprecherhochschule) und der Universität Stuttgart soll hier die die
Ausbreitung von Wellen unter realitätsnahen Bedingungen analytisch
verstanden, numerisch simuliert und letztendlich auch gesteuert werden.
Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf charakteristische
Wellenphänomene wie das Auftreten von stehenden und wandernden Wellen
oder Wellenfronten, Oszillationen und Resonanzen, Wellenführung sowie
Reflexion, Brechung und Streuung von Wellen. Die Arbeitsgruppe von
Professor Christian Lubich am Mathematischen Institut entwickelt und
untersucht numerische Verfahren zur Berechnung von Wellenphänomenen,
insbesondere die stabile Kopplung von Verfahren für Außen- und
Innengebiete der Ausbreitung von akustischen, elektromagnetischen und
elastischen Wellen. In dem SFB arbeiten Mathematiker aus den Bereichen
Analysis und Numerik zusammen, die Schnittstellen zur Anwendung
untersuchen Forscher aus der Optik und Photonik, der Biomedizintechnik
und der Angewandten Geophysik.
DFG verlängert erfolgreiche Forschungsverbünde
Nach positiver Begutachtung wurde der Tübinger SFB 923 „Bedrohte
Ordnungen“ (Sprecher Professor Ewald Frie) um weitere vier Jahre
verlängert. In dem geisteswissenschaftlichen Verbundprojekt befassen
sich Historiker, Politikwissenschaftler, Soziologen, Juristen,
Medienwissenschaftler, Philologen, Theologen, Kulturwissenschaftler,
Ethnologen und Mediziner mit historischen und aktuellen
Krisensituationen, um einen Beitrag zu gesellschaftlichen Debatten zu
liefern. Mit ihren Untersuchungen wollen die Wissenschaftler das
alarmistische Reden über Krisen historisieren, nach Regelhaftigkeiten in
Zeiten schnellen sozialen Wandels suchen und die Vergleichbarkeit
verschiedener Zeiten und Räume in Geschichte und Gegenwart diskutieren.
In der zweiten Förderphase wird der SFB den Fokus auf die Formen des Umgangs mit Bedrohungen richten; im Zentrum der Untersuchungen wird dementsprechend die Frage stehen, wie in sozialen Gruppen und Gesellschaften, die hohem Stress ausgesetzt sind, der Prozess des re-ordering abläuft. (Homepage: http://www.uni-tuebingen.de/de/24861)
Der SFB 766 „Die bakterielle Zellhülle: Struktur, Funktion und Schnittstelle bei der Infektion“ (Sprecher Professor Wolfgang Wohlleben; Ko-Koordinator Professor Andreas Peschel) erhält Mittel für eine dritte Förderperiode. In diesem Forschungsverbund erforschen Wissenschaftler aus den Bereichen Biologie, Biochemie, Pharmazie, Chemie, Informatik und Medizinischer Mikrobiologie den komplizierten Aufbau der Bakterien-Zellhülle, die eine entscheidende Rolle bei Infektionsprozessen spielt, sowie deren Rolle bei der Resistenzentwicklung gegen Antibiotika.
Die bakterielle Zellhülle ist unverzichtbar für das Wachstum der
Bakterienzelle und deren Form. Sie bestimmt die Aufnahme von
lebenswichtigen Nährstoffen aber auch von Medikamenten. Weil sie auch
als Barriere für bestimmte Substanzen dient, ist sie ein entscheidender
Faktor für die Empfindlichkeit eines Bakteriums gegen Antibiotika. Die
zunehmende Gefahr durch resistente Krankheitserreger macht ihre
Erforschung dringlicher denn je: Die Untersuchungen des SFB konnten
bereits wesentlich zur Einschätzung ihrer Rolle beitragen. Ziel ist es,
das Verständnis bakterieller Lebensprozesse und ihrer krank machenden
Wirkung zu vertiefen und dazu beizutragen, neue antibakterielle
Substanzen, Impfstoffe und Diagnostika zur Bekämpfung von Infektionen zu
entwickeln. Seit 2007 hat sich der Verbund zu einem interdisziplinären
Netzwerk aus renommierten wie auch jungen Wissenschaftlern entwickelt,
das heute aus 22 Teilprojekten und etwa 80 Mitarbeitern besteht.
(Homepage: http://www.sfb766.uni-tuebingen.de/ )
Quelle: idw online/Eberhard Karls Universität Tübingen