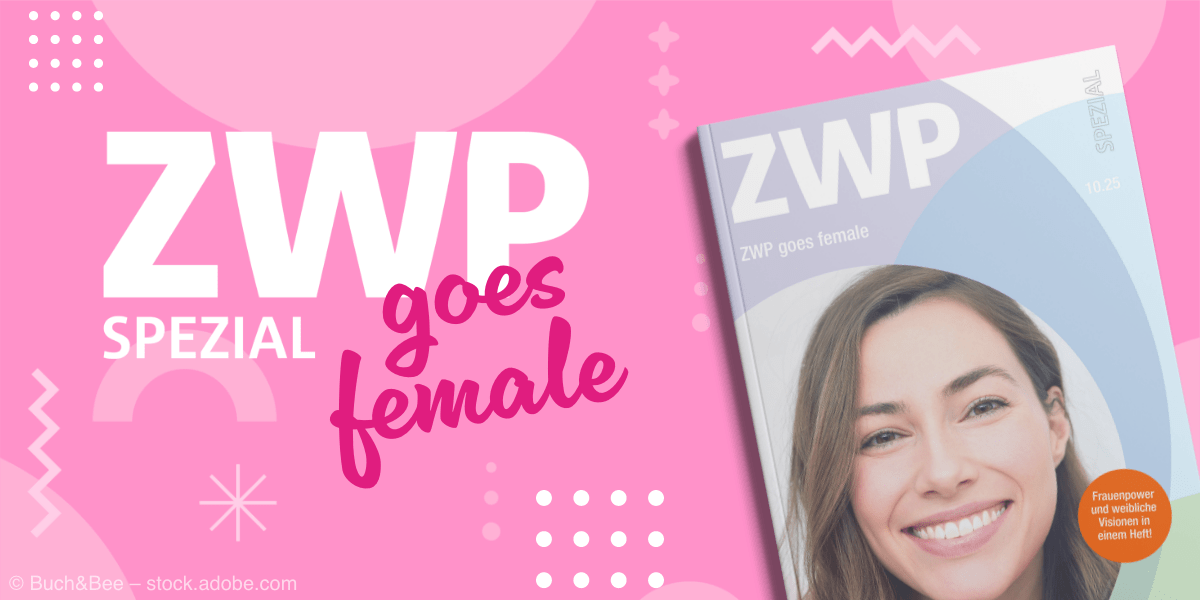Wissenschaft und Forschung 01.10.2025
Die Wechseljahre des Mannes? Ein Blick auf das verborgene Hormontief
share
Stellen Sie sich vor, Ihr bester Kollege, Ihr Partner oder Ihr Vater verliert von einem Tag auf den anderen seinen "Drive". Impulse im Meeting bleiben aus, zu Hause herrscht plötzlich merkwürdiger Stillstand, und die Trägheit klebt förmlich an jeder Unterhaltung. Müdigkeit, Konzentrationslöcher und eine ungewohnte Dünnhäutigkeit. In unserer Leistungsgesellschaft schreien solche Symptome förmlich nach der Schublade „Burnout“. Wer käme dabei schon auf Hormone?
Über die Menopause wissen wir inzwischen ziemlich viel. Hitzewallungen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, kognitive Einbußen sind längst kein Tabu mehr. Aber ihr männliches Gegenstück, die sogenannte Andropause, fristet immer noch ein Schattendasein. Vielleicht auch, weil der Begriff selbst Fachleuten missfällt. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie erklärt nüchtern, dass es beim Mann keinen abrupten hormonellen Einschnitt gibt, sondern eher ein leises, allmähliches Nachlassen (DGE 2025).
Testosteron, das Hormon, das Männer kraftvoll fühlen lässt, verabschiedet sich nicht mit einem lauten Knall, sondern verändert sich leise und unaufdringlich. Ab dem mittleren Erwachsenenalter beginnen die Werte bei vielen Männern allmählich zu sinken, manchmal kaum wahrnehmbar, manchmal deutlich spürbar. Wissenschaftliche Untersuchungen sprechen von einem möglichen Rückgang von ungefähr einem Prozent pro Jahr (Cheng et al. 2024, Reprod Biol Endocrinol), doch andere Analysen zeigen, dass die Durchschnittswerte erstaunlich stabil bleiben, während die Unterschiede zwischen einzelnen Männern immer größer werden, was deutlich macht, dass die Studienlage nicht in allen Punkten einheitlich ist und Spielräume für Interpretation lässt (Kelsey et al. 2014, PLoS One). Für den einen bedeutet das kaum eine spürbare Veränderung, der andere merkt schon mit Anfang fünfzig, dass die Erholung nach einem langen Arbeitstag mehr Zeit braucht, dass die Kondition nicht mehr so selbstverständlich trägt und dass die Lust auf Sexualität seltener aufkommt.
Und diese Symptome bleiben bei weitem nicht im Schlafzimmer. Europäische Forscher zeigten bereits vor Jahren, dass sinkende Testosteronwerte nicht nur sexuelle Funktionen beeinträchtigen, sondern auch Muskelkraft und Knochendichte schwinden lassen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen (Ward et al. 2011, Osteoporos Int; Kirby et al. 2019, Eur Cardiol Rev).
Diese hormonelle Schieflage treibt Männer nun nicht zwingend in den Krankenstand. Sie sitzen zwar zuverlässig am Arbeitsplatz, doch gedanklich schleicht sich Leerlauf ein, ein unsichtbarer Produktivitätskiller mit messbaren Folgen. Forscher nennen dieses Phänomen "Präsentismus" (Shirakawa et al. 2025, Am J Mens Health; Okawara et al. 2025, Industrial Health). Gereiztheit, Rückzug und nachlassende Belastbarkeit wirken zudem auf das soziale Miteinander, belasten Teams und Beziehungen, ohne dass jemand den wahren Hintergrund erkennt. Zahnärzte, die im Praxisalltag gewohnt sind, alles souverän zu managen, erleben diese Entwicklung vielleicht auch. Der Chef, früher zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, reagiert plötzlich dünnhäutig, wirkt ausgelaugt und zieht sich öfter zurück. Die Diagnose scheint dann klar: Burnout! Hormone? Auf gar keinen Fall.
Studien fassen Testosteronmangel als ein Syndrom zusammen, das nicht nur mit Libidoverlust, sondern auch mit erschöpfter Stimmung, Motivationsverlust, Fatigue und emotionalen Schwankungen einhergeht (Määttänen et al. 2021, Compr Psychoneuroendocrinol; Indirli et al. 2023, Front Endocrinol). In Interviews berichten betroffene Männer immer wieder, dass ihre Beschwerden zunächst als Stress oder Alterserscheinung abgetan wurden, mit entsprechender Frustration. Wie Männer im Allgemeinen auf solche psychischen Zuschreibungen reagieren, ist jedoch kaum erforscht. Systematische Studien dazu fehlen. Hier liegt eine erkennbare Forschungslücke.
Was hilft also wirklich? Sicher keine frei verkäuflichen „Testosteron-Booster“, wie die DGE eindringlich warnt (DGE 2025). Denn diese bringen oft mehr Risiken als Nutzen. Stattdessen empfehlen Endokrinologen eine gründliche Hormon-Diagnostik. Als Soforthilfe gelten Bewegung, gesunde Ernährung und erholsamer Schlaf. Studien aus den USA zeigen zudem, dass eine ärztlich begleitete Hormontherapie Energie und Libido verbessern kann (Barone et al. 2022, Int J Mol Sci), doch langfristige Untersuchungen zur Sicherheit fehlen bislang noch. Qualitative Arbeiten berichten außerdem, dass Männer beim Zugang zu solcher Therapie oft an Versorgungshürden stoßen (Liu et al. 2025, Preprint).
Warum Frauengesundheit ohne Männerperspektive unvollständig bleibt
Nun könnte man fragen, warum sich ausgerechnet ein Supplement, das sich vorrangig mit dem Thema Frauen beschäftigt, der Männerperspektive öffnen sollte. Ganz einfach: weil hormonelle Umbrüche keine Solo-Angelegenheit sind. Partnerschaften, Familien und Teams erleben hormonelle Umbrüche gemeinsam. Wenn die Chefin gerade mitten in der Menopause steckt und ihr Partner parallel mit unentdecktem Testosteronmangel kämpft, entstehen Spannungen, die vermeidbar wären. Wer beide Seiten versteht, hat einen klareren Blick auf gemeinsame Herausforderungen. Dann lässt sich offen darüber sprechen, wer in schwierigen Phasen welche Unterstützung braucht. Frauen haben längst verstanden, wie wichtig Offenheit bei hormonellen Veränderungen ist. Vielleicht ist es Zeit, dass auch Männer sich Raum nehmen für das, was in ihrem Körper passiert. Ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz erfordert jedenfalls den Blick auf beide Seiten. Denn hormonelle Balance kennt keine Geschlechtergrenze.
Eine Literaturliste steht hier zum Download bereit.