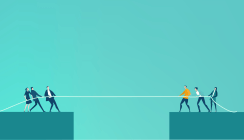Praxismanagement 10.03.2025
Schweigen in der Führung: Sinnvoll oder Sackgasse?
share
Wir kommunizieren jeden Tag mit unseren Kollegen. Unter Kommunikation verstehen wir dabei das Sprechen, das Hören und alle anderen Formen des Austauschs zwischen Kolleg/-innen. Von dem Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick stammt die Aussage: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Menschen tauschen immer Informationen aus, wenn sie in irgendeiner Beziehung zueinanderstehen. Dies kann über Gesten, Mimik, Handlungen geschehen, aber auch durch Sprache – oder sogar durch Schweigen. All diese Ausdrucksformen prägen und bestimmen unsere Beziehungen.
Gerade das Schweigen spielt in vielen Beziehungen eine besondere Rolle – sei es zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden oder zwischen Kolleg/-innen. Schweigen kann in bestimmten Momenten wertvoll sein: etwa, wenn man unsicher ist, ob eine Bemerkung angebracht ist, oder wenn man zunächst über die Situation nachdenken möchte, bevor man sich äußert. Solch reflektiertes Schweigen bereitet oft ein späteres Gespräch vor. Bleibt dieses Gespräch jedoch aus, bekommt Schweigen eine ganz andere Bedeutung. Genau um diese Form des Schweigens soll es im Folgenden gehen.
Das Schweigen kann viele Gründe haben. Es ist alltäglich, dass man sich zu dem Verhalten eines Mitarbeiters äußern möchte, aber die Zeit dazu fehlt, weil noch viele andere Dinge anliegen. Ist dies häufiger der Fall, kann es sein, dass man grundsätzlich Angst oder Unlust auf das Gespräch verspürt. Dann entwickelt es den Charakter eines Weglaufens vor sich selbst. Möglicherweise vergisst man in den nächsten Tagen den Anlass und damit auch die Notwendigkeit des Gesprächs. Handelt es sich um ein negatives Thema, bleibt zwar ein unangenehmes Gefühl zurück, doch die konkrete Situation verblasst allmählich in der Erinnerung. Findet das Gespräch dann verspätet statt, fällt es schwer, die eigenen Gefühle oder Vorwürfe klar zu formulieren. Ohne konkrete Beispiele wirken die Aussagen unbegründet, was Unsicherheit aufseiten der Führungskraft auslösen kann. Für den Mitarbeiter ergibt sich daraus verständlicherweise der Einwand: „Das stimmt doch gar nicht.“
Schweigen spielt in der Führungsarbeit auch dann eine Rolle, wenn das Verhalten eines Mitarbeiters oder Kollegen als gut oder zufriedenstellend wahrgenommen wird. Oft freut man sich innerlich darüber, äußert dies jedoch nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig: Man hat vielleicht gerade keine Zeit, denkt, dass positives Verhalten selbstverständlich ist, oder geht davon aus, dass es keiner weiteren Erwähnung bedarf.
Schweigen tritt aber auch in schwierigen Situationen auf – beispielsweise, wenn man vor Wut nichts sagen kann oder aus Angst, die Situation könnte eskalieren. Man schweigt, um Kontrolle zu bewahren, während man innerlich kocht. In solchen Situationen wird der Unmut nonverbal ausgedrückt: durch reduzierte Gespräche, eine distanzierte Begrüßung oder ein bewusstes Verlassen des Raumes. Innerlich rechtfertigt man dieses Verhalten mit Gedanken wie: „Ich bin enttäuscht und zeige es ihm. Er wird schon merken, dass ich mit seiner Handlung nicht einverstanden bin.“
Wie nehmen die betroffenen Mitarbeiter dieses Schweigen wahr?
Welche Folgen kann es haben, wenn Führungskräfte in bestimmten Situationen schweigen? Hat ein Mitarbeitender etwas gesagt oder getan, das der Führungskraft missfällt, führt Schweigen selten zu einer Lösung. Oft gehen Führungskräfte davon aus, dass ihre Missstimmung auch ohne Worte deutlich wird – und tatsächlich merkt der Mitarbeitende in der Regel, dass etwas nicht stimmt. Doch er bleibt im Unklaren darüber, was genau der Grund für den Ärger ist. Diese Unsicherheit führt dazu, dass der Mitarbeitende zu grübeln beginnt und versucht, den Auslöser zu ergründen. Häufig verstärkt diese innere Unruhe seine Unsicherheit, was wiederum die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erhöht. In der Folge beobachtet der Mitarbeitende die Führungskraft besonders genau, um aus dem Verhalten Rückschlüsse zu ziehen. Dabei malt sich der Mitarbeiter alle möglichen Szenarien aus – jedoch kommt er nur selten auf die tatsächliche Ursache. Dieses Grübeln raubt Zeit und Energie – diese Ressourcen könnte er besser der Praxis zur Verfügung stellen, wenn es ein offenes Gespräch geben würde.
Schweigen ist zudem problematisch, wenn der Mitarbeiter etwas richtig gemacht hat, was zuvor falsch war. Ohne Rückmeldung ist er unsicher, ob seine Handlung tatsächlich korrekt war. Diese Unsicherheit bindet ebenfalls wertvolle Ressourcen. Nonverbale Signale wie ein Nicken oder Lächeln der Führungskraft können leicht übersehen werden, insbesondere wenn der Mitarbeiter neu im Team ist oder die Führungskraft noch nicht gut kennt.
Gerade bei neuen Mitarbeitern ist es entscheidend, durch konstruktives Feedback Orientierung zu geben. Sie sind die Abläufe aus ihrer alten Praxis gewohnt und müssen mit Prozessen der neuen Praxis vertraut gemacht werden. Eine positive Reaktion auf richtiges Verhalten hilft ihnen, sich schneller zu integrieren und Sicherheit zu gewinnen.
Tipps für effektive und nachhaltige Mitarbeiterkommunikation

Schweigen ist in der Führungsarbeit selten hilfreich. Es bindet unnötig Ressourcen wie Grübeln und mutmaßliche Erklärungsversuche bei den Beteiligten. Das eigentliche Problem am Schweigen liegt jedoch darin, dass es den Aufbau einer positiven sozialen Beziehung und damit von Vertrauen verhindert. Nur durch offene, klare und wertschätzende Kommunikation, die auch den Austausch gegenseitiger Erwartungen – sowohl positiver als auch negativer – einschließt, können alle Beteiligten ein besseres Verständnis füreinander entwickeln. Dies ermöglicht, das eigene Denken zu reflektieren, die Perspektive des anderen nachzuvollziehen und so eine stabile emotionale Verbindung aufzubauen. Mitarbeiter kündigen nicht, weil ihnen gesagt wird, was von ihnen erwartet wird, oder weil sie Feedback erhalten, wie sie etwas besser machen können. Sie kündigen, wenn sie im Unklaren gelassen werden und die Führungskraft schließlich ihre aufgestaute Frustration in Form von Vorwürfen über die Fehler der letzten drei Monate äußert. Sie kündigen, weil sie zwar schnell auf Fehler hingewiesen werden – oft sogar in Gegenwart von Patienten –, aber positives Feedback nur selten erhalten. Sie gehen, wenn sie in den ersten Monaten vieles selbst hinterfragen müssen und sich dadurch allein gelassen und unsicher fühlen.
Es lohnt sich daher:
- Neuen Mitarbeitern positive Rückmeldungen zu geben, damit sie ihre Stärken kennen und sich sicher fühlen.
- Allen Mitarbeitern positives Feedback zu geben, wenn sie etwas besonders gut gemacht haben.
- Sich selbst zu überprüfen, ob man sowohl negative als auch positive Rückmeldungen gibt.
- Sich zu überlegen, warum man schweigt und welches Muster (Thema, Mitarbeiter, Zeitpunkt) dahinterliegt, um dieses zu durchbrechen.
- Die Mitarbeiter an den eigenen Gedanken und Vorstellungen teilhaben zu lassen, damit diese im Sinne der Praxis handeln.
Dieser Beitrag ist im PJ Prophylaxe Journal erschienen.