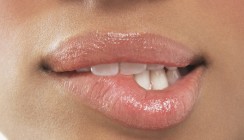Psychologie 06.01.2015
Traumatisierte Patienten
share
Die langjährige ZWP-Autorin Dr. Lea Höfel beantwortet regelmäßig Leserfragen im Bereich Psychologie. Diesmal wird über Patienten geschrieben, die traumatische Erlebnisse hatten.
Anfrage: Wir haben in unserer Praxis durch Empfehlungen und Kontakte inzwischen einen großen Zulauf an Patienten, die durch Traumata wie Unfälle oder häusliche Gewalt Schreckliches erfahren haben. Bei den medizinischen und zahnmedizinischen Rekonstruktionen und ästhetischen Maßnahmen erzielen wir große Erfolge. Was uns als Team jedoch zunehmend mehr belastet sind die psychischen Themen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Die Geschichten der Patienten sind schon an sich schwer zu verarbeiten; mehr Schwierigkeiten haben wir ehrlicherweise mit den Emotionen, die unerwartet zwischen Trauer, Panik, Euphorie und Resignation schwanken können. Gibt es Anhaltspunkte, welche Phasen die Patienten durchmachen und wie wir auf sie eingehen sollen? Das würde dem Team mehr Sicherheit geben, denn oft zweifeln die Mitarbeiterinnen, ob sie gute Arbeit leisten.
Sie beschreiben eine Patientenzielgruppe, die unerwartete und traumatisierende Erlebnisse hatte, welche die ästhetische Behandlung in Ihrer Praxis nötig machen. Die chirurgisch-ästhetische Arbeit ist Ihr Metier und es ist nachvollziehbar, dass die Fülle an schwer einschätzbaren Emotionen eine Herausforderung darstellt. Sie scheinen sowohl gute Ergebnisse zu erzielen als auch psychologisch einfühlsam vorzugehen, sonst würden die Patienten Sie nicht weiterempfehlen. Ihre Arbeit gibt den Patienten wieder einen Teil ihres alten Lebens vor dem Trauma zurück, zugleich wird die Zukunft geplant. Ein Gefühl von Normalität und Alltag kann eintreten. All diese Punkte sollten Sie und Ihr Team sich regelmäßig vor Augen führen, wenn Sie Momente des Zweifels haben. Zudem ist es wichtig, dass Sie es sich nicht zur Aufgabe machen, die traumatischen Erlebnisse mit Ihren Patienten aufarbeiten zu müssen. Das innerpsychische Geschehen ist zu komplex, um es im Rahmen einer (zahn-)ärztlichen Behandlung heilen zu können. Die Symptome sind variabel, sodass ich Ihnen leider kein klar strukturiertes Schema vorgeben kann. Dennoch kann es für Sie hilfreich sein, zu erfahren, was die Betroffenen innerlich erleben und wie in der Psychotherapie darauf eingegangen wird.
Trauma und posttraumatische Belastungsstörung
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann hervorgerufen werden durch Ereignisse wie Unfall, körperliche oder seelische Gewalt, sexuellen Missbrauch, Naturkatastrophen, Kriegserlebnisse, lebensbedrohliche Krankheiten, Todesfälle oder ähnlich erschütternde Erlebnisse. Nicht alle Personen, die so etwas erleben, müssen psychotherapeutisch behandelt werden. Falls die Betroffenen psychisch auffällig werden, treten die Symptome oft direkt nach dem Erlebnis auf. Es kann jedoch auch sein, dass Jahre später, meist durch einen ähnlichen Auslöser, die Symptome einer PTBS auftreten. Treten die Symptome bis zu drei Monate auf, spricht man von einer akuten PTBS, bei einer längeren Dauer von einer chronischen PTBS. Das Gehirn kann häufig die schrecklichen Ereignisse nicht verarbeiten, sodass Erinnerungsbruchstücke wie zersplittert im Gehirn abgelegt werden und häufig keinen Zugang zum Sprachzentrum haben. Der Patient hat sozusagen wild aufspringende Bilder, die er kaum in Worte fassen kann, was es ihm schwer macht, sie zu verarbeiten. Die von Ihnen genannten Gefühle beschreiben sehr gut einige der Symptome. Die Patienten fühlen sich in erster Linie hilflos. Sie haben wenig Selbstvertrauen und auch oft kein Vertrauen in andere Menschen. Emotionen wie Schuldgefühle, Ärger, Trauer, Wut und Scham können permanent oder fluktuierend auftreten. Am bekanntesten sind sogenannte Flashbacks, wenn der Patient durch einen Trigger ausgelöst das Geschehene wiedererlebt, als ob es tatsächlich passiere. Es kommt dabei auch zu keiner Milderung des Erlebens oder zu einer Gewöhnung, der Patient ist wieder und wieder in die ehemalige Situation zurückversetzt und reagiert entsprechend. Trigger könnten in Ihrem Arbeitsfeld das Bohrergeräusch oder ein über die Patientin gebeugter Zahnarzt sein. Die Erinnerungen an das Trauma drängen sich immer und immer wieder auf. Die aktive Auseinandersetzung mit dem Erlebten wird üblicherweise eher vermieden. Bei einigen Betroffenen kommt es zu einer Gefühlstaubheit, bei anderen zu einer Hyperaktivität.
Behandlung
Die psychologische Behandlung traumatisierter Menschen sollte immer Fachpersonen überlassen werden, was möglicherweise schon einmal etwas Last von Ihrem Praxisteam nimmt. In einer Psychotherapie geht es in der ersten Phase darum, die Patienten zu stabilisieren. Sie erlernen Strategien im Umgang mit dem Geschehenen und reflektieren ihre Stärken und Ressourcen. Selbstverletzendes Verhalten sollte reduziert bis eliminiert werden. Wie gehen die Patienten mit sich selbst um? Was können sie tun, sobald es ihnen schlecht geht? Haben sie ein sozial stützendes Umfeld? All dies sind Schwerpunkte in der Therapie. Dass die Patienten zu Ihnen kommen, zeigt meist, dass sie zumindest nicht resigniert haben. Haben sie möglicherweise schon Techniken erlernt, die sie bei Ihnen anwenden können? Gibt es Freunde, Familie und Bekannte, die sie begleiten können? In der zweiten Phase der Psychotherapie geht es um die aktive Traumabearbeitung. Erst, wenn der Patient stabil genug ist, kann er sich mit dem Geschehenen auseinandersetzen. Bilder, Sprache und Emotionen werden wieder verknüpft und sortiert. Bevor der Patient nicht weit in dieser Phase vorangeschritten ist, sollten Sie mit ihm nicht zu viel über das Erlebte reden – zu groß ist die Gefahr, dass er unkontrolliert in ein Flashback fällt. Konzentrieren Sie sich darauf, zu erfahren, wie der Patient in Zukunft aussehen möchte. In der dritten (Integrations-)Phase lernen die Betroffenen, das Trauma als Teil ihrer Geschichte zu akzeptieren. Fragen nach dem Sinn kommen auf, häufig noch einmal gepaart mit Trauer um das, was anders hätte sein können. Wut auf den Täter oder sich selbst kommt ebenso vor. Die Personen arbeiten daran, ihr Leben nicht mehr auf das Trauma auszurichten oder darum herum zu leben. Es werden wieder Orte besucht, die möglicherweise gemieden wurden. Es wird mit Menschen gesprochen, die man nicht mehr sehen wollte, weil sie zu fremd geworden waren in der eigenen Bedrängnis. Die Frage nach der eigenen Zukunft, nach persönlichen Wünschen und Freuden steht im Vordergrund. Hier können Sie gut unterstützen, da Sie dem Patienten die Möglichkeit geben, wieder nach vorne zu schauen. Insgesamt sind Einfühlungsvermögen, Ruhe und Wertschätzung – wie bei allen Patienten – wichtige Faktoren im Umgang mit traumatisierten Menschen. Versuchen Sie, Situationen zu vermeiden, die ein Flashback auslösen könnten. Nehmen Sie die Patienten in Ihrer psychischen Verfassung an, wie sie sind. Nehmen Sie sich selbst die Last von den Schultern, die posttraumatische Belastungsstörung therapieren zu müssen. Sie unterstützen die Patienten mit dem Beruf, den Sie für sich gewählt haben und geben dadurch äußerlich sichtbare Normalität zurück, die auch innerlich zur Heilung beitragen wird.