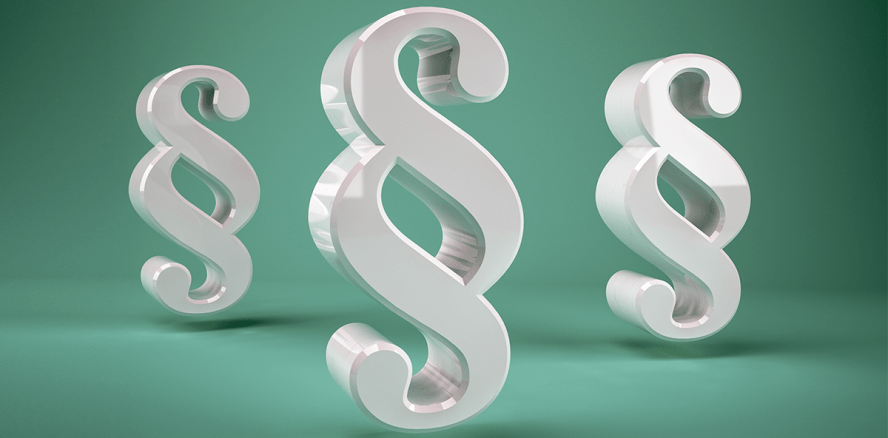Recht 21.08.2017
Die Informationspflicht über Behandlungsfehler
share
Durch das seit dem 26.02.2013 in Kraft getretene Patientenrechtsgesetz wurden in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Vorschriften über den medizinischen Behandlungsvertrag aufgenommen.1 Die Regelungen der §§ 630a bis 630h BGB geben im Wesentlichen die bisher von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze wieder. Dies gilt insbesondere für die Rechtsnatur des Behandlungsvertrages, für die Informationsrechte, für die Aufklärungspflichten, für die Dokumentationspflichten, für die Einwilligung in die Behandlung, für das Recht auf Einsichtnahme in Unterlagen sowie für die Beweislast für Behandlungs- oder Aufklärungsfehler.2 Zum Teil hat der Gesetzgeber jedoch Präzisierungen vorgenommen.3 Die Pflicht des Behandelnden zur Information über mögliche Behandlungsfehler ist neu.
I. Grundsätzliches
Neu ist die Pflicht des Behandelnden zur Information über mögliche Behandlungsfehler gemäß § 630c Abs. 2 S. 2 BGB und das deswegen statuierte Beweisverwertungsverbot für entsprechend erteilte Informationen von S. 3. in § 630c Abs. 2 BGB.
§ 630c Abs. 2 S. 2 und S. 3 BGB lauten wie folgt:
„… Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein Behandlungsfehler unterlaufen, darf die Information nach Satz 2 zu Beweiszwecken in einem gegen den Behandelnden oder gegen seinen Angehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandelnden verwendet werden …“
Bis zur Einführung des § 630c Abs. 2 S. 2 BGB war es in der Rechtsprechung und juristischen Literatur streitig, ob eine Pflicht zur Information über Behandlungsfehler besteht.4 Mit beachtlichen Argumenten wurde eine Aufklärungspflicht bei Beschwerden, die eine weitere Behandlung erfordern, oder bei einer ausdrücklichen Frage des Patienten angenommen.5 Mit der Einführung von § 630c Abs. 2 S. 2 BGB ist jedoch diese Streitfrage entschieden worden: Den Behandelnden trifft jetzt eine Informationspflicht über Behandlungsfehler, wenn der Patient nach Behandlungsfehlern nachfragt, oder wenn dies zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren erforderlich ist. Im Rahmen von oralimplantologischen/zahnärztlichen Behandlungen kann § 630c Abs. 2 S. 2 BGB Bedeutung erlangen, wenn es eventuell bei einer solchen Behandlung zu Problemen gekommen ist und der Patient entsprechende Nachfragen stellt, oder eine sog. Negativauskunft erbittet, dass es keinerlei Probleme gegeben hat. Nachfolgend werden deshalb die sich in diesem Fall ergebenden Fragen behandelt und einer Klärung zugeführt.
II. Informationspflicht aufgrund Nachfrage
Fragt ein Patient den behandelnden Zahnarzt, ob es bei der Behandlungsmaßnahme zu einem Behandlungsfehler gekommen ist, muss der Behandelnde diese Frage beantworten, wenn für ihn Umstände erkennbar sind, die auf einen Behandlungsfehler hindeuten können. Eine rechtliche Bewertung wird von dem Behandelnden nicht verlangt.6
Über den Wortlaut des § 630c Abs. 2 S. 2 BGB hinaus besteht jedoch nicht nur die Verpflichtung zur Auskunft über Umstände, die einen Behandlungsfehler begründen können, sondern auch ein Anspruch auf eine Erklärung des Behandlers, dass für ihn keine Umstände erkennbar sind, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen können (sog. Negativauskunft).7 Die Pflicht zur sog. Negativauskunft wird mit dem Sinn und Zweck des § 630c BGB begründet. Erklärtes Ziel von § 630c BGB sei die Stärkung der Rechte von Patienten, um die Behandelnden sowie die Patienten auf Augenhöhe zu bringen. Damit wäre es nicht vereinbar, wenn ein Behandelnder die Nachfrage des Patienten, ob für ihn Umstände erkennbar seien, die einen Behandlungsfehler begründen können, einfach unbeantwortet lassen könnte. Der Patient könne dann nicht erkennen, ob auf seine Nachfrage nur deshalb nicht reagiert worden wäre, weil der Behandelnde keine Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler hat, oder ob ihm sehr wohl Behandlungsfehler begründende Umstände bekannt seien, die er nur nicht preisgeben möchte. Diese Ungewissheit könnte der Patient nur im Rahmen eines Klageverfahrens beseitigen. Dabei liefe er jedoch Gefahr, im Falle der Nichterkennbarkeit der einen möglichen Behandlungsfehler begründenden Umstände die Kosten für eine Klage zu tragen, die er nur deshalb angestrengt habe, da seine vorherigen Anfragen von dem Behandelnden ignoriert worden wären.8 Für die Praxis bedeutet dies, dass auf entsprechende Nachfrage eines Patienten nicht einfach geschwiegen werden darf, wenn Umstände, die auf einen Behandlungsfehler hindeuten, nicht vorliegen, sondern auch in diesem Fall muss dem Patienten mitgeteilt werden, dass keine Umstände bekannt sind, die einen Behandlungsfehler erkennen lassen. Erfasst werden nicht nur eigene Behandlungsfehler des Behandelnden, sondern auch diejenigen eines Dritten9, der für den Behandelnden als Erfüllungsgehilfe tätig geworden ist.10 Nicht zu den aufklärungsbedürftigen Behandlungsfehlern i.S.v. § 630 c Abs. 2 S. 2 BGB zählen jedoch Aufklärungsfehler i.S.v. § 630 e BGB.11 Darüber braucht keine entsprechende Auskunft gegeben werden.
III. Keine Recherchepflicht zur Abklärung möglicher Behandlungsfehler
§ 630c Abs. 2 S. 2 BGB begründet für den Behandelnden jedoch keine Recherchepflicht zur Abklärung möglicher, für ihn aber nicht erkennbarer Behandlungsfehler.12 Sind dem Behandelnden indessen Umstände erkennbar, wird zum Teil angenommen, dass in diesem Falle eine Recherchepflicht besteht, da andernfalls der Normzweck des § 630c Abs. 2 S. 2 BGB leerlaufe.13 Dem kann nicht gefolgt werden. Denn der Behandelnde kann die an sein subjektives Sonderwissen anknüpfende Mitteilung, dass für ihn keine Behandlungsfehler begründenden Umstände erkennbar sind, auch ohne Recherchen vornehmen, worauf das OLG Oldenburg in dessen Beschluss vom 25.08.2015 5 W 35/15 zutreffend hingewiesen hat.14 Dies auch vor dem Hintergrund, dass den Behandelnden auch Informationspflichten über Behandlungen von Dritten treffen. M.a.W.: Ein Behandelnder, der von einem Patienten um Auskunft über einen Behandlungsfehler gebeten wird, ist daher nicht verpflichtet, Recherchen bzgl. eines eventuellen Behandlungsfehlers durch ihn oder von einem Dritten vorzunehmen, um dies abzuklären.
IV. Auskunftsverpflichtete
Auskunftsverpflichtet ist nach dem Wortlaut von § 630 c BGB der Behandelnde. Behandelnder i.S.d. § 630 c BGB ist derjenige, der gemäß § 630 a Abs. 1 BGB die medizinische Behandlung vertraglich gegenüber einem Patienten übernommen hat. Denn die Informationspflicht ist eine Vertragspflicht, die den Vertragspartner des Patienten trifft.15 Der zur Auskunft Verpflichtete muss daher nicht identisch mit der Person sein, die die Behandlung tatsächlich durchgeführt hat.16 Ist der Behandelnde i.S.v. § 630 c Abs. 2 S. 2 BGB nicht derjenige, der die Behandlung tatsächlich durchgeführt hat, kann die Auskunft nicht dahin erteilt werden, dass ihm keine solchen Umstände bekannt sind, die auf einen Behandlungsfehler hindeuten. Vielmehr muss er entsprechende Nachfragen bei seinen Erfüllungsgehilfen vornehmen, ob diesen entsprechende Umstände bekannt sind. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Patientendokumentation anzuschauen, ob sich daraus Behandlungsfehler ergeben.17
Die in § 630c Abs. 2 S. 2 BGB statuierte Informationspflicht über Umstände, die einen Behandlungsfehler begründen können, begründet zugleich für den Auskunftsgebenden die Gefahr, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren (z. B. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gemäß § 229 StGB) eingeleitet wird. Diesen Interessenwiderstreit löst das Gesetz gemäß § 630c Abs. 2 S. 3 BGB dahin, dass die entsprechende Information, die der Behandelnde nach § 630c Abs. 2 S. 2 BGB gegeben hat, in einem gegen den Behandelnden oder seinen Angehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit dessen Zustimmung verwendet werden darf. Ein Problem stellt sich dabei, wenn der tatsächlich Behandelnde nicht Vertragspartner ist, sondern angestellter Arzt. Seinem Wortlaut nach greift in diesem Fall das Beweisverwertungsverbot gegenüber diesem nicht ein, da § 630c Abs. 2 S. 4 BGB sich nur an den Vertragspartner als Behandelnden i.S.d. § 630 Abs. 2 BGB richtet. Ob § 630c Abs. 2 S. 3 BGB analog auf solche Personen angewandt werden kann, ist bisher noch nicht entschieden. Von daher besteht für solche Personen ein entsprechendes Risiko. Zu befürworten ist jedoch eine entsprechende analoge Anwendung von § 630c Abs. 2 S. 3 BGB auch auf solche Personen. Denn nur dies entspricht dem Sinn und Zweck des § 630c Abs. 2 S. 3 BGB.
V. Eigeninformationspflicht
Eine Pflicht zur nicht angeforderten Information über Umstände eines (eventuellen) Behandlungsfehlers, ohne dass der Patient danach gefragt hat, besteht gemäß § 630c Abs. 2 S. 2 BGB nur dann, wenn die Nichtinformation zu gesundheitlichen Gefahren führen kann und durch eine entsprechende Information daher gesundheitliche Gefahren abgewendet werden können. Erkennt ein Arzt oder Zahnarzt während einer Behandlung, dass es zu einem Behandlungsfehler gekommen ist und dieser zu gesundheitlichen Gefahren führen kann, muss er von sich aus den Patienten unaufgefordert über diese Umstände informieren. Ist der Behandelnde i.S.d. § 630c Abs. 2 S. 2 BGB nicht derjenige, der die Behandlung tatsächlich durchgeführt hat, stellt sich die Frage, ob er sich das Wissen des die Behandlung tatsächlich ausführenden Behandelnden zurechnen lassen muss. Um entsprechende Risiken zu vermeiden, sollte der Behandelnde i.S.d. § 630c Abs. 2 BGB mit dem tatsächlich die Behandlung ausführenden Behandelnden vorsorglich vereinbaren, dass dieser ihn über eventuelle Behandlungsfehler, die bei der Behandlung erkennbar werden, sofort informiert. Wie die Rechtsprechung die Fälle behandelt, wenn der die Behandlung tatsächlich ausführende Behandler den Behandelnden i.S.v. § 630c Abs. 2 BGB nicht informiert, ist offen. Im Ergebnis wird jedoch der Vertragspartner des Patienten den dadurch dem Patienten entstandenen Schaden ersetzen müssen. Inwieweit eine Regressnahme des in Anspruch genommenen Arztes/Zahnarztes, bei dem die Behandlung tatsächlich ausgeführt habenden Behandelnden möglich ist, ist eine andere Frage und richtet sich insoweit nach den jeweils maßgebenden Haftungs-/Regressnormen.
VI. Wegfall der Informationspflicht
Die Informationspflicht gemäß § 630c Abs. 2 BGB kann gemäß § 630c Abs. 4 BGB in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände wegfallen. Das Gesetz nennt expressis verbis die Fallgruppe „Behandlung ist unaufschiebbar“ und diejenige, dass der Patient auf die Informationserteilung verzichtet hat. Ein formularmäßiger Verzicht bei Verletzung der Informationspflicht ist dafür nicht ausreichend. Ein Verzicht, der auf ausdrückliches Befragen erfolgt und dessen Bedeutung und Tragweite der Patient erkannt hat und der insbesondere unter Zeitnot dokumentiert ist, ist wirksam und lässt eine Informationspflicht entfallen.18 Wann aus sonstigen Gründen die Informationspflicht entfallen kann, kann nur aufgrund der jeweiligen besonderen Umstände gesagt werden. Gründe sind z. B. therapeutische Gründe wie Selbstgefährdung.19
VII. Rechtsfolgen bei Verletzung der Informationspflicht
Die Verletzung der Informationspflicht gemäß § 630c Abs. 2 S. 2 BGB kann haftungsrechtliche Schadensersatzansprüche gemäß § 280 Abs. 2 BGB auslösen, wenn wegen nicht oder unzureichender Informationserteilung der Patient keine Ansprüche geltend macht oder geltend machen kann.20 Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Verletzung der Informationspflicht für den eingetretenen Schaden kausal ist. § 630c Abs. 2 S. 2 BGB ist kein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB.21
VIII. Praxisrelevanz
Die tatsächliche Bedeutung der Informationsverpflichtung gemäß § 630c Abs. 2 S. 2 und S. 3 BGB über einen Behandlungsfehler wird als nicht sehr groß eingeschätzt.22 Im Ergebnis kann § 630c Abs. 2 BGB für den Patienten die Geltendmachung von Regressansprüchen erleichtern23. Ob diese Einschätzung richtig ist, wird die Zukunft zeigen. Wer jedoch als Behandelnder Risiken vermeiden will, sollte gleichwohl bei geltend gemachten Ansprüchen auf Auskünfte nach § 630c Abs. 2 S. 2 BGB oder bei erkannten Fehlern dies nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie in diesen Fällen richtig zu handeln ist, kann nicht allgemein gesagt werden. Empfehlenswert ist, in einem solchen Fall sachkundigen Rat einzuholen, wie zweckmäßigerweise reagiert werden muss und sollte, um seiner Verpflichtung aus § 630c Abs. 2 BGB sachgerecht nachzukommen.
Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.
Der Artikel ist im Implantologie Journal 3/2017 erschienen.