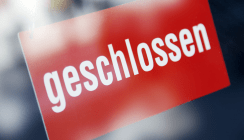Recht 19.12.2016
Vorsicht bei Formulierungen von Kündigungen
share
Kündigung einer medizinischen Fachangestellten – Kündigungsschutz auch im Kleinbetrieb?
Das Landesarbeitsgericht Mainz musste sich mit der Frage befassen, ob die Kündigung einer medizinischen Fachangestellten trotz Nichtanwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes wegen Sittenwidrigkeit unzulässig war (Urteil vom 26.08.2016, AZ.: 1 Sa 89/16). Die Entscheidung zeigt, dass auch Inhaber kleiner Arzt- und Zahnarztpraxen bei der Formulierung von Kündigungen Obacht geben müssen.
Der Fall
In dem konkreten Fall war eine medizinische Fachangestellte in einer Arztpraxis mit weitaus weniger als 10 Arbeitnehmern beschäftigt, womit die Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes (u.a. Erfordernis der Begründung der Kündigung aus persönlichen und/oder betrieblichen Gründen) keine Anwendung fanden.
Die Entscheidung
Vorinstanz
Im Juli 2015 kündigte der Arzt das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiterin fristgemäß, wobei er im Kündigungsschreiben angab, dass die Kündigung aus "betriebsbedingten Gründen" notwendig sei.
In der Vorinstanz entschied das Arbeitsgericht Koblenz am 28.01.2016 (7 Ca 2540/15), dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung des Arztes nicht aufgehoben worden sei. Die Kündigung sei nach § 242 BGB trotz der Nichtanwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes rechtsunwirksam. Der Arzt habe die Kündigung selbst als aus betriebsbedingten Gründen notwendig bezeichnet, dem gegenüber aber im Juni 2015 noch zwei Neueinstellungen vorgenommen. Die Auswahlentscheidung des Arztes lasse daher ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme vermissen. Der Vorwurf willkürlicher Ausübung des Kündigungsrechts werde auch nicht dadurch ausgeräumt, dass die Beklagte sich auf krankheitsbedingte Fehlzeiten der Klägerin berufen habe.
Treu und Glauben - Fristgemäße Kündigung trotz Kleinbetrieb unwirksam?
Entgegen der Entscheidung des Arbeitsgerichtes Koblenz kam das Landesarbeitsgericht Mainz zu dem Ergebnis, dass die Kündigung des Arztes zulässig war. Die Kündigung verstoße nicht gegen die gemäß § 242 BGB bei jedem Rechtsgeschäft zu beachtenden Grundsätze von Treu und Glauben. Der in § 242 BGB niedergelegte Grundsatz von Treu und Glauben bilde eine allen Rechten, Rechtslagen und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung. Eine gegen diesen Grundsatz verstoßene Rechtsausübung oder Ausnutzung einer Rechtslage sei wegen der darin liegenden Rechtsüberschreitung unzulässig. § 242 BGB sei auf Kündigungen allerdings neben § 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) nur in beschränktem Umfang anwendbar. Das Kündigungsschutzgesetz habe die Voraussetzungen und Wirkungen des Grundsatzes von Treu und Glauben konkretisiert und abschließend geregelt, soweit es um den Bestandsschutz und das Interesse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes gehe. Eine Kündigung verstoße deshalb in der Regel nur dann gegen § 242 BGB, wenn sie Treu und Glauben aus Gründen verletze, die von § 1 KSchG nicht erfasst seien. Es gehe vor allem darum, Arbeitnehmer vor willkürlichen oder auf sachfremden Motiven beruhenden Kündigungen zu schützen, zum Beispiel vor Diskriminierungen. Der Vorwurf willkürlicher, sachfremder oder diskriminierender Ausübung des Kündigungsrechts scheide aus, wenn ein irgendwie einleuchtender Grund für die Rechtsausübung vorläge.
Die Entscheidung zeigt, dass es für den Arbeitgeber nicht unproblematisch sein kann, wenn er in einem Kleinbetrieb bei einer ordentlichen (fristgemäßen) Kündigung zusätzlich Kündigungsgründe angibt. Hiermit kann er - wie im vorliegenden Fall - eine Prüfung der Kündigung wegen Treuwidrigkeit initiieren.