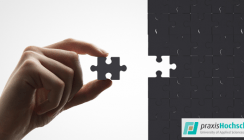Implantologie 27.10.2015
Diabetes mellitus in der Implantologie
share
Wieso uns Diabetes in der Zahnheilkunde betrifft
Die Etablierung der Implantologie in der Zahnheilkunde war ein enormer Fortschritt für die festsitzende Zahnversorgung in den letzten Jahrzehnten. Bereits in den Anfängen dieser Erfolgsgeschichte wusste man, dass systemische Erkrankungen einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis haben können (Herbsman 1966). Auch war bereits bekannt, dass es unter diabetischen Bedingungen zu einer Verzögerung und Störungen in der Wundheilung bei oralchirurgischen Eingriffen kommen kann (Glickman 1967). Durch Beobachtungen, prospektive und retrospektive Studien, konnte Diabetes als Risikofaktor besser eingeschätzt werden (Smith et al. 1992). Lange galt der Diabetes als relative Kontraindikation in der Implantologie (Michaeli et al. 2009, Javed et Romanos et al. 2009). Die steigende Anzahl an Publikationen zu diesem Thema mit unterschiedlichen Studiendesigns zeichnet langsam ein Bild, welche zusätzlichen Faktoren das Risiko beeinflussen können (Chranovic et al. 2014). Es ist das Ziel dieses Artikels, die Auswirkung des Diabetes auf den Knochen, in besonderem Hinblick auf die Implantologie, zu behandeln.
Zunahme des Diabetes weltweit
Laut WHO wird das weltweite Vorkommen des Diabetes in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Global gesehen schätzt man die Anzahl der diabetischen Erwachsenen (Typ I und Typ II) im Jahr 2010 auf 285 Millionen, und bis 2030 wird mit einen Anstieg auf 438 Millionen Erkrankte gerechnet (www.who.int). Bereits jetzt weiß man, dass 12 bis 15 Prozent der Patienten über 70 Jahre an Diabetes mellitus leiden – diese Zahlen gelten mittlerweile auch für die deutschsprachigen Länder. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass sowohl die Zunahme von Diabetes als auch die Zunahme von parodontalen Erkrankungen altersabhängig ist, wird klar, dass dadurch auch das Risiko eines vermehrten Zahnverlustes steigt (Oliver et Tervonen 1993). Es liegt die Vermutung nahe, dass durch die Wiederherstellung der Kaufunktion die Nahrungsaufnahme und daher die Einstellung der Blutzuckerwerte erleichtert werden kann (Bolriel et al. 2005). Diese Tatsache unterstreicht die Wichtigkeit der dentalen Rehabilitation. Diese Entwicklungen zeigen deutlich, wieso es zu einer Zunahme der diabetischen Patienten in den Kliniken und Praxen in den nächsten Jahren kommen wird.
Diabetesformen
Allen Diabetesformen ist die Hyperglykämie gemeinsam – so zeichnet sich der Typ-I-Diabetes durch einen absoluten Mangel an Insulin aus, der Typ-II-Diabetes geht mit einer Nichtansprechbarkeit der Zellen für Insulin einher. Weniger bekannt, jedoch an dieser Stelle erwähnt, ist die weitere Einteilung des Diabetes in Typ III und Typ IV. Als Typ-III-Diabetes werden sekundäre diabetische Störungen unterschiedlicher Genese angeführt. Dazu gehören Erkrankungen des Pankreas, endokriner Organe (z. B. Morbus Cushing), diabetogene Medikamente und genetische Erkrankungen. Sie machen 0,1 bis 1 Prozent der diabetischen Patienten aus. Als Typ-IV-Diabetes wird der Gestations- oder auch sogenannte Schwangerschaftsdiabetes bezeichnet.
Diagnose des Diabetes
Durch die chronisch erhöhten Blutzuckerwerte kommt es biochemisch zur Bindung der Glukose an das Hämoglobin der Erythozyten, welche bei kurzfristiger Blutzuckererhöhung reversibel ist. Kurzfristige Blutzuckerspitzen werden daher selten in überhöhten HbA1c-Werten sichtbar. Bei Gesunden liegt der HbA1c-Wert bei ca. vier bis sechs Prozent. Bleiben die Blutzuckerwerte jedoch über einen längeren Zeitraum erhöht, so kommt es zur irreversiblen Verzuckerung („Glykosylierung“) des Hämoglobins. Da die mittlere Halbwertszeit der Erythrozyten und damit des glykosylierten Hämoglobins bei 60 Tagen liegt, spiegelt der HbA1c-Wert den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten sechs bis zehn Wochen wider. Je höher der Blutzuckerwert, desto stärker verläuft die Glykosylierung und damit steigt der HbA1c-Wert an.
In Zukunft sollen die Blutzuckerwerte als Standard in mmol/mol als IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) angegeben werden. Wie wichtig die Kontrolle bzw. die Einhaltung des therapeutischen Bereichs ist, zeigt die Tatsache, dass es klare Zusammenhänge zwischen dem Auftreten mikro- und makrosvaskulären Komplikationen und den HbA1c-Werten gibt (Cohen und Horton 2007). Außerdem konnte gezeigt werden, dass erhöhte Langzeitblutzuckerwerte einen direkten Zusammenhang mit der Morbidität und Mortalität aufweisen (Boltri et al. 2005). Daher ist das Anstreben von HbA1c-Werten, die sich im therapeutischen Bereich befinden, von höchster Priorität (Rodbard et al. 2009).
Die pathophysiologischen Unterschiede zwischen Typ-I- und Typ-II-Diabetes und deren Auswirkung auf den Knochen
Die Osseointegration von dentalen Implantaten ist von zwei wesentlichen Faktoren abhängig – der Einheilungsphase, die mit einer Regeneration des Knochens einhergeht, und dem Erhalt bzw. physiologischen „Turnovers“ des Knochens um das Implantat im Langzeitverlauf. Knochenphysiologisch ist es wichtig, die Diabetestypen zu unterscheiden. Sowohl der absolute als auch relative Insulinmangel sowie die reduzierte Ansprechbarkeit der Zellen auf Insulin wirken sich unterschiedlich auf den Knochenstoffwechsel aus. In vitro konnte gezeigt werden, dass Insulin einen direkten anabolen Effekt auf die Proliferationsrate von Osteoblasten hat (Hashizume & Yamaguchi 1993) und die Kollagensynthese (Craig et al. 1989) ebenfalls erhöht wird. Weiterhin beeinflusst Insulin andere Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel IGF-I („Insulin like growth factor“), welcher die Osteoblastenfunktion ebenfalls positiv anregt. In vivo zeigt sich beispielsweise, dass durch Insulin die Knochenformation günstig beeinflusst wird (Cornish et al. 1996).
Zudem ist bekannt, dass Typ-II-Diabetespatienten eine höhere Knochendichte (BMD – bone mineral density) aufweisen als Typ-I-Diabetiker. Die Knochenformation und Knochenfestigkeit sind bei beiden Diabetesarten erniedrigt (Liu et al. 2013). Was das Frakturrisiko betrifft, so zeigen beide Diabetesformen deutlich höhere Werte als beim gesunden Patienten (Vestergaard 2007).
Hyperglykämie – die Glykosylierung
Eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst die Physiologie beim diabetischen Patienten. Einer der wichtigsten Gründe scheint jedoch die Hyperglykämie zu sein, deren Auswirkung auf den Gesamtorganismus vielfältig ist. Als zentrale pathophysiologische Mechanismen der Hyperglykämie zählt die Verursachung von erhöhtem oxidativem Stress, welcher zu einer signifikanten Veränderung der genetischen Expression in der Vaskularisierung führt. Ferner kommt es zu einer Veränderung von antiinflammatorischen und antithrombotischen Effekten. Hinzu kommt eine Störung in den vaskulären Reparaturmechanismen und damit zu gravierenden Komplikationen in vielen Organen, welche mit einer erhöhten Morbidität (unter anderem Wundheilungsstörung) für beide Diabetesformen einhergeht (Feng et al. 2005, Crimi et al. 2007, Fadini 2006). Weitere durch die Hyperglykämie verursachte schädliche Stoffwechselprodukte sind die AGEs. AGEs stehen als Abkürzung für Advanced Glycation Endproducts und entstehen durch die dauerhafte Anlagerung von Glukose an Eiweiß- und Fettverbindungen, deren Funktion dadurch verändert wird. Die AGEs spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung diabetesbedingter Folgeerkrankungen an Augen, Nieren und Nerven. Der Anstieg an AGEs bei diabetischen Patienten spiegelt sich in der Erhöhung der AGEs in gefäßreichen Geweben wider und verändert endotheliale Zellen, Makrophagen und die glatten Muskelzellen.
Das vermehrte Vorkommen von AGEs im Knochen führt zu einer verminderten Knochenformation und in einer präklinischen Frakturstudie zu einer verminderten Heilung (Santana et al. 2003). Es scheint, dass die AGEs das Wachstum, die Differenzierung und die Aktivität der Osteoblasten direkt über die Bindung an dem entsprechenden Rezeptor RAGE beeinflussen (Mc Carthy et al. 2001, Schwartz et al. 2003). In der Mundhöhle spielen die AGEs insofern eine wichtige Rolle, da gezeigt werden konnte, dass die korrespondierenden Rezeptoren (RAGE) im Parodontium exprimiert werden und die Verbindung AGE – RAGE den devastierenden Effekt der akuten parodontalen Erkrankung zusätzlich fördert (Taylor et al. 2013).
Diabetesmedikamente und der Knochenstoffwechsel
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass manche für den Typ-II-Diabetes zugelassenen Medikamente den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen können. Auch bei neueren antidiabetogenen Präparaten wird Zurückhaltung bei Patienten mit einem bereits erhöhtem Frakturrisiko empfohlen (Meier C et al. 2015). Wie sich die Gabe der Medikamente auf die implantologische Behandlung auswirkt, ist derzeit nicht bekannt.
Diabetes in der Implantologie
In den Reviews zum Thema Diabetes und Implantologie schwanken die Implantatverlustraten zwischen Null und 14,7 Prozent, manche Autoren in Übersichtsarbeiten berichten sogar davon, dass bis zu 31 Prozent ihrer Patienten mit Diabetes zumindest einen Implantatverlust im Beobachtungszeitraum erlitten (Bornstein et al.2008, Oates et al. 2011). Die Datenlage ist generell sehr heterogen, und das Problem vieler Reviews ist, dass aufgrund der eingeschränkten Angaben in den Publikationen nur wenige Parameter die möglichen Zusammenhänge zwischen Diabetes und Implantaterfolg und -verlustraten statistisch robust berechnet werden können (Chranovic et al. 2014). Es fehlen oft wichtige zusätzliche Informationen. Beispielsweise werden oft Rauchen, schlechte Mundhygiene, der Ausbildungsstand des Operateurs, die Medikamenteneinnahme und die genauen Blutzuckerwerte für die Risikoabschätzung des Implantaterfolges bzw. des Implantatverlustes nicht berücksichtigt.
Generell zeigt ein Großteil der präklinischen implantologischen Studien, dass der unkontrollierte Diabetes die knöcherne Regeneration und damit die Einheilung der Implantate negativ beeinflussen kann (Glössl et al. 2008). Diese Beobachtungen decken sich mit den oben genannten osteologischen Studien, die zeigen, dass die Hyperglykämie die Knochenformation, den Bone turnover und die mechanische Festigkeit der Knochen negativ beeinflusst. Die mögliche Erklärung dafür liegt in der eingeschränkten Proliferation der Osteoblasten und der Kollagenproduktion (Hashizume & Yamaguchi 1993, Craig et al. 1989, Liu et al. 2013).
In den letzten Jahren lag der Fokus in den implantologischen Studien auf der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den Blutzuckerwerten und der Implantateinheilung bzw. des Überlebens (Javed & Romanos et al. 2009). Übersichtsarbeiten, die den Faktor „Blutzuckerwerte“ berücksichtigten, zeigten ähnliche Implantatüberlebensraten bei gut eingestellten diabetischen Patienten wie bei nicht diabetischen(Oates et al. 2013).
Eine wichtige und aussagekräftige Studie, die zeigt, dass die Implantateinheilung zwar funktioniert, jedoch durch die Blutzuckerwerte wesentlich beeinflusst werden kann, ist die 2009 erschienene Arbeit von Oates und Mitarbeitern. In dieser Studie wurde bei allen Implantatpatienten der Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) und die Implantatstabilität mittels Resonanzfrequenzanalyse (Osstell®) gegenübergestellt. Die erhobenen Werte zeigten deutlich, dass es bei schlecht eingestellten Blutzuckerwerten zu einem deutlichen Abfall der Implantatstabilität in der Einheilphase kam, sich die Werte aber im Zeitverlauf von 16 Wochen erholten und auf ein Durchschnittsniveau anpassten. Trotz dieser sichtbaren Auswirkung der Hyperglykämie auf die Implantatstabilität kam es zu keinem Implantatverlust oder einer Wundheilungsstörung. In einer Folgestudie von Oates et al. 2014 wurden die Blutglukosewerte im Zusammenhang mit der Implantatstabilität weiter verfolgt und es zeigte sich, dass sich nach sechs und zwölf Monaten keine Unterschiede in der Implantatstabilität zur anderen Gruppe zeigte.
Diabetes – Periimplantitis und Blutzuckerwerte
Aus den umfassenden parodontologischen Forschungen ist bekannt, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Parodontitis und Diabetes gibt (Wilson 1989). In den implantologischen Studien zeigte sich, dass Diabetes tendenziell zu einer periimplantären Mukositis und Periimplantitis führen kann (Ferreira et al. 2006). Erste Studien, die auch die Blutzuckerwerte dazu untersuchten, kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Rezente Arbeiten bestätigen, dass der periimplantäre Knochenverlust deutlich von den Blutglukosewerten abhängt. So konnte deutlich gezeigt werden, dass Typ-II-Patienten mit schlecht eingestellten Blutzuckerwerten schlechte periimplantäre Parameter aufweisen und einen periimplantären bzw. marginalen Knochenverlust zeigen (Gomez-Moreno et al. 2015).
Conclusio
Aufgrund der demografischen Veränderungen und dem Ansteigen der Diabetesprävalenz werden die Patienten, die in Zukunft eine implantologische Versorgung in Anspruch nehmen, steigen. Die Studien zur Pathophysiologie des Knochens und des Immunsystems unter hyperglykämischen Bedingungen zeigen deutlich, dass der Diabetes einen negativen Einfluss hat. Die Datenlage zur implantologischen Versorgung beim diabetischen Patienten und die Erkenntnis aus präklinischen Versuchen sind nach wie vor heterogen. Es bedarf noch einiger Forschung, um zu klären, welche zusätzlichen Risikofaktoren die Auswirkung des Diabetes beim implantologischen Patienten negativ beeinflussen. Die Einstellung der Blutzuckerwerte scheint einer der wichtigsten Faktoren für das Implantatüberlebens zu sein und sollte in der täglichen chirurgischen Praxis berücksichtigt werden.