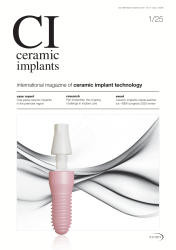Prophylaxe 25.08.2023
Nicht Wellness, sondern Medizin: Zu GBT® im Präventionsalltag
share
Dieser Fachbeitrag erschien in gekürzter Form unter dem Titel „Nicht Wellness, sondern Medizin: GBT® als effektive Prävention im Praxisalltag“ in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 9/23.
Hippokrates wusste bereits vor ca. 2.500 Jahren, dass Prävention wichtiger als kurative Therapie ist. Aktuell stellte Benz (2021) fest, dass die Prävention die wirksamste zahnärztliche Behandlung ist, die wir in 150 Jahren wissenschaftlicher Zahnmedizin entwickelt haben1. Ob der oft zitierte Paradigmenwechsel weg von der Restauration hin zur Prävention2 schon wirklich vollzogen ist, darf bezweifelt werden. Der folgende Beitrag diskutiert das Standing der Prävention in der heutigen Zahnmedizin und ordnet die systematische Prophylaxe-Guided Biofilm Therapy in die Präventionslandschaft ein. Dabei widmen sich die Autoren getrennt voneinander verschiedenen Aspekten.
Laut einer aktuellen Umfrage des INSA-Meinungsforschungsinstitutes (2019) ließen weniger als die Hälfte (41 Prozent) der Befragten in den letzten zwölf Monaten beim Zahnarzt die Zähne professionell reinigen3. Eine Forsa-Umfrage (2019) kam zu etwas besseren Ergebnissen: Drei von fünf Bundesbürgern gehen mindestens einmal jährlich zur professionellen Zahnreinigung4. Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen dem Wissen der Zahnärzte über Prophylaxe und der Umsetzung in den Praxisalltag erklären? Sind die zur Prävention angebotenen systematischen präventiven Ablaufprotokolle nicht mehr zeitgemäß? Oder liegt es daran, dass parallel zum fachlichen Paradigmenwechsel auch ein Paradigmenwechsel auf ökonomischer Ebene stattfinden muss?
Fachlicher Paradigmenwechsel (Dr. Klaus-Dieter Bastendorf)
Soll Prophylaxe erfolgreich in den Praxisalltag intergiert werden, wird ein neues, am Stand der Wissenschaft und dem technischen Fortschritt orientiertes systematisches Prophylaxe-Protokoll benötigt.
Wissenschaftlicher Fortschritt - Der Biofilm ist die biologische Herausforderung:
Heute ist die „Ökologische Plaque Hypothese nach Marsh“5 für die Ätiologie der wichtigsten oralen Erkrankungen weltweit akzeptiert. Nach dieser Hypothese ist der vitale sub- und supragingivale dysbiotische Biofilm die Hauptursache für die wichtigsten oralen Erkrankungen (Karies, Gingivitis, Parodontitis, periimplantäre Mukositis, Periimplantitis). Im Biofilm findet eine ökologische (Änderung der Umweltbedingungen) Verschiebung von der Symbiose zur Dysbiose statt. Diese Verschiebung führt zu einer Störung der Homöostase. Zahnerkrankungen sind das Resultat der entzündlichen Wirtsantwort auf den mikrobiellen Biofilm.
Zahnstein ist die mineralisierte Form des Biofilms. Zahnstein ist weder die Ursache von Karies noch Parodontitis. Subgingivaler Zahnstein trägt zur Chronizität und zum Fortschreiten parodontaler Erkrankung bei. Aufgrund der porösen Oberfläche erleichtert Zahnstein die Retention des Biofilms. Zahnstein erschwert auch eine optimale häusliche Mundhygiene. Da wir die Ursache der meisten oralen Erkrankungen kennen, kann es für die Zahnmedizin nur ein Ziel geben: Orale Gesundheit ein Leben lang zu erhalten. Im Zusammenspiel von häuslichen und professionellen individuellen Mundhygienemaßnahmen ist dieses Ziel zu erreichen6.
Technischer Fortschritt - Hilfsmittel zum Biofilmmanagement
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen häuslichem und professionellen Biofilmmanagement. Es stehen uns sowohl für das häusliche wie das professionelle Biofilmmanagement chemische und mechanische Hilfsmittel zur Verfügung. Die Professionelle Zahnreinigung (PZR) oder besser „Professional Mecanical Plaque Removal“ (PMPR) ist ein zentraler Bestandteil der systematischen Prophylaxe. Das mechanische professionelle Biofilmmanagement kann mit Handinstrumenten (HI) wie Scalern und Küretten (HI), maschinellen Hilfsmitteln wie Schallscaler (AS) und Ultraschallscaler (US), sowie Pulver-Wasser-Strahl-Geräten (Air-Polishing/Air-Flowing®) (Abb. 1) und mit „Rubber Cup Polishing“ (RCP) durchgeführt werden. Die Begriffe Air-Polishing (AP) und Air-Flowing® (AF) werden oft synonym verwendet, unterscheiden sich aber erheblich und müssen gegeneinander abgegrenzt werden: Beide arbeiten nach demselben Prinzip der Pulver-Wasser-Strahl-Technologie. Beim Air-Flowing® handelt es sich um ein technisch, physikalisch und chemisch abgestimmtes System (Airflow® Prophylaxis Master, Airflow®MAX und Perioflow®-Handstück, minimalinvasives erythritolbasiertes Airflow® Plus Pulver), das als einziges Gerät mit einer konstanten und regulierten Pulver-Fließrate und laminarer Strömung arbeitet. Für alle zur Anwendung kommenden Hilfsmittel gelten die gleichen Ziele: Biofilme effektiv und gezielt entfernen, Biofilme modifizieren, Zahnstein effektiv und gezielt entfernen, Substanz-Schonung, Patienten-Komfort und Behandler-Komfort.
Der Vergleich der Hilfsmittel entsprechend den oben angeführten Zielen zeigt, dass Air-Flowing® bei der supragingivalen und subgingivalen effektiven gezielten Biofilmentfernung allen anderen Hilfsmitteln überlegen ist7, 8, 9,10,11,12. Neuere Arbeiten zeigen, dass es mit Air-Flowing® und piezo-keramischem Ultraschall (Piezon NoPain®/PS Instrument) möglich ist, Biofilme zu modifizieren und die Symbiose wiederherzustellen13,14. Zahnstein kann mit piezo-keramischem Ultraschall gezielter, effektiver entfernt werden als mit Handinstrumenten15,16,17. Auch bei der Substanzschonung18,19,20,21, dem Behandler-22 und Patienten-Komfort23,24,25,26,27,28 sind Air-Flowing® und moderne Ultraschall-Systeme den Handinstrumenten überlegen.
Systematische Prophylaxe - Guided Biofilm Therapy (GBT®)
Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Firma EMS Nyon (Schweiz) in Zusammenarbeit mit Praktikern und Hochschulen das Prophylaxe-Protokoll der Guided Biofilm Therapy (GBT®), das den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem technischen Fortschritt angepasst ist, entwickelt. Die GBT beschreibt die moderne, systematische Prophylaxe in acht modularen Teilschritten (Abb. 2) und laut Definition handelt es sich bei der GBT um ein systematisches, strukturiertes, am Risiko orientiertes, modulares, individuelles, evidenzbasiertes, universell anwendbares Präventions- und Therapie-Protokoll. GBT kann bei allen, auch komplexen Fragestellungen der Mund- und Allgemeingesundheit, und in allen Altersgruppen angewendet werden.
Was bedeuten die einzelnen Begriffe der GBT-Definition
- Systematische Prophylaxe und Therapie: Ein grundsätzlicher Ablauf wird vorgegeben. In acht Schritten wird der Behandler gezielt („guided“) durch das Protokoll geführt. Systematisch bedeutet nicht mechanisch gedankenlos stets gleicher Ablauf.
- Strukturiert bedeutet Orientierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen und am technischen Fortschritt (Hinterfragen der alten Abläufe z. B. Handinstrument, Rubber Cup Polishing, Abschlusspolitur usw.)
- Strukturiert bedeutet auch transparentes und logisches Vorgehen, es bedeutet nicht Verzicht auf Individualität.
- Orientierung am Erkrankungsrisiko: Anamnese, Befunderhebungen, altersspezifische Risikobestimmung, Diagnose und daraus abgeleitet gezielte („guided“) systematische Prophylaxe und Therapie.
- Modular: Für die einzelnen Schritte gibt es keine Zeitvorgaben wie beim „Kuchenmodell“ nach Axelsson/Lindhe. Der Behandler entscheidet, welche Module er gezielt („guided“) einsetzt und wieviel Zeit er für die Module braucht.
- Individuell: Sowohl die häuslichen wie auch die professionellen Maßnahmen müssen individuell auf den Patienten abgestimmt sein (Partizipation)
- Universell: Bei allen, auch komplexen „Fällen“ der Mund- und Allgemeingesundheit und in allen Altersgruppen anwendbar.
- Evidenzbasiert: Alle Teilschritte sind evidenzbasiert.
- Zusammengefasst heißt das, dass die GBT sich streng an der modernen Medizin (P 4.0/E) orientiert: „Präventiv, prädiktiv, Personalisiert, Partizipativ“, das „E“ steht für Ethik, da es ethischer ist, Geld mit der Gesundheit als mit der Krankheit der Patienten zu verdienen.
Ökonomischer Paradigmenwechsel (Dr. Ann-Kathrin Arp)
Von der fachlichen Seite her gehört die Zukunft der Zahnheilkunde der Prävention. Die Prophylaxe erfährt auch in der Öffentlichkeit eine immer positive Belegung, sie liegt im Trend, es ist „in“ fit und gesund zu sein. Die Prophylaxe fördert das Image der Praxen, die eine kausale bedarfsorientierte individuelle Präventionstherapie professionell und ergebnisorientiert anbieten. Darüber hinaus ist sie ein ideales Instrument zur Patientengewinnung und -bindung. Werden präventive Leistungen wirtschaftlich erbracht, so mindern sie das Unternehmerrisiko des Zahnarztes und können die Basis für die wirtschaftliche Zukunft der Praxis sein, da sie die Praxis unabhängiger von gesetzlicher Willkür machen. Umso unverständlicher ist es, dass nicht alle Zahnarztpraxen individuelle bedarfsorientierte, systematische Prävention als Dienstleistung mit Konzept anbieten.
Gesundheitssystem finanziert Krankheit
Eine Erklärung kann nur darin zu finden sein, dass Zahnärzte weder in ihrer universitären noch in ihrer postuniversitären Aus- und Fortbildung gelernt haben, nach betriebswirtschaftlichen Regeln ihre Praxis zu führen. Der Blick auf die Verteilung der Ausgaben für zahnärztliche Behandlung 2021 – Deutschland29 unterstützt diese Thesis. Der übernommene Kostenanteil für therapeutischen Maßnahmen seitens der Krankenkassen beträgt mehr als 95 Prozent (Abb. 3). Die Tatsache, dass sich die präventiven Leistungen der Prophylaxe – außer für die kleinen Patienten – ausschließlich im Bereich der GOZ befinden, spricht für ein Gesundheitssystem, das Krankheit und nicht Gesundheit finanziert.
Somit ist es auch naheliegend, dass ein Großteil des Umsatzes in der Zahnarztpraxis durch prothetische und konservierende-chirurgische Leistungen erzielt wird. Ein Hauptargument, warum eine Ausrichtung auf präventive Zahnmedizin nicht erfolgt, ist die angeblich mangelhafte Zuzahlungsbereitschaft der Patienten. Die Zuzahlungsbereitschaft der Patienten allein kann jedoch nicht der Hauptkritikpunkt des Paradigmenwechsel zur Prävention sein. Auch präventive Leistungen für Kinder (FU- und IP-Leistungen), die von den gesetzlichen Kassen vollständig getragen werden, werden zu maximal 75 Prozent in Anspruch genommen. Bei Kindern unter 5 Jahren liegt die Quote noch deutlich tiefer29 (Abb. 4).
Zahngesundheit ist keine Selbstverständlichkeit
Viel mehr wirft eine Umfrage aus dem Jahr 2000 die berechtige Frage auf, ob Patienten den Nutzen der präventiven Leistungen verstanden haben. Die Auswertung der Umfrage zeigt deutlich die Auffassung der Patienten, dass sich Zahnersatz nicht durch Zahnpflege verhindern lässt30 (Abb. 5). Damit steht die Präventionsökonomie vor einer großen Herausforderung: Zahngesundheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Ergebnis des Miteinanders von Patienten und Behandler bzw. seines Teams. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der Patient bereit ist, sich an diesem Aufwand zu beteiligen. Erkennt der Patient den Nutzen nicht, lässt er sich schwer in ein präventives Behandlungskonzept einbinden. Die erste Hürde besteht demnach in der Kommunikation mit dem Patienten und im zweiten Schritt in der wirtschaftlichen Attraktivität. An diesem Punkt ist der Behandler nicht nur als Zahnarzt, sondern auch primär als Unternehmer gefragt.
GBT: kein Wellness, sondern notwendige Medizin
Die Darstellung des Nutzens für den Patienten durch Aufklärung bietet einen guten und einfachen Einstieg in die Kommunikation. Maßgabe dabei sollte sein: Systematische Prophylaxe GBT ist keine Wellnessbehandlung und viel mehr als eine perfekte Zahnreinigung, GBT ist eine notwendige präventive und therapeutische zahnmedizinische Maßnahme. Diese Betreuung auf Augenhöhe zeigt dem Patienten den Mehrwert für ihn und seine orale Gesundheit. Dabei stehen er und seine Interessen bei der individuellen, schmerzfreien Behandlung durch die geschulten Mitarbeiter im Mittelpunkt. Der Behandler leistet damit einen auch wichtigen Beitrag zur Auslastung der Prophylaxe. Die Auslastung ist maßgeblich für den Umsatz der Praxis:
| Auslastung x Preis = Umsatz |
Praxisinhaber tragen die wirtschaftliche Verantwortung der Zahnarztpraxis und die notwendige Kompetenz in der Patientenkommunikation. Nicht jedem Behandler liegt die proaktive Ansprache zuzahlungspflichtiger Leistungen, dennoch ist diese Kommunikation ein wichtiges Kriterium für die fachliche und wirtschaftliche Zukunft der Praxen.
Auslastung ist kein Selbstläufer
Die Schlüsselfrage an dieser Stelle ist, wieviel Prozent Ihrer Patienten sind halbjährlich im Recall eingebunden? Ist die 95-Prozent-Marke wirklich utopisch, wenn jeder Patient seine Mundgesundheit erhalten kann? Und wie ist mit Patienten umzugehen, die die Verantwortung ihrer Mundgesundheit vollständig auf den Behandler übertragen? Dafür braucht es ein Präventions-Konzept, in dem auf patientenindividuelle Bedürfnisse eingegangen werden kann: Eine Schwangere benötigt z. B. eine andere Prophylaxe als die 70-Jährige mit viel Zahnersatz oder der PAR-Patient. Wird diese individuelle Zahnerhaltungstherapie angeboten und beim Patienten kommuniziert, hat jeder Patient seinen individuellen Grund für die Prophylaxe und lässt sich in das Konzept einbinden.
Gewinnorientierte Gestaltung
Wirtschaftlich interessant ist die Skalierbarkeit der präventiven Konzepte. Die Prophylaxe ist vollständig delegierbar und ein gut organisiertes Team sehr umsatzstark, vor allem wenn die Preispolitik in der Praxis stimmt. Der Mindestpreis orientiert sich an der Abrechnung nach der GOZ-Position 1040 für Kassenpatienten – eine gewinnorientierte Gestaltung erfolgt jedoch in den wenigsten Praxen. Der Preis sichert den Gewinn, das unternehmerische Risiko und die Kosten der Praxis. Erfahrungswerte haben gezeigt, dass nur zehn Monate im Jahr wertschöpfend gearbeitet wird. Zwei Monate bestehen aus Urlaub, Fortbildung und durchschnittlichen Krankheitstagen. Diese Faktoren werden jedoch nur sehr selten berücksichtigt.
| Prophylaxe/Woche x 4,3 Wochen x 10 Monate = Prophylaxe/Jahr |
Im Hinblick auf den Preis und die Auslastung gilt es, die eigenen Praxisfakten kritisch zu hinterfragen und ggf. anzupassen. In erster Linie sollte die Prophylaxe GBT fest in das Praxis- und das Prophylaxekonzept eingebunden werden.
Kostenträger ist entscheidend
Das Gesundheitssystem basiert auf §12 (1) SGB 5 „Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; (…)“ sein, nicht für den Patienten, nicht für die Praxis, sondern allein für die Kostenträger. Der Patient ist also für den Erhalt seiner Gesundheit monetär eigenverantwortlich. Damit findet zeitgleich auch eine Selektion der Patienten statt. In einer weiteren Maßnahme muss der Preis für präventive Leistungen betriebswirtschaftlich überprüft werden. Die Orientierung erfolgt anhand der individuellen Kosten und der Gewinnmarge. Mit der Erhöhung der Qualität der präventiven Leistungen mit Hilfe des GBT-Protokolls kann eine Preiserhöhung gut kommuniziert werden. Auch können die Kosten durch eine Zusatzversicherung, wie ZahnReinigungsFlats®, reduziert werden.
Investition zahlt sich aus
Dieses Umsatzpotenzial erfordert neben unternehmerischem Handeln aber auch Kapitaleinsatz. Wer die Prophylaxe in den Fokus der Praxis stellt, investiert in moderne Prophylaxe Zimmer und hochwertige Ausstattung. Je nach Ausgangsituation können hier rund 65.000 Euro Investitionssumme pro Zimmer entstehen. Steuerlich werden Anschaffungskosten über die Nutzungsdauer verteilt, weshalb die Rentabilität der Geräte zum größten Teil von der Auslastung der Prophylaxe abhängt. Die Abschreibungswerte also Kosten der Ausstattung pro Monat belaufen sich auf 830 Euro. Neben einmaligen Investitionen entstehen Kosten durch den Materialverbrauch. Materialkosten sind in den Praxen sehr präsent: Oftmals wird viel Zeit investiert, um günstige Preise zu finden. Der zeitliche Aufwand dahinter übersteigt die Ersparnis um das Vielfache. Nach eigenen Berechnungen liegen die Materialkosten bei 18 Euro pro Behandlungsstunde.
Zusammengefasst bringt die auf Prävention ausgerichtete Praxis wirtschaftliche Vorteile mit erheblichen Umsatzpotenzial, wenn betriebswirtschaftliche Grundlagen beachtet werden. Die Faktoren Qualität, Preis, Auslastung und Kommunikation sind die Stellschrauben des Erfolgs in der Praxis.
Fazit
Spätestens seit der Veröffentlichung der Arbeiten von Axelsson und Lindhe, welche bereits 1981 publiziert wurde6, steht es außer Frage, dass die systematische Prävention (GBT) fachlich im Mittelpunkt der Zahnmedizin steht. Neue Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen oraler Medizin, Allgemeingesundheit und Lebensqualität haben die Bedeutung der systematischen oralen Prävention noch mehr in den Fokus gerückt.
Eine präventiv ausgerichtete Praxis muss aber auch wirtschaftlich betrieben werden. Hierzu trägt entscheidend das Wissen um betriebswirtschaftliche Grundlagen bei. Wenn die Praxisleitung und das Team die notwendigen theoretischen Vorarbeiten zur Einführung der systematischen organisierten Individualprophylaxe (GBT) erfolgreich durchführen und die Prävention zielgerichtet in den Praxisalltag einführen, wird das Produkt „Prävention“ zur fachlich-ethischen und wirtschaftlichen Sicherung und Weiterentwicklung der Praxis beitragen. In der Praxis werden sich langfristig nur Konzepte erfolgreich durchsetzen, die dem Patienten die Möglichkeit aufzeigen, wie er seine orale Gesundheit lebenslang herstellen oder erhalten kann.
Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.