Branchenmeldungen 19.09.2023
„Meine Leidenschaft ist die Dentaltechnologie“
share
Zahntechnikerin, Promovendin der Dentaltechnologie, Entwicklungsingenieurin und Verwaltungsprofessorin: Dr.-Ing. Monika Strickstrock geht konsequent ihren Weg im Forschungs- und Arbeitsfeld der Dentaltechnologie. Pünktlich zu ihrer Übernahme der Professur „Dentale Werkstofftechnologie und Analytik der Keramik“ der Hochschule Osnabrück am 1. September nahm Sie sich Zeit für ein ausführliches Interview.
Frau Dr.-Ing. Monika Strickstrock, woher stammt Ihre Begeisterung für Zähne?
Zähne haben mich schon immer fasziniert, genauso wie Natur und Technik. Jeder Mensch besitzt Zähne und hat vielleicht auch Probleme damit, also war das Thema direkt greifbar. Außerdem war mein Vater Zahnarzt, dem Anschein nach ist das Interesse also vererbt worden. (lacht) Jedenfalls fand ich alles, was mit Zähnen zu tun hat, das Zusammenspiel von Mensch und Material, spannend, logisch und gut verständlich.
Was mich daran besonders fasziniert? Es ist vor allem der innere Aufbau der Zähne, der ganz auf die notwendige Funktion am Einsatzort abgestimmt ist. Wenn man einmal einen Zahn unter dem Rasterelektronenmikroskop betrachtet hat, wird deutlich wie perfekt und komplex die Natur „ihre Bauteile“ für uns konzipiert hat. Jeder einzelne Zahn ist ein Wunderwerk aus Millionen von Einzelteilen, die sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Materialkombinationen in Perfektion, aufeinander abgestimmte Strukturen im Nano-, Mikro- und schließlich Makrobereich führen erfolgreich zur ganzheitlichen Funktion der Zähne.
Warum haben Sie sich ursprünglich für das Zahntechniker-Handwerk entschieden?
Handwerkliche Tätigkeiten finde ich grundsätzlich spannend, selbst etwas bauen, gestalten, kreativ sein. Im Keller meines Elternhauses stand ein ausrangiertes Gerät aus einer Zahnarztpraxis. Das hat mich magisch angezogen. Im Alter von etwa 8 Jahren habe ich ein Schleifgerät auseinandergenommen und die losen Teile ziemlich unbedarft wieder zusammengesetzt. Die Freude war groß, als sie wieder lief. Danach habe ich alles, was mir in die Hände kam, beschliffen (Gott sei Dank keine Zähne). Mein erstes Schulpraktikum absolvierte ich in einem Dentallabor und verliebte mich sofort in die Wachsmodellation. Verlorene Zahnstrukturen so natürlich wie möglich nachzubilden, führte mich in eine neue Welt. Schnell war klar, dass die zahntechnische Ausbildung genau das Richtige für mich ist. Handwerkskunst auf höchstem Niveau, anspruchsvolle Techniken und Kenntnisse mit hochleistungsfähigen Biomaterialien – das alles beeindruckt mich zutiefst. So brenne ich nach wie vor für den Beruf des Zahntechnikers und die Möglichkeiten, damit Menschen zu helfen.
Warum haben Sie sich nach Ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin für das Studium Dentaltechnologie entschieden und sich nicht etwa mit einem eigenen Labor selbstständig gemacht?
Der Grund dafür ist mein Hang zum Perfektionismus. Die Patientenarbeiten mussten in meinen Augen immer perfekt sein und optimal auf dem Modell sitzen. Oft scheitert das im Arbeitsalltag an der fehlenden Zeit oder der nicht perfekten Arbeitsgrundlage. Mein Chef ließ mich auch nur ungern Provisorien anfertigen. „Mach das nicht so ordentlich, dann kommen die Patienten nie wieder“, hörte ich oft.
Eines Tages, noch in der Ausbildung, die Fahrerin war krank, konnte ich das Eingliedern meiner ersten VMK-Krone begleiten. Auf dem Stumpf im Mund des Patienten saß sie allerdings nicht richtig. Kein Vergleich zur perfekten Passung auf dem Modell. Ich war schockiert, der Zahnarzt hingegen war sehr zufrieden und stellte „nur“ Frühkontakte fest, die „etwas“ (1mm) eingeschliffen werden mussten. Das tat er mit einem groben Fräser, die Kaufläche war in meinen Augen zerstört und mein zahntechnisches Perfektionistenherz zerbrach. Aus einem der Bruchstücke wurde der Keim für Wissenschaft, Werkstoffkunde und Technologie gesät. Die Beseitigung dieser unnötigen Fehler und die perfekte Passung waren meine Intention. Ich fragte mich (und meine Berufsschullehrer): „Was ist eigentlich die Herausforderung im Umgang mit den Werkstoffen bei der Übertragung der Patientensituation und wie könnte man solche Ungenauigkeiten in Zukunft technologisch lösen?“. Mein aufmerksamer Berufsschullehrer Herr Kutschmann (damals BBSII Göttingen) gab mir den Flyer zum Studiengang Dentaltechnologie. Dafür bin ich sehr dankbar!
Ich merkte, dass ich zu wenig über Werkstoffe und Eigenschaftsbeeinflussung wusste und wollte mir mehr Wissen aneignen. Nach der Ausbildung habe ich noch etwas mehr als ein halbes Jahr in einem anderen Labor gearbeitet, um sicher zu sein, dass ein Studium wirklich der nächste Schritt sein könnte. Aber auch dort stieß ich wieder an die gleichen Grenzen und entschied mich, mein Fachabitur zu machen, um nach Osnabrück zum Studieren zu gehen. Es fühlte sich richtig an.
Sie waren unter den Premieren-Absolventen, die den bundesweit ersten Studiengang in der Dentaltechnologie absolviert haben, Ihre Dissertation war die erste mit dentalem Schwerpunkt, die im Labor für Metallkunde und Werkstoffanalytik der Hochschule Osnabrück entstand. War Ihr Weg als Frau in diesem Bereich eventuell steiniger als für männliche Mitstreiter?
Die Dentaltechnologie steht mit ihrer starken Inter- und Transdisziplinarität im Gegensatz zu den großen Mainstream-Bereichen der Ingenieurwissenschaften. Kleine Studiengänge oder Arbeitsfelder haben es grundsätzlich nicht so leicht, da neue Wege erst beschritten werden müssen. Ob es ein männlicher Kollege leichter gehabt hätte, kann ich nicht sagen.
Daher muss man diese Frage innerhalb des Themas differenzieren:
Der Studiengang Dentaltechnologie wurde auf Nachfrage der dentalen Industrie in Kooperation mit dem Verein deutscher Zahntechniker Innungen (VDZI) gegründet. Ich habe mich zu einem Zeitpunkt für das Studium entschieden, als die ersten Diplomingenieure gerade den Abschluss gemacht hatten. Trotzdem kannte zunächst niemand die Absolventen des Studiengangs und die Studierenden wussten nicht so recht wohin nach dem Studium. Auch hochschulintern wurde die neue Entwicklung zurückhaltend beobachtet. Professor Zylla hatte in den ersten Jahren viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Diese Skepsis hat sich im Laufe der Jahre gelegt. Inzwischen kennt man uns und schätzt unsere fachliche Kompetenz, die sehr hohe Nachfrage der Dentalindustrie nach Dentaltechnologinnen aus der Hochschule Osnabrück ist konstant und steigend.
Grundsätzlich ist die Promotion an Fachhochschulen aufgrund des fehlenden Promotionsrechts kein einfaches Unterfangen. Es werden so genannte kooperative Promotionen der Hochschule mit einer Universität durchgeführt. Die Frage ist also, an welcher Fakultät bzw. in welchem weiteren Fachbereich man promoviert. Natürlich hätte sich eine zahnmedizinische Fakultät angeboten, aber ich wollte den technischen Weg in den Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften weitergehen. Eine Forschungskooperation mit Prof. Dr. K. Liefeith vom außeruniversitären Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik IBA Heilbad Heiligenstadt in Thüringen, den ich bereits während meines Studiums kennengelernt hatte, brachte mich an die TU Ilmenau.
Dort gab es den für mich passenden Fachbereich Glas & Keramik, der unter der Leitung von Prof. Dr. E. Rädlein verschiedenste Arbeiten in den anorganischen Themenbereichen aufnahm. Da mein Schwerpunkt auf dem Werkstoff Zirkoniumdioxid und der Beeinflussung der Materialeigenschaften durch die zahntechnische Bearbeitung aufgrund der zahnmedizinischen Anforderungen lag, fand ich dies perfekt und wurde nach Vorlage des Exposés und einer Eignungsfeststellungsprüfung mit Fachprüfungen angenommen. Die Breite des Themengebietes meiner Dissertation und die Besonderheit des Themas brachte alle Beteiligten im Laufe der Zeit mindestens einmal aus der Komfortzone. Mein inneres Bestreben war es aber vor allem, meinen eigenen Vorstellungen von der Dissertationsschrift gerecht zu werden. In meinen Augen sollte es eine Arbeit werden, die sich transdisziplinär und dennoch intensiv mit dentalem Zirkoniumdioxid auseinandersetzt und versucht möglichst viele Ebenen zu erschließen. Die Arbeit sollte aber auch eine analytische Tiefe aufweisen, ohne die Besonderheit der zahntechnischen Einzelteilfertigung außer Acht zu lassen.
Der Frauenanteil im Studiengang Dentaltechnologie war und ist der höchste in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik. Für den Bereich Zahntechnik/Zahnmedizin ist der höhere Frauenanteil ganz normal und so bin ich vielleicht mit einem anderen Selbstverständnis in den Bereich der Ingenieurwissenschaften an der Hochschule hineingewachsen.
Aber es gibt auch ein tolles Programm, an dem ich teilnehmen durfte. Es richtet sich an Frauen, die an Fachhochschulen promovieren oder dort ihre zukünftige Wirkungsstätte sehen. Man kann sich in geschützten Räumen austauschen, beraten oder auch coachen lassen. Themen bei uns waren zum Beispiel: Gibt es geschlechterspezifische Kommunikation? Was höre ich selbst aus einem Satz heraus? Warum werden Frauen in bestimmten Disziplinen nicht als gleichwertig wahrgenommen? Wie finde ich meinen Platz in dieser Welt? All das und noch viel mehr hat uns in dieser Runde bewegt und ich habe den Austausch wirklich als sehr hilfreich empfunden, weil er zum gegenseitigen Verständnis beigetragen hat. Um es zusammenzufassen: Ich habe ein wenig den Eindruck, dass man als Frau in den Ingenieurwissenschaften zunächst eher skeptisch beäugt wird und sich mehr anstrengen muss, um zu überzeugen. Einem Mann wird in diesen Bereichen „von Natur aus“ mehr Verständnis zugetraut. Ich selbst habe mich deswegen aber nie wirklich benachteiligt gefühlt. Vielleicht ist es auch eine Frage, wie man damit umgeht. Grundsätzlich muss sich jede/r in der Promotionsphase in jeder Hinsicht weiterentwickeln und wirklich hart arbeiten. Die meisten geschlechtsspezifischen Vorurteile kann man dann durch fachliche Expertise und eine angemessene Portion Sozialkompetenz abbauen.
Zahntechnikern, Dentaltechnologin, Promovendin, Entwicklungsingenieurin, Verwaltungsprofessorin – nun folgen Sie zum 1. September dem Ruf der Hochschule zur Übernahme der Professur „Dentale Werkstofftechnologie und Analytik der Keramik“. Wie fühlen Sie sich mit Blick auf Ihren beeindruckenden Werdegang?
Stolz, glücklich und voller Tatendrang. Jede einzelne Etappe war ein Meilenstein, für den ich viel geleistet habe und voller Einsatz dabei war. Hätte man mir vor 20 Jahren (während meiner Ausbildung) gesagt, welchen Weg ich gehen werde, hätte ich es belächelt und als Scherz abgetan. Ein Schritt ergab den Folgenden. Getrieben von meiner Leidenschaft für die Dentaltechnologie bin ich gewachsen und habe mich den Herausforderungen gestellt. Ich hatte aber Unterstützerinnen, die mir das nötige Selbstvertrauen gaben, um kontinuierlich voranzugehen.
Beispielsweise sagte einer meiner Fachabiturlehrer vor versammelter Mannschaft zu mir: „Ich habe den Eindruck, dass Sie alles schaffen werden, wenn Sie es nur wollen.“ Ich weiß noch wie perplex ich damals war. Dieser Satz tauchte in schweren Phasen immer wieder stärkend aus meinem Gedächtnis auf.
Was sind Ihre konkreten Aufgaben?
Ich bin für die Gestaltung, Konzeption und Durchführung verschiedener Veranstaltungen verantwortlich, darunter Vorlesungen, Seminare, Projekte und Praktika im Bereich der Dentaltechnologie und verwandter Studiengänge. Pro Semester organisiere ich derzeit etwa sechs bis neun verschiedene Veranstaltungen und betreue derzeit mehr als zehn Abschlussarbeiten. Meine Themenschwerpunkte in der Lehre sind die dentalen Fertigungstechnologien und das Vermitteln der Werkstoffkompetenz im Bereich der Keramiken und deren Analytik. Zusätzlich habe ich die Studiengangsleitung des Studiengangs Dentaltechnologie. Dort ist aktuell sehr viel zu tun, da wir uns in der Reakkreditierung der Studienprogramme befinden. Zusätzlich leite ich das Labor für Dentaltechnologie und Analytik. Ich bin für die Projektakquise, -leitung und -durchführung zuständig. Aktuell laufen bei uns zwei Forschungsprojekte und mehrere, kleinere industriell begleitete Projekte. Natürlich ist es auch mein Ziel, den Studiengang weiter bekannt zu machen. Kleinere „Werbe“-Projekte finden dann zwischendurch statt.
Wie kann man sich konkret Ihren Arbeitsalltag an der Hochschule vorstellen?
Jeder Tag gestaltet sich etwas anders. Im Semester habe ich zwei bis vier fest geplante Veranstaltungen mit Studierenden, die jeweils 1,5 Stunden dauern. Zusätzlich betreue ich mehrere Studierende bei ihren Abschlussarbeiten. Es gibt auch regelmäßige Besprechungen, um über die Entwicklung der Lehre oder Forschungsthemen zu sprechen. Natürlich stehen auch Studierende im Fokus, die Fragen oder Gesprächsbedarf bezüglich ihrer Abschluss- oder Projektarbeiten haben. Zudem habe ich Besprechungen mit dentalen Firmen oder Forschungskooperationspartnern. Zwischen den Terminen oder abends bereite ich mich auf kommende Veranstaltungen vor und überarbeite sowie aktualisiere Inhalte. Wann immer es möglich ist, gehe ich mit anspruchsvolleren Fragestellungen am liebsten auch selbst an die analytischen Geräte. In der Klausurzeit und vorlesungsfreien Zeit stehen die Leistungsabfrage und Bewertung im Vordergrund. Zum Ausgleich kann ich diese Zeiten dann flexibler für Termine, Entwicklungen und Projekte nutzen.
Was sind Ihre erklärten Ziele, die Sie mit Ihrer Professur gern realisieren möchten?
Ich möchte vor allem für dental Themen begeistern – den Menschen zeigen, wie vielfältig und spannend dieser Arbeitsbereich ist. An einer Fachhochschule steht zunächst immer die Lehre im Mittelpunkt. Damit diese langfristig erfolgreich sein kann, möchte ich durch anwendungsnahe Forschung und Projektarbeit der Außenwelt zeigen, was die Dentaltechnologie, die Studierenden und die Alumni aus Osnabrück leisten können. Sowohl das zahntechnische Handwerk als auch die Dentalindustrie und die Zahnmedizin können z.B. von unserem Wissen über den Einfluss von Fertigungsparametern auf Werkstoffe und deren Langzeitverhalten profitieren. Wir verfügen über ein sehr gutes Werkstoff-Know-how und analytisch bestens ausgestattete Labore. Die enge Verzahnung von Praxis und Theorie sehe ich als ausbaufähige Stärke des Fachbereichs und des Studiengangs.
Mit dem Fokus auf dentale Fachthemen in Forschung und Lehre – bevorzugen Sie eher die praktische Arbeit oder die theoretischen Aspekte Ihres Tuns?
Im optimalen Fall ist Beides im Gleichgewicht. Nach längeren Phasen reiner theoretischer Arbeit, dem Schreiben von Texten oder Ausarbeitungen, verspüre ich das Bedürfnis an die Analysegeräte wie das Diffraktometer oder Rasterelektronenmikroskop zu gehen, um wieder selbst Untersuchungen zu machen. Ich bin der Meinung, dass man sich durch das Sehen und Begreifen selbst stetig am besten weiterentwickeln kann. Ich liebe auch einfach das handwerkliche Geschick der Zahntechnik. Derzeit habe ich beispielsweise eine Veranstaltung im zweiten Semester zur dentalen Fertigung, bei der die Studierenden eine vestibulär zu verblendende Krone modellieren und einen Klammer-Modellguss planen und vermessen. Dabei muss ich mich beim „Helfen“ manchmal etwas zurückhalten, weil ich selbst so viel Spaß an der praktischen Arbeit habe.
Andererseits ist es auch wichtig, die praktisch erarbeiteten Ergebnisse (wie zum Beispiel Analyseergebnisse) immer wieder zu durchdenken und zu reflektieren, was ebenfalls Zeit benötigt. Dies ist möglicherweise die größte Herausforderung in unserer schnelllebigen Zeit. Daher benötige ich auch regelmäßig Zeiträume, in denen ich einfach nur die Ergebnisse wirken lassen kann, um Lösungsansätze zu finden oder ein besseres Verständnis zu erlangen. Dafür braucht es Ruhe und Konzentration. Das lässt sich nicht in einer kurzen „Freistunde“ erledigen. In diesen Momenten merke ich, dass sowohl meine Hände als auch mein Verstand gleichermaßen gefordert sein müssen. Wenn einer dieser Aspekte vernachlässigt wird, fühle ich mich unausgeglichen – aus der Balance.
In Kooperation mit Ihren Studierenden und verschiedenen Dentalfirmen konnten Sie bereits spannende Projekte realisieren. Bitte erläutern Sie anhand eines Beispiels, wie man sich einen solchen Ablauf vorstellen kann.
Gar nicht einfach ein einzelnes oder besonderes Projekt auszuwählen, da das Spektrum wirklich breit ist. Zunächst einmal haben Unternehmen häufig verschiedene Themen, die sie in Betracht ziehen, um sie an uns „auszulagern“. Je nach Schwierigkeitsgrad und Umfang erfordert dies entweder eine Gruppe von Studierenden in den früheren Phasen des Studiums oder einzelne Studierende in Praxisprojekten, Bachelor- oder Masterarbeiten zum Ende des Studiums. Es gibt ein Vorgespräch und der Projektplan wird ausgearbeitet. Die Studierenden bekommen dann schon die Aufgabe selbst tätig zu werden und erstellen konkrete Zeit- und Arbeitspläne. Sie arbeiten Versuchsmodelle aus, die dann vorgestellt und von uns freigegeben werden. Dann führen die Studierenden die Untersuchungen unter Begleitung der Firmenbetreuer oder dem Laborpersonal durch. Man trifft sich wieder, um Ergebnisse und weitere notwendige Untersuchungen oder Schritte zu definieren. Die Studierenden schreiben dann ihre Abschlussarbeit entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Die Firmen finanzieren dabei Gerätestunden, Material oder notwendiges Zubehör. Die Studierenden erhalten je nach Thema oder Firma etc. auch schon eine Vergütung.
Derzeit beschäftigen wir uns bspw. mit dem Unternehmen aus der Region (Dental Direkt) mit dem Thema der Schichteigenschaften in voreingefärbten super- bis hochtransluzenten Multilayer-Blanks. Wir untersuchen, welche Auswirkungen unterschiedliche Schichtaufbauten und Abweichungen der Sintertemperatur von den Sollwerten auf spezifische Materialeigenschaften haben. Dazu werden Normprüfkörper hergestellt, gesintert und anschließend analytisch auf spezifische Werte geprüft. Bisher haben wir den Wärmeausdehnungskoeffizienten, die statische Festigkeit, Farbe und Transluzenz, das Gefüge, die Korngrößen, Härte und Zähigkeit in den einzelnen Schichten erfasst. Diese Informationen helfen den dentalen Unternehmen, zusätzliche umfassende Daten für den Einsatz in verschiedenen zahntechnischen Laboren zu generieren, basierend auf den bereits im Vorfeld charakterisierten Eigenschaften.
Hätten Sie zukünftig auch Interesse an einer Arbeit nur für die Industrie?
Natürlich bin ich immer offen für neue Möglichkeiten und individuelle Weiterentwicklung. Meine bisherigen Jahre in der Industrie haben mich auf vielfältige Weise bereichert. Der Vorteil daran ist, dass man in der Industrie direkter und schneller Dinge vorantreiben kann. Von der Idee über die Projektplanung, -umsetzung, Produktentwicklung bis hin zur Markteinführung – man sieht unmittelbar, was man geleistet hat und wie gut das Produkt auf dem Markt ankommt.
Ein keramisches Implantatsystem zu entwickeln, das aufgrund seiner besonderen Oberflächenstruktur eine beschleunigte Einheilung garantiert und zudem fest, langzeitstabil und kostengünstig ist, gehört zu Ihren erklärten Zielen. Wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird dafür noch nötig sein?
Die kostengünstige Herstellung von dentalen Implantaten, insbesondere aus Keramik, ist tatsächlich eine zeitaufwändige Herausforderung. Keramikmaterialien sind aufgrund ihrer hohen Bindungsenergien zwar sehr fest, aber aufgrund der begrenzten Fähigkeit zur Verformung (fehlende Versetzungsbewegung) spröde und wenig fehlertolerant. Eigenschaften wie „eine besondere Oberflächenstruktur zur besseren Verankerung“, „höhere Festigkeit“ und „Langzeitstabilität“ stehen daher im Widerspruch zum Konzept der Kosteneffizienz. In theoretischen und wissenschaftlichen Ansätzen haben wir grundsätzlich großartige Möglichkeiten, die Implantate zu verbessern. Wir können beispielsweise die Oberflächen bioaktivieren, funktionalisieren oder hydrophilieren durch den Einsatz von Polyelektrolyten, antibakterielle Beschichtungen aufbringen und vieles mehr.
Ich habe Implantatsysteme gesehen, die über den Ansatz der Individualisierung mittels eigener Scharpey‘scher Fasern besser osseointegrieren sollten. Aber der zu zahlende Preis steigt. Die Herstellungskosten limitieren uns also in der Forschung, natürlich müssen die Produkte „massentauglich“ und möglichst erschwinglich sein. So hat sich einer meiner Ansätze, die Festigkeit des Implantats um 30 Prozent zu erhöhen, zerschlagen, da sich die Kontaktzeit in der Herstellung um mehrere Minuten pro Bauteil erhöhte. „Das wird nicht gezahlt“, hieß es. Zeit kostet Geld und diesen Aufpreis zahlt man nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wieviel Sicherheit on top braucht welche Versorgung für welchen Patienten?
Es gibt jedoch sehr gute Implantatentwicklungen, die funktionieren und so kostengünstig wie möglich sind. Die Prozesskontrolle bei Keramiken muss deutlich enger gefasst sein, da sie im Vergleich zu Metallen weniger fehlertolerant sind. Ein intensiv geprüftes Produkt und damit gutes Produkt, kann daher nie wirklich „billig“ sein. In den letzten Jahren wurde ich mit einigen Schadensfällen bei keramischen Implantaten konfrontiert, die kritisch bewertet werden mussten. Ein Verlust des Implantats trat in der Regel auf, wenn mehrere Fehler ungünstig zusammenwirkten. Kumulative Fehler können beispielsweise ein exzentrisch belasteter Knochen, einseitig belastete Kronen, mangelndes Knochenlager, stark gekippte Implantate, übermäßige Oberflächenrauheit im Belastungsbereich, Knochenschwund, der Einsatz abgenutzter Werkzeuge oder unzureichende Mundhygiene sein. Meine Aufgabe bestand dann darin, das Material intensiv zu überprüfen und auch die Qualität der Oberfläche zu bewerten.
Der 3D-Druck verspricht in dieser Hinsicht eine relativ kostengünstige und individuelle Herstellung von Implantaten. Die zukünftige Herausforderung liegt in der Qualitätssicherung dieses individuellen Prozesses. Auch hier bin ich wirklich sehr gespannt, was in Zukunft entstehen wird.
Sie selbst haben einmal in einem Interview erläutert, dass es in der Natur unfassbar komplexe Bauteile gibt, die aus ganz faszinierenden Werkstoffkombinationen zusammengesetzt sind, wie Menschen sie gar nicht nachahmen können. Erwarten Sie in absehbarer Zukunft Neu- bzw. Weiterentwicklungen in Bezug auf dentale Materialen, die diesem Ziel deutlich näherkommen?
Schauen wir uns zunächst am Beispiel des Zahnes an, welche Punkte ich konkret meine, denn was die mechanischen, ästhetischen und biokompatiblen Eigenschaften betrifft, können wir mit unseren Werkstoffen die Natur natürlich schon sehr gut nachahmen. Aber es geht immer noch besser. Im menschlichen Körper laufen zum Beispiel Heilungs- oder Umbauprozesse von selbst ab, wenn die Notwendigkeit durch Über- oder Unterbelastung gegeben ist. Wenn wir an den Knochen denken, so ist dieser bspw. so aufgebaut, dass immer eine optimale Krafteinleitung und Kraftverteilung stattfindet.
Um dem natürlichen Zahn wirklich näher zu kommen, müssen wir zunächst in verschiedenen Strukturebenen denken. Die Makrostruktur ist noch relativ einfach: An der Zahnkrone haben wir den wenige Mikrometer bis einige Millimeter dicken Zahnschmelz, darunter das Dentin, das auch den Hauptteil der Wurzel ausmacht. Über dem Wurzeldentin befindet sich der Zahnzement, mit dem die Scharpey’schen Fasern verwachsen sind, die auf der anderen Seite mit dem Knochen verbunden sind und so den Kaudruck abfedern. Im Inneren des Zahnes befindet sich die Pulpa, die der Ernährung und der Schmerzleitung dient.
Die Mikrostruktur ist schon komplexer. Im Zahnschmelz haben wir Schmelzprismen, die sich in Bündeln auf gekrümmten Bahnen um das Dentin herum und quer dazu zur äußeren Schicht bewegen. Eine regelrechte Webstruktur, die der Spaltung der kristallinen Matrix des Zahnschmelzes entgegenwirkt und die hohe Belastbarkeit bewirkt. Auch das Dentin weist unterschiedliche Strukturen auf, die auf unterschiedliche Mineralisationsprozesse zurückzuführen sind. Um die Dentinkanälchen, die z.B. die Schmerz-Temperaturrezeptoren führen und vom Dentinliquor durchspült werden, ist das Dentin zum Schutz dichter mineralisiert, dazwischen lockerer für „Leichtbaueffekte“.
Nun zur Nanostruktur. Beide Strukturen, Zahnschmelz und Dentin, sind überwiegend kristallin aufgebaut, wobei das Dentin den höheren Anteil an organischen Substanzen aufweist. Der Zahnschmelz besteht, wie bereits erwähnt, aus Schmelzprismen, die in Bündeln angeordnet sind: Die Länge entspricht etwa der Schmelzdicke und der Durchmesser ist ~5 μm. Auf einen Millimeter Schmelzfläche kommen 20.000-30.000 Prismen. Ein Schmelzprisma besteht wiederum aus Millionen einzelner Kristallite, den Hydroxylapatitkristallen. Diese kommen zwar sowohl im Dentin als auch im Schmelz vor, haben aber wiederum je nach Lage unterschiedliche Strukturen und Abmessungen im Nanometermaßstab.
Dieses Gesamtkonzept zu imitieren wäre die hohe Kunst, insbesondere echte Reparatur- oder Umbauprozesse, wie sie im Körper stattfinden. Mit einem sehr komplexen Druckverfahren, das es schafft, mit Biomaterialien gezielt in diesen Schichten und Strukturebenen zu arbeiten, könnte dies vielleicht gelingen. Bis es so weit ist, werden wir weiter daran arbeiten, die Biokompatibilität, die Ästhetik und die mechanischen Eigenschaften von Dentalwerkstoffen bis zur Perfektion zu optimieren.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft – beruflich im Bereich der Zahntechnik und Dentaltechnologie wie auch privat?
Gute und erfolgreiche Zusammenarbeit von Zahnmedizin und Zahntechnik mit der Dentaltechnologie. Tolle gemeinsame und innovative Entwicklungen. Für die Dentaltechnologie viele motivierte Studierende, spannende Projekte, gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Privat bin ich wunschlos glücklich. Vielen Dank!
Vielen Dank für das interessante Interview!
Dieser Beitrag ist in der ZT Zahntechnik Zeitung 09/23 erschienen.


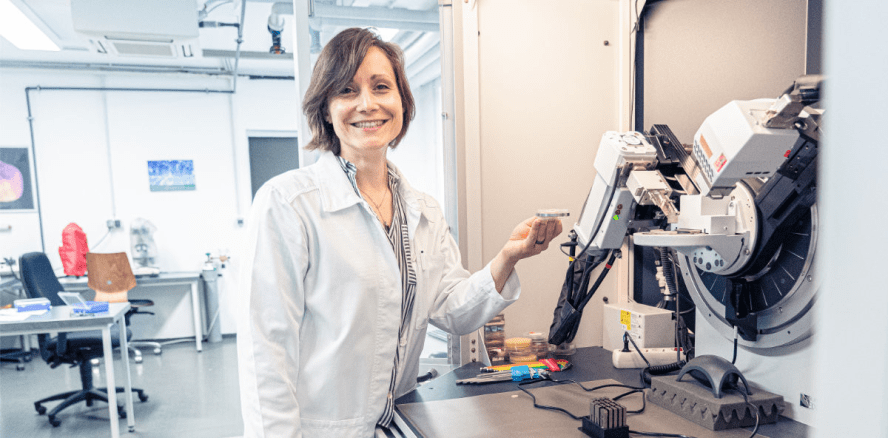





 DD cube X® ML
DD cube X® ML  DD Incisal X
DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben
DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link
DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX
DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI
DD Bio Splint P HI  DD cube case
DD cube case  DD Shade Guide
DD Shade Guide  Asiga Ultra 50
Asiga Ultra 50  THERMEO® SO
THERMEO® SO 







