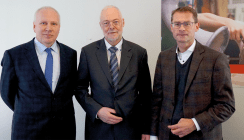Abrechnung 07.06.2016
Märkte, Interessen und berufsständische Ordnung
share
In einem exklusiven Gastbeitrag beschreibt Dipl.-Volkswirt Walter Winkler, Generalsekretär des VDZI, den Anpassungsdruck, dem das Berufsbild des Zahntechnikers ausgeliefert ist. Scharfsinnig skizziert Winkler die technologie- und marktpolitischen Dynamiken und ihre Rückkopplungsschleifen auf Veränderungen der Standespolitiken. Hieraus leitet er Reaktionsmuster ab, die zu neuen Positionen für das Zahntechniker-Handwerk führen können.
Die soziale Welt ist kontingent. Das meint, sie kann so sein, sie kann aber auch anders sein. Ob sie so oder anders ist, hängt von einer unüberschaubaren Menge von Faktoren ab. Die größten Treiber sind die jeweils historisch verfügbaren Technologien, die wirtschaftlichen Ressourcen und das herrschende Recht. Technologien eröffnen oder schließen denkbare Produktions- und Angebotsstrukturen, die Verteilung wirtschaftlicher Ressourcen definiert die jeweilige Marktdurchsetzung und das geltende Recht bestimmt den Handlungsrahmen der wirtschaftlich tätigen Akteure. Technologie ist schneller als Wirtschaft. Wirtschaft ist schneller als das Recht. Und über alles wölbt sich die Politik als demokratisches Spiel um die Neusetzung von Recht, welches im Kern nichts anderes bewirkt als die Neuverteilung von Markt- und Einkommenschancen. Hier tummeln sich alle, einzeln oder in Gruppen, die Rechtssetzung als Instrument ihrer Interessen verstanden haben. Der Einzelne strebt in dieser dynamischen Umwelt nach Selbstentfaltung und es liegt in seiner Verantwortung, gemäß seiner Fähigkeiten, darin die Chancen zu suchen, zu finden und sie für seinen Erfolg zu nutzen. Das erwartet die Verfassung der Freiheit. Anspruch auf Dauerhaftigkeit gewohnter Strukturen hat er dabei nicht – ohne eigenes Zutun überholt ihn die Veränderung und lässt ihn zurück. Eine der ordnungspolitischen Strukturen ist das Vorhandensein von Berufsbildern. Aber auch sie sind nur soziale Konstruktion und der Interessendynamik der Akteure unterworfen. Der Barbier zieht heute keine Zähne mehr – der Zahnarzt bietet keine Nassrasur. Selbstverständlich ist das nicht – das zu verstehen, ist Voraussetzung für kreative Berufspolitik. Und morgen? Die Zukunft ist offen, sie will gestaltet werden.
So wirbt die Firma Sirona in ihrer Pressemeldung für ein erweitertes Produktportfolio bei Zahnärzten mit dem Hinweis, dass sich damit der Umweg über das gewerbliche Labor erübrigen würde. Zahnersatzimporteure konzentrieren sich auf Neuanfertigungen bei erheblichem Lohngefälle und finanzieren damit ihre Werbeauftritte in Funk und Fernsehen, während der gewerbliche Zahntechniker mit eilbedürftigen Reparaturfällen dient. Und zu guter Letzt findet sich in der Ausgabe Paper FAN – FachAssistenzNews 1/16 der DZW ein Kommentar des Geschäftsführers Dr. Ingo Wolfram Paeske vom Zahnärztlichen Fach-Verlag zfv in Herne. Dieser fordert die Aus- und Fortbildung zahnmedizinischer Fachkräfte zur „Zahnmedizinischen CAD/CAM- Assistenz“, da deren Aufgaben zur Zahntechnik fließend seien und die Ausbildung dem „zukünftigen Bedarf“ angepasst werden müssten. Erste Zeichen – etwa der 1. Vorsitzende der ZBV Oberbayern, der unermüdlich Praxislaboratorien ebenso anpreist wie die „Zahnmedizinische Laborassistentin“ – deuten darauf hin, dass diese Gedanken bereits geteilt werden. Zeit also, sich dazu aus zahntechnischer Perspektive Gedanken zu machen.
Das Berufsbild des Zahnarztes
Der Status des freien Berufes ist der deutschen Zahnärzteschaft wichtig. Sie kämpft aktuell auf europäischer Ebene hartnäckig für die Beibehaltung dieser gesetzlichen Regulierungsform mit ihren besonderen Vorteilen. Die Einheit des Berufsbildes Zahnarzt erscheint der deutschen Zahnärzteschaft ebenfalls wichtig. Sie kämpft daher auf bildungspolitischer Ebene gegen dessen Zersplitterung. Die Zahnärzteschaft widersetzt sich so auch politischen Bestrebungen, das Studium der Zahnmedizin in ein Bachelor- und Master-System zu transformieren. Sie hat gute Argumente – die der Qualitätssicherung, des umfassenden Patientenschutzes und der Sicherung der Strukturqualität der Versorgung – und es dient ihren Interessen. Die umfassende zahnmedizinische Ausbildung zur Ausübung von Dienstleistungen höherer Art, der Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung und die damit verbundene Übernahme der medizinischen Diagnose- und Therapieverantwortung sind entscheidende Ordnungskriterien des freien Heilberufes. Deshalb konnten auch jahrzehntelang die Praxismitarbeiter im Berufsfeld nur als helfend begriffen werden, und weil die Helfer zumeist weiblich sind, war der Begriff der Zahnarzthelferin die übliche Berufsbezeichnung – alles unter direkter Aufsicht, um Gefahr für Leib und Leben des Patienten abzuwehren. Seit 2004 spricht man von zahnmedizinischer Fachkraft und bildet damit die Realität in der Praxis in adäquater Weise ab.
Jede ordnungspolitische Leitfigur – im Recht lediglich auf Zeit handlungsleitend konserviert – erfährt stets Irritationen und Gefährdungen durch die Wirklichkeit, die von der Suche in Technologie und Wirtschaft nach neuen, einfacheren und günstigeren Problemlösungen angetrieben wird und fortwährend vom Streben der Akteure nach Erweiterung ihrer Handlungsrechte geprägt ist. Das zahnmedizinische Wissen wächst. Neue Technologien eröffnen neue und alternative Behandlungs- und Fertigungsoptionen. Umfang und Komplexität der erforderlichen fachlichen Kompetenzen nehmen zu. Überschreitet das Wissen für eine optimale Umsetzung die Verarbeitungskapazitäten, reagiert die soziale Welt mit horizontaler oder vertikaler Spezialisierung und Bündelung der Kompetenzen durch Vertrag und Kooperation. Ein horizontaler Weg berührt dabei die Prinzipien des freien Berufes und das Konzept des einheitlichen Berufsbildes nicht zwangsläufig; auch das Grundmodell der persönlichen Leistungserbringung bleibt dabei eher gewahrt. Mit dem Weg der vertikalen Spezialisierung, der in der Zahnmedizin dominiert, sind dagegen vergleichsweise höhere Risiken der Aushöhlung mancher klassischer Kriterien des freien Berufes verbunden. Denn beispielsweise wird das Prinzip der persönlichen Leistungserbringung brüchig, wenn die bildungspolitische Eigendynamik zur Kompetenzerweiterung der zahnärztlichen (ehem. Hilfs-, heute) Fachberufe auf das individuelle ökonomische Interesse des freien Berufes Zahnarzt trifft und dies zu einer sich selbst verstärkenden vertikalen Arbeitsteilung bei zahnmedizinischen Behandlungstätigkeiten führt. Diese Verschränkung der Interessen hat zu einem Umfang des Delegationsrahmens originärer zahnärztlicher Leistungen an Personal mit abgeschlossener Ausbildung geführt, in deren Folge weiterführende Substitutionsbestrebungen erwartet werden können.
Für das traditionelle Berufsbild des Zahnarztes gilt daher: Mit jeder neuen Arbeitsteilung fern der persönlichen Leistungserbringung gerät der Zahnarzt unter berufsrechtlichen Legitimationszwang in Bezug auf die Einheit des Berufsbildes, und bei veränderten Kostenverhältnissen durch Arbeitsteilung steigt die Begründungspflicht für das Honorar, das sich prinzipiell an persönlicher Leistungserbringung bemessen soll. Mit jeder neuen Arbeitsteilung und fachlichen Kompetenzerweiterung zahnmedizinischer Fachberufe findet zudem eine Diskussion Nahrung, ob deren berufsrechtliche Freiheitsschranken als Instrument der gesellschaftlichen Gefahrenabwehr bei sich verändernder Risikoeinschätzung noch erforderlich erscheinen. Dass diese rechtspolitische Abwägung auch einem gesundheitsökonomischen Kalkül folgt, zeigen die Argumente und das Bemühen um eine Aufwertung nichtärztlicher Heil- und Hilfsberufe in der Politik. Trotz dieser Risiken für die Einheit des Berufsbildes, zeigt das zahnärztliche Behandlungssystem eine erstaunliche Offenheit für vertikale Arbeitsteilung bei zahnärztlichen Behandlungen, die in einer Ausdifferenzierung und reputationssteigernden Fortentwicklung der zahnarztnahen Berufsbilder ihren Ausdruck findet. Das Gesamtsystem erweitert insgesamt auf diese Weise seine Handlungskompetenzen und steigert seine Attraktivität für den zukünftigen Fachkräftenachwuchs.
Das Berufsbild des Zahntechnikers
Die selbstständige Ausübung des Zahntechnikerberufes ist wie bei Zahnärzten an einen spezifischen staatlich kontrollierten Nachweis einer besonderen fachlichen und persönlichen Qualifikation gebunden. Die Herstellung zahntechnischer Medizinprodukte ist eine handwerkliche Tätigkeit. Das Berufsbild und die Ausbildung sind in dem entsprechenden handwerksrechtlichen Regelwerk niedergelegt. Die Ausbildung zum Zahntechniker im dualen System wird von den gewerblichen zahntechnischen Laboren des Handwerks gewährleistet. Das Meisterprinzip ist der deutschen Zahntechnikerschaft wichtig. Sie kämpft aktuell auf europäischer Ebene für die Beibehaltung dieser gesetzlichen Regulierungsform mit ihren besonderen Vorteilen. Sie hat gute Argumente, die der Qualitätssicherung, des umfassenden Arbeits- und Patientenschutzes und der Sicherung der Strukturqualität – und es dient ihren Interessen. Die Verteidigung der Einheit des Berufsbildes Zahntechniker wird als wichtige und identitätsstiftende Daueraufgabe angesehen. Damit haben Zahnärzte und Zahntechniker prinzipiell vergleichbare Ordnungssysteme und Ordnungsinteressen. Im Kern gute Voraussetzungen für eine fachliche und politische Koexistenz mit besten Kooperationsbedingungen. Jedenfalls dann, wenn die Achtung der Ordnungsbilder gegenseitig ist.
Es ist hier vergleichend auffällig, dass das zahntechnische Handwerk zwar intensiv mit betriebsinterner Arbeitsteilung operiert, aber bisher keinerlei neue und im berufsständischen Sinne eigene aus- oder fortbildungspolitische Gestaltungsinitiativen mit einer anspruchsvollen Ausdifferenzierung von Berufsfeldbezeichnungen für die qualifizierten zahntechnischen Fachkräfte ergriffen hat. Wo ist die berufsständische Fortbildung des Gesellen zum kommunikationsstarken Kundenberater, zum medizinisch gebildeten Technikexperten zur Unterstützung des Zahnarztes am Behandlungsstuhl? Wo ist die Fortbildung zum technischen Qualitätsmanager, zum betriebswirtschaftlich geprägten Netzwerk- und Prozessoptimierer im Zeitalter der Digitalisierung? Die Effekte des technischen Fortschritts, der erfolgte Wissens- und Kompetenzzuwachs und die veränderten Qualifikationsanforderungen des Marktes werden innerhalb dieses Berufsfeldes an keiner Stelle bildungspolitisch deutlich. Stattdessen überlässt das Handwerk dieses Feld den von rein ökonomischen Interessen getriebenen freien Bildungsmärkten, die von Überkapazitäten geplagt, versuchen, mit immer neuen Angeboten an Aus- und Fortbildungstiteln die halbleeren Säle zu füllen. Eine solche Zurückhaltung steigert weder die Reputation und Wahrnehmung des Berufsstandes noch erhöht es die Attraktivität für den zukünftigen Nachwuchs.
Strukturqualität durch Berufsbilder
Berufsbilder sind nicht ewig – aber sie schaffen Ordnung und Richtung. Handlungsfreiheit wird durch berufliche Selbstbegrenzung der Handlungsfelder erworben, im konkreten Fall des Zahntechnikermeisters zu den originären zahnärztlichen Behandlungstätigkeiten des Zahnarztes. Dabei ist die gegenseitige verlässliche Einhaltung der Grenzen beider Berufsbilder durch die Politik der berufsständischen Selbstverwaltungen existenziell. Sie ist die Voraussetzung für die berufliche Qualifizierung und Spezialisierung im jeweiligen Beruf. Sie ist ein unverzichtbarer Investitionsanreiz und steigert die Innovationsbereitschaft. Die, wenn auch einseitig unvollkommene, Trennung der zahnärztlichen und zahntechnischen Berufsfelder ist maßgeblich für den hohen Entwicklungsgrad der Zahnmedizin und für die hohe Innovationsdynamik in der Zahntechnik und insgesamt für die hohe Versorgungsqualität verantwortlich. Aus diesen Gründen war und ist es die Grundauffassung des gewerblichen Zahntechnikers, dass alle tolerierten Bestrebungen, die Ordnungsprinzipien und Berufsbilder des zahnärztlichen freien Heilberufes und des handwerklich tätigen Zahntechnikers rechtlich und wirtschaftlich zu vermischen, der fachlichen Realität einer im jahrzehntelangen Wettbewerb erworbenen Kompetenzverteilung der beiden Berufe nicht entsprechen. Sie dient auch nicht den gemeinsamen berufsständischen Interessen der Verteidigung der jeweiligen ordnungspolitischen Eckpfeiler. Insofern ist die Existenz von zahntechnischen Laboren außerhalb der handwerksrechtlichen Ordnungsstrukturen nicht nur ein fachlicher und ökonomischer Anachronismus, sondern ist auch ein Zeichen einer insuffizienten Trennung der medizinischen von medizintechnischen Handlungsfelder, die im Kern ein strukturelles Hemmnis für vielfältigere und intensivere Kooperationsformen zwischen den beiden Berufen darstellt und eine Optimierung im System behindert.
Interessendynamik und Berufsbilder
Neue Technologien und daraus entstehende wirtschaftliche Möglichkeiten führen zu Fantasien über die Erweiterungen der beruflichen Handlungsfelder bei den Akteuren. Der einzelne Akteur und seine Interessengruppe ziehen und zerren, dehnen und strecken die beruflichen Grenzen. Entscheidend für die dominante ordnungspolitische Entwicklungsrichtung ist aber, ob seitens einer der autonomen berufsständischen Selbstverwaltungen der beiden Berufe beabsichtigt ist, an den ordnungspolitischen Grenzziehungen der Berufsfelder zu rütteln und dies aktiv zu befördern. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn es in zahnärztlichen Organisationen in Anlehnung an die Überlegungen von Herrn Paeske politische Bestrebungen geben sollte, die Erweiterung des Tätigkeitsbereiches von zahnmedizinischen Fachkräften auf zahntechnische Handlungsfelder zu tolerieren oder zu fördern. Dies könnte nur als ein Frontaleingriff in die berufsständische Autonomie und insbesondere als Angriff auf die Einheit des zahntechnischen, handwerklichen Berufsbildes gewertet werden, das auch die zugewiesene berufliche Zuständigkeit für die berufliche Ausbildung des Zahntechniker-Handwerks untergräbt. Ohne entsprechende konkurrierende Gegenentwürfe stünde am Ende die schleichende Usurpation der Zahntechnik in Zahnarzt-Regie. Wenn sich in solcher Weise das Bezugssystem bewegt, muss sich auch der Zahntechnikerberuf bewegen, jedenfalls dann, wenn er mindestens seine Position halten will. Problemdruck schafft Lösungsdruck. Daher ist zu erwarten, dass der Zahntechnikerberuf gezwungen ist, konkurrierende Überlegungen zu Kompetenzerweiterungen und zur Fortentwicklung des eigenen Berufsbildes anzustellen.
Denn es ist kaum vorstellbar, dass Zahntechniker einer Entwicklung zusehen könnten, in der möglicherweise die neue prothetikorientierte Assistenzkraft in Pflege- und Altersheimen zahntechnisch agiert, während der versierte selbstständige Zahntechniker als Prothesenfahrdienst herangezogen wird. Er wird es nicht für legitim halten, das orale Scannen als zahnärztliche Behandlungstätigkeit anzusehen, die man an die zahnmedizinische Fachkraft delegiert, dies aber unter Verweis auf das Berufsrecht dem selbstständigen Zahntechniker verwehrt. Auch könnte die Einführung eines Bachelor- und Master-Systems in der Zahnmedizin zu einer Renaissance des 1952 überwundenen Dentisten führen; und ist das dann nicht eine gute Aufstiegschance für hochqualifizierte Zahntechniker? Wie viele Patienten sind in den Niederlanden geschädigt worden, seit es den selbstständigen Prothetiker gibt? Welche Rolle kann ein adäquat fortgebildeter Zahntechniker zukünftig im ländlichen Raum spielen, wenn den Dorfbewohnern die Prothese bricht? Ob man es will oder nicht: Eine solche Fragenkaskade folgt der Handlungslogik bedrohter Interessen. Der Alarmismus ist begründet – er vermeidet dabei das Zuspätkommen. Was kann man vom gewerblichen Zahntechniker anderes erwarten, wenn sich mit der Ideenwelt einer zahnärztlichen Förderung neuer zahntechnischer (Teil-)Berufsbilder die Ordnungsschranken der Berufsbilder in eine einseitige Richtung weiter aufzulösen drohen, ohne dass eine standespolitisch verlässliche Gegenwehr auf zahnärztlicher Seite erkennbar wäre?
Den Entwicklungen berufspolitisch duldend zuzusehen, wird den Status des freien zahnärztlichen Heilberufes mit seiner Einheit des Berufsbildes ebenso wenig retten, wie es dem gewerblichen Zahntechniker auf diese Weise gelingen wird, im sich abzeichnenden grundlegenden Strukturwandel seine beruflichen und wirtschaftlichen Chancen zu wahren. Spätestens der Beitrag von Herrn Paeske mit seinen berufspolitischen Implikationen macht im Zusammenhang mit den Möglichkeiten und Wirkungen neuer Technologien auf die Strukturen deutlich, dass die Berufsbilder, ihre ordnungspolitischen Fundamente und ihre rechtlichen Handlungsrahmen mit der Wirklichkeit konfrontiert und neu justiert werden müssen. Den aus der Technologie- und Marktdynamik induzierten Vorstellungen und Interessenverschiebungen wird der Zahntechnikerberuf nicht lediglich mit Vorwürfen begegnen. Er wird den Vorstellungen über prothetikorientierte Berufsbilder in der zahnärztlichen Praxiswelt seine Interessen und seinen Gegenentwurf deutlich machen und konkurrierend vertreten. Dabei muss deutlich werden, dass der Zahntechnikerberuf zu jeder Zeit in der Lage sein wird, sein Berufsbild offener und dynamischer zu gestalten. Das kann und wird ihn konkurrierend in die Lage versetzen, sein exklusives Wissen und zahntechnisches Können in neue Angebotsformen zu führen, mit denen er die wirtschaftliche Zukunft in der neuen dentalen Welt mit besten Lösungen gewinnen kann.