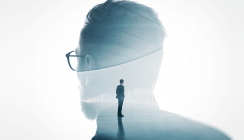Personalmanagement 01.09.2017
Gute Teamführung kann erlernt werden
share
Starke Teams zeichnen sich besonders dadurch aus, auch im stressigen Praxisalltag und bei unvorhersehbaren Herausforderungen gut zu kooperieren und souverän zu handeln. Erfahrungsgemäß leistet ein gut eingespieltes Praxisteam einen erheblichen Beitrag zum Erfolg einer KFO-Praxis.
Häufige Fehler bei der Führung eines Praxisteams
Für die Teamführung, also die Entwicklung von Mitarbeitern zu einem leistungsfähigen Team, sind Kieferorthopäden zu Beginn ihrer Tätigkeit meist nicht gerüstet. Denn im Laufe ihrer Aus- und Weiterbildungszeit erwerben Kieferorthopäden zwar unglaublich viel Fachwissen, aber darauf, dass sie irgendwann als Vorgesetzter Mitarbeiter führen sowie ggf. ein ganzes Team leiten müssen, werden sie nicht vorbereitet. Dabei lässt sich diese Art von Fachwissen genauso erlernen wie die Kunst der Patientenbehandlung. Der häufigste Fehler steckt bereits in der Annahme, dass die Mitarbeiter „das wie Erwachsene untereinander selbst regeln“. Und dies nicht nur bei der gerechten Verteilung von Aufgaben, sondern auch beim Umgang mit Konflikten im Team. Diese Haltung ist zwar gut gemeint, jedoch oft wenig hilfreich.
Bei Konflikten ist es zum Beispiel besonders wichtig, sich als Vorgesetzter frühzeitig einzuschalten. Denn Streit im Praxisteam kann schnell eskalieren und zu einer Frontenbildung oder gar Spaltung des Teams führen. Studien zufolge beschäftigen sich die Konfliktbeteiligten etwa drei bis vier Stunden pro Woche nur mit dem Konflikt und nicht mit ihrer eigentlichen Arbeit. Weiterhin existiert natürlich auch das Risiko, dass Patienten solche Streitigkeiten während ihrer Wartezeit mitbekommen und diese negativen Beobachtungen im Bekanntenkreis weitererzählen.
Teamführung im Praxisalltag häufig schwierig
Besonders im Umgang mit dem Team sehen sich Kieferorthopäden oft in Situationen, die sie irritieren. In solchen Situationen hilft etwas psychologisches Know-how, wie Teams „ticken“.
So ärgern sich viele Kieferorthopäden über das mangelnde Engagement der Einzelnen in Teambesprechungen und stellen deshalb die Effizienz solcher Besprechungen infrage. Hier sind Erklärung und Lösung aber ganz einfach: Wenn Menschen in einer Gruppe an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, reduziert sich die Leistung des Einzelnen. Der Effekt tritt immer dann ein, wenn unklar ist, wie viel jeder zur Gesamtleistung beiträgt. Dieses Zurücklehnen in der „sozialen Hängematte“ ist normal. Es ist weder die Folge mangelnder Führung noch Ausdruck von Unwillen aufseiten einzelner Mitarbeiter.
Es lässt sich jedoch ganz leicht gegensteuern, indem neben Teamaufgaben auch individuelle Aufgaben verteilt werden, die die Leistung des Einzelnen sichtbar machen. Wenn zum Beispiel als gemeinsames Praxis-Projekt geplant ist, die Patientenzufriedenheit über verbesserten Service und patientenorientierte Kommunikation zu erhöhen, dann sollten erst einzelne Aspekte – wie Telefonservice, Wartezeiten oder Kommunikation mit anspruchsvollen Patienten – zur Vorbereitung an einzelne Mitarbeiter gegeben werden. Erst im Anschluss daran wird alles mit dem gesamten Praxisteam weiterentwickelt. Bei diesem Vorgehen kann sich niemand zurückziehen, jeder Beitrag ist sichtbar.
Der ideale Mitarbeiter – Mythos oder Realität?
Einen absolut idealen Mitarbeiter gibt es wohl nicht, aber es gibt die ideale Besetzung für einen bestimmten Arbeitsplatz. Bei der Besetzung einer Stelle sollte daher darauf geachtet werden, welche Stärken und Talente der Mitarbeiter mitbringt und an welchem Arbeitsplatz er diese am besten einsetzen kann. Demgegenüber wird der Einsatz nach defizitorientierten Gesichtspunkten – nach dem Motto „Das müssen Sie jetzt ganz besonders lernen“ – eher einen negativen Effekt haben. Der entsprechende Mitarbeiter wird in diesem Bereich einfach nie so gut sein wie die Kollegen mit mehr Talent; die Fehlerhäufigkeit steigt und Demotivation ist die Folge. Ein kontinuierliches Rotieren, wie es in vielen Praxen üblich ist, sollte daher gut überlegt sein. Denn dabei arbeiten Mitarbeiter immer wieder eine ziemlich lange Zeit auf Positionen, in denen sie gegebenenfalls absolut talentfrei sind.
Neue Mitarbeiter – Qualifikation oder persönlicher Eindruck?
Die zahnmedizinischen Praxismitarbeiter sind die wichtigste „Software“ einer KFO-Praxis. Etwa 70 Prozent des Eindrucks, den ein Patient aus der Praxis mitnimmt, resultiert nicht aus der Behandlung durch den Kieferorthopäden, sondern aus dem Engagement der Mitarbeiter. Beim Bewerbungsgespräch lassen sich Kieferorthopäden häufig besonders durch die fachliche Qualifikation eines Bewerbers beeindrucken. Weitaus weniger wird ein Blick auf die persönliche Eignung geworfen, und noch weniger wird diese systematisch in das Bewerbungsgespräch miteinbezogen. Wenn ein Bewerber als Person nicht zu einem Praxisteam passt, kann dies später zu erheblicher Unzufriedenheit und sogar zur Kündigung führen.
Beispiel
Eine ZMFA wird wegen ihres hervorragenden fachlichen Könnens eingestellt. Doch nach kurzer Zeit ist die Begeisterung des Kieferorthopäden dahin, da die neue Mitarbeiterin sich grundsätzlich nicht an seine Vorgaben hält und gegenüber den Kolleginnen auf Konfrontationskurs geht.
Hier hätte schon im Bewerbungsgespräch ein Blick auf die persönliche Eignung geholfen. Die Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikations- und Kontaktfähigkeit lassen sich während eines Bewerbungsgesprächs mit einer einfachen Methode erkennen, und zwar anhand eines persönlich entwickelten Gesprächsleitfadens. Dabei sollte sich der Praxisinhaber vor dem Bewerbungsgespräch überlegen, welche Schlüsselqualifikationen für die vakante Stelle besonders wichtig sind. In einem zweiten Schritt wird eine konkrete imaginäre Situation konstruiert, in der genau diese Fähigkeit gefragt ist. Im letzten Schritt werden dann die Bewertungskriterien festgelegt, also welche Antworten der Bewerberin für den Praxisinhaber gut bis akzeptabel sind und was inakzeptabel ist. Diese individuell entwickelten Fragen werden dann in Bezug auf die zuvor konkret erdachte Situation allen Bewerbern im Vorstellungsgespräch gestellt. Ein großer Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist, dass sich die Antworten der einzelnen Bewerberinnen untereinander vergleichen lassen, wodurch die spätere Entscheidungsfindung vereinfacht werden kann.
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die fachliche Eignung eines Mitarbeiters im Nachhinein meist verbessern lässt, die soziale Kompetenz und Persönlichkeit dagegen kaum.
Eine adäquate Teamführung und -entwicklung im Praxisalltag ohne fundiertes Hintergrundwissen gestaltet sich für viele Kieferorthopäden naturgemäß sehr schwierig, da das Hauptaugenmerk auf der Behandlung von Patienten liegt. Um den Praxisinhaber zu entlasten, kann dieser wichtige Aufgabenbereich daher durchaus auf eine/-n Praxismanager/-in oder Ersthelfer/-in übertragen werden.
Dieser Beitrag ist in den PN Parodontologie Nachrichten 1+2/17 erschienen. (aktualisiert am 01.09.2017)