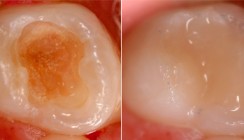Recht 16.06.2011
Behandlung von Kindern und Jugendlichen
share
Die adäquate Behandlung von Kindern ist für den Zahnarzt eine besondere Herausforderung. Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Ihre Behandlung bedarf besonderer Sensibilität und spezieller Kenntnisse. Kinderbehandlung ist zeitaufwendig und leider überwiegend „unterbezahlt“. Hinzu kommt noch, dass auch die Eltern gelegentlich für zusätzliche Probleme sorgen, sei es nun, weil sie das Kind „negativ“ auf die Behandlung eingestimmt haben, der häuslichen Mund- und Zahnpflege ihres Kindes (und ihrer eigenen) nicht die notwendige Aufmerksamkeit widmen oder sich „zu viel“ kümmern und dem Zahnarzt permanent in seine Therapie hineinreden. Auch aus rechtlicher Sicht weist die Kinderbehandlung Besonderheiten auf.
Das gilt unter anderem für die Aufklärung, die Einwilligung in die Behandlungsmaßnahme und die Frage, ob und mit wem der Behandlungsvertrag geschlossen wird und wem gegenüber der Zahnarzt sein Honorar geltend machen kann. Der nachfolgende Artikel will hier zu ausgesuchten Aspekten Hilfestellung bieten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den juristischen Fragestellungen.
Grundregeln zum
Patientenmanagement bei Kindern
Einfache, aber wichtige
Grundregeln zum Patientenmanagement bei Kindern finden sich in „Memorix
Zahnmedizin, Thomas Weber, 3. Auflage S. 127“. Danach gilt:
–
Behandle das Kind und nicht nur den Zahn!
– Bemühe dich um kurze
Wartezeiten und um ein Wartezimmer mit kindgerechter
Beschäftigungsmöglichkeit!
– Sprich mit dem Kind und sprich seine Sprache!
–
Erkläre: was, warum, wie und wann! […]. (Bei kleinen Kindern bei der
Kommunikation auf
Mundschutz verzichten.)
– Lasse das Kind antworten
und nicht die Eltern!
– Lobe gutes Verhalten (und ignoriere schlechtes)!
–
Biete keine Alternative an, wo es keine gibt!
– Lüge das Kind niemals
an!
– Mache seine Ängste niemals lächerlich.
– Setze für jede Sitzung
erreichbare Behandlungsziele und verwirkliche sie!
– Beginne mit
einfachen (und schmerzlosen) Behandlungsmaßnahmen und führe das Kind
an die komplizierteren (und eventuell) unangenehmeren Behandlungen
heran!
– Beteilige das Kind am Behandlungsgang (z.B. Speichelzieher
halten)!
– Biete dem Kind eine Kontrollmöglichkeit an, zum Beispiel
Heben der Hand, wenn eine Unterbrechung
der Behandlungsmöglichkeiten
nötig ist! Auch ein Knack-Spielzeug kann als „Signalklicker“ eine
gute
Kontrollmöglichkeit darstellen […].
– Halte die Behandlungsdauer
kurz!
– Beziehe die Eltern mit ein! Erkläre, was getan wurde und was
noch zu tun ist!
– Übernimm aber die Führung des Kindes, denn
Kinder können nicht auf zwei Erwachsene hören.
Die zahnärztliche
Untersuchung des Kindes
Bei der zahnärztlichen Untersuchung des Kindes sollte folgenden Punkten besondere Beachtung geschenkt werden:
Erfassen
medizinischer oder sozialer Probleme
– Zurückbleiben in der
allgemeinen Entwicklung, Ernährungszustand?
– Orale Manifestationen
systemischer Erkrankungen (z.B. Blutungsneigungen, Kinderkrankheiten)?
–
Anzeichen von Kindesmisshandlungen?
Erfassen von Entwicklungsstörungen
der Dentition
Anomalien der Zahnzahl, Form, Größe, Struktur?
–
Kieferorthopädisches Screening
– Durchbruchszeitpunkt und
Durchbruchsreihenfolge
– Okklusionskontrolle : Kreuzbiss, Overjet, Overbite
–
Langzeitprognose der 6er?
– Gegebenenfalls OPG mit neun Jahren, um
die Anlage und die Keimlage der bleibenden Zähne zu beurteilen.
– Ab
neun Jahren: Palpation der OK- 3er in der Umschlagfalte.
Erfassen
des Mundhygienezustandes
– Notwendigkeit individualprophylaktischer Maßnahmen?
Erfassen
dentaler Probleme (Karies …)
– Adäquate Restaurationen?
–
Milchzahn Endodontie?
– Milchzahnextraktionen?
Hinweise
Bei den ersten Terminen kommen die Eltern (oder ein Elternteil) meist noch mit. Wenn Sie schon beim ersten Kontakt mit dem Kind (oder in einer Folgesitzung) eine fachgerechte Untersuchung und Befundung vornehmen konnten, sollten Sie mit den Eltern (oder einem Elternteil) die sich daraus ableitenden einzelnen Behandlungsmaßnahmen (Therapieplanung) ausführlich besprechen und dies auch sorgfältig dokumentieren. Teilen Sie den Eltern mit, was im Einzelnen notwendig ist, insbesondere ob Anästhesien, Füllungen, Extraktionen, Wurzelkanalbehandlungen, Röntgenbilder, Zahnreinigungen durchgeführt werden müssen. Sind (bei bestehender gesetzlicher Krankenversicherung) zuzahlungspflichtige Maßnahmen erforderlich ? Sollen nur zuzahlungsfreie Leistungen erbracht werden? Klären Sie ab, in welchen Fällen die Eltern (vorher!) gesondert unterrichtet werden wollen (z.B. vor Röntgenbildern, Extraktionen, Wurzelkanalbehandlungsmaßnahmen usw.), damit sie ihre Zustimmung rechtzeitig erteilen können. Machen Sie dies am besten schriftlich, wobei beide Eltern unterschreiben sollten. So vermeiden Sie Konflikte mit den Eltern oder unangenehme finanzielle oder juristische Überraschungen!
Lassen
Sie sich die Kontaktdaten geben
– Telefonnummer der Mutter und
des Vaters (nach Möglichkeit zu Hause und an der Arbeitsstelle
– wann
jeweils am besten erreichbar).
– Handynummer der Mutter und des Vaters
(Privathandy und nach Möglichkeit die Handynummer
der ggf. vom
jeweiligen Arbeitgeber gestellten Handys).
– Anschriften (bei
Getrenntleben beider Elternteile
– bei welchem Elternteil lebt das
Kind).
Wichtig, sofern eine Kontaktaufnahme notwendig wird.
Klären
Sie (auch) die Familienverhältnisse ab!
– Leben die Eltern
getrennt?
– Sind sie geschieden? Wer ist der Sorgeberechtigte?
–
Besteht eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft?
– Ist das Kind nicht
ehelich?
Die Klärung dieser Fragen ist unter anderem wichtig für Ihr
Honorar.
Bei sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten (mit den
Eltern oder dem Kind)
Gibt es z.B. Verwandte oder ältere
Geschwister mit entsprechenden Sprachkenntnissen, die in die
Behandlung mitkommen und übersetzen können? (Wie sind diese
telefonisch oder per Handy zu erreichen?)
Die Behandlung von
Kindern und Minderjährigen aus juristischer Sicht
Behandlungsvertrag
Der
zahnärztliche Behandlungsvertrag ist nach herrschender Meinung ein Dienstvertrag
(§§ 611, 627 BGB). Er kommt wie jeder Vertrag durch zwei gleichlautende
Willenserklärungen – Angebot und Annahme – zustande. Vertragsparteien
sind regelmäßig der Zahnarzt und der Patient. Davon gibt es
Ausnahmen.
a) Behandlungsvertrag mit einem Kind?
(bis zur
Vollendung des 7. Lebensjahres) Willenserklärungen von Kindern sind nichtig
(§§ 105 Abs.1 BGB iVm § 104 Nr. 1 BGB). Kinder können demnach keinen
Behandlungsvertrag mit dem Zahnarzt schließen.
b)
Behandlungsvertrag mit einem Minderjährigen?
(ab vollendetem 7.
Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs – Jugendlicher)
Minderjährige
sind in ihrer Geschäftsfähigkeit nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 BGB
(§ 106 BGB) beschränkt. Willenserklärungen von Minderjährigen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung (vorher) oder der Genehmigung (nachher)
des oder der gesetzlichen Vertreter (§§ 107, 108 BGB). Minderjährige können
also bei (vorheriger) Einwilligung oder (nachträglicher) Genehmigung des
gesetzlichen oder der gesetzlichen Vertreter einen wirksamen Behandlungsvertrag
schließen. Möglich ist auch, dass der Minderjährige als Bote des
gesetzlichen Vertreters dessen Willenserklärung übermittelt und der
Vertrag durch Annahme des Arztes zwischen diesem und dem gesetzlichen
Vertreter des Patienten mit dem Minderjährigen als berechtigten Dritten
im Sinne des § 328 BGB zustande kommt.
Sonderfälle
Ein
Vertrag, durch den ein Minderjähriger nur einen rechtlichen Vorteil erlangt, ist
auch ohne Einwilligung (oder Genehmigung: § 108 BGB) des
Vertretungsberechtigten/ der Vertretungsberechtigten wirksam (§ 107
BGB). Nun erleidet ein Minderjähriger, der sozial versichert ist,
durch den Vertragsschluss mit dem Arzt regelmäßig keinen Nachteil, da
ihn keine Zahlungspflicht trifft. Ein solcher Vertrag wäre demnach wirksam.
Anders wäre dies, wenn der Vertrag über eine zuzahlungspflichtige (oder
mehrkostenpflichtige) Leistung ginge, da hier wiederum ein rechtlicher Nachteil
für den Minderjährigen entstünde. Beispiele hierfür sind
SDA-Rekonstruktionen oder Inlays.
Familienversicherte Minderjährige
ab 15 Jahre
Seit dem 01.01.1989 hat der über die Familie
mitversicherte Minderjährige einen eigenen Leistungsanspruch nach §
10 SGB V. Diesen Leistungsanspruch kann der Minderjährige mit Vollendung des
15. Lebensjahres gemäß § 36 Abs.1 SGB I (Sozialmündigkeit) selbstständig geltend
machen. Die Zustimmung des oder der Sorgeberechtigten ist nicht
erforderlich, wenn die Voraussetzungen einer partiellen Geschäftsfähigkeit
(§§ 112, 113 BGB) vorliegen, wonach der Minderjährige im Rahmen
der normalen Geschäfte eines ihm vom gesetzlichen Vertreter gestatteten Dienst-
oder Arbeitsverhältnisses (§ 113 BGB) oder für solche Geschäfte, die
der genehmigte Betrieb eines Erwerbsgeschäftes (§ 112 BGB) mit sich bringt,
unbeschränkt geschäftsfähig ist. So kann der Arzt regelmäßig den Minderjährigen
bei Vorlage einer KVK (§ 291 SGB V) oder einer elektronischen Gesundheitskarte
als unbeschränkt geschäftsfähig ansehen, wenn die Behandlung der
Erhaltung oder Wiederherstellung der Arbeitskraft dient.
„Taschengeldparagraf“
(§ 110 BGB)
Es sind Fälle denkbar, in denen der Minderjährige die
Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm vom gesetzlichen Vertreter/ den
gesetzlichen Vertretern zur freien Verfügung oder mit dessen/deren Zustimmung
von einem Dritten überlassen worden sind. Beispiel: Eine 15-Jährige
kommt in die Zahnarztpraxis und lässt sich ein Steinchen auf einen
Schneidezahn kleben. Sie zahlt in bar. Erfüllt der minderjährige Patient
mit ihm überlassenen Mitteln den Arztvertrag, so ist der Vertrag von Anfang
an wirksam. Das gilt sowohl für das Verpflichtungs- als auch für das Erfüllungsgeschäft.
c)
Behandlungsvertrag mit den Eltern
Bringen die Eltern ein Kind in die Sprechstunde,
sind sie im Zweifel Vertragspartner des Arztes. Es besteht ein berechtigender
Vertrag (§ 328 BGB) zugunsten des Kindes. Als Vertragspartner des
Arztes sind die Eltern, wenn dem Kind durch medizinische Maßnahmen ein
Schaden entsteht, berechtigt, in den durch den Schaden gezogenen Grenzen
den Mehraufwand für Pflege und Versorgung als eigenen Schaden geltend
zu machen, soweit sich dieser Aufwand als vermehrte Unterhaltslast niederschlägt. Beachte:
Bei der Behandlung von Kindern oder minderjährigen Angehörigen sind
mehrere Fallgestaltungen möglich. So können die Eheleute zusammen oder getrennt
leben, die Ehefrau kann noch minderjährig sein. Die Ehe kann
geschieden sein. Weiterhin ist zu unterscheiden, ob die Ehefrau oder
beide Elternteile das Kind in die Behandlung bringen oder nur der Ehemann oder
ob der Minderjährige selbst den Behandlungsvertrag schließt.
Vertragsparteien
bei bestehender Ehe der Eltern
1. Die Eheleute leben nicht getrennt
Mangels
anderer Anhaltspunkte kann der Zahnarzt zunächst davon ausgehen, dass
Eheleute nicht getrennt leben. Sucht die Ehefrau den Zahnarzt auf und lässt
das gemeinsame Kind behandeln, so kommt der Behandlungsvertrag zwischen beiden
Ehegatten und dem Arzt zustande. Dies gilt auch, wenn der Ehemann das
Kind in die Behandlung bringt. Schließt ein Ehegatte zugunsten des
Kindes einen Arztvertrag ab, wird der Ehepartner durch diesen
Vertragsschluss unmittelbar selbst verpflichtet. Es gilt § 1357 BGB „Geschäfte zur
Deckung des Lebensbedarfs“, wonach jeder Ehegatte berechtigt ist,
Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit
Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche
Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn,
dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt (§ 1357 Abs. 1, S2
BGB) oder ein Ehegatte die Berechtigung des anderen beschränkt oder
ausgeschlossen hat (§ 1357 Abs. 2 BGB). § 1357 BGB erfasst alle
Geschäfte zur Deckung des persönlichen Bedarfs von Familienangehörigen,
also auch Arztund Krankenhausaufnahmeverträge, die von einem
Ehegatten zugunsten eines Kindes abgeschlossen werden. Es spielt im
Übrigen für die Schlüsselgewalt keine Rolle, ob nur einer oder beide
Ehegatten über ein eigenes Einkommen verfügen.
2. Die Eheleute leben
getrennt
Nach § 1357 Abs. 3 BGB greift die „Schlüsselgewalt“ der
Ehegatten nicht ein, wenn sie getrennt leben. Allerdings führt eine
nur vorübergehende Trennung noch nicht zum Verlust der Schlüsselgewalt.
Die Schlüsselgewalt ruht jedoch, wenn die Ehegatten im „juristischen
Sinne“ getrennt leben, d.h., wenn sie nach außen hin erkennbar die
häusliche Gemeinschaft aufgegeben haben und sie auch nicht wiederherstellen
wollen. Trotz gemeinsamer Wohnung kann die häusliche Gemeinschaft
aufgehoben sein (1567 BGB), wenn die Eheleute z.B. die Wohnung abgeteilt
haben und in getrennten Zimmern wohnen, sodass die eheliche
Gemeinschaft aufgehoben ist. Keine Trennung liegt vor, wenn ein Ehegatte längere
Zeit verreist, in einer Anstalt untergebracht ist, sich im Kriegsdienst oder
in Gefangenschaft befindet oder eine Freiheitsstrafe verbüßt. Entscheidend ist
vielmehr der Wille, ein gemeinschaftliches Hauswesen aufrechtzuerhalten. Lebten
die Eheleute zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zusammen, schadet
eine spätere Trennung nicht. Hinweis: Da für den Arzt zumeist nicht erkennbar
ist, ob die Schlüsselgewalt durch Getrenntleben ruht, sollte er sich entsprechend
bei den Ehegatten erkundigen. Tut er dies nicht, so ist sein guter
Glaube an das Zusammenleben der Ehegatten in häuslicher Gemeinschaft nicht
geschützt. Folge: Nur der Ehegatte, der das Kind in die Behandlung
gebracht hat, wird Vertragspartner. Eine Ausnahme hiervon ist
anzunehmen, wenn der die Erklärung abgebende Ehegatte dies ausdrücklich im
Namen des anderen Ehegatten oder gar nur für diesen abgibt.
Vertragparteien
bei geschiedener Ehe der Eltern
Ist die Ehe der Eltern geschieden, wird grundsätzlich nur der Elternteil durch den Arztvertrag berechtigt und verpflichtet, der mit dem Kind den Arzt aufgesucht oder den Arzt hinzugezogen hat. Eine Ausnahme ist denkbar, wenn z.B. die Ehefrau ausdrücklich im Namen und in Vollmacht ihres geschiedenen Ehemannes handelt. Hat ein Arzt wegen des Honorars für erbrachte Leistungen gegen eine Ehefrau Ansprüche, so ist er berechtigt, die Freistellungsansprüche der Ehefrau nach den §§ 683, 679, 16001ff. BGB zu pfänden und sich zur Einziehung überweisen zu lassen. Der Arzt erwirbt dann einen Zahlungsanspruch gegen den geschiedenen Ehemann.
Innenverhältnis
bei geschiedener Ehe der Eltern
Das Innenverhältnis zwischen dem zahlungspflichtigen und unterhaltspflichtigen Elternteil bleibt vom Außenverhältnis (Arzt, vertragsschließender Elternteil) unberührt. Gegen den Unterhaltspflichtigen besteht ein Unterhaltsanspruch des Kindes aus § 1601 BGB, der gemäß § 1629 Abs. 1 BGB von dem anderen Elternteil im Namen des Kindes geltend gemacht werden kann.
Vertragsparteien bei
nicht ehelicher Lebensgemeinschaft
In diesen Fällen wird - wenn nicht eine Vollmacht vorliegt - nur der Elternteil aus dem Arztvertrag verpflichtet, der das Kind in Behandlung gab. Gleiches gilt für die Behandlung nicht ehelicher Kinder. Hier wird im Zweifel nur die Mutter Vertragspartner des Arztes, die wiederum im Innenverhältnis Ausgleichs- und Befreiungsansprüche gegen den Vater hat. Für die minderjährige Mutter muss der (volljährige) Vater des Kindes oder der Vormund des Kindes den Behandlungsvertrag schließen.
Was ist, wenn die
Eltern zahlungsunfähig sind?
Der Minderjährige hat für das Entgelt auch dann nicht einzustehen, wenn die Eltern zahlungsunfähig sind. Weder besteht zwischen dem Arzt und dem Kind ein abgeschlossener Vertrag noch haftet der Minderjährige aus Billigkeit oder Geschäftsführung ohne Auftrag.
Aufklärung und
Einwilligung bei Kindern und Minderjährigen
Jeder ärztliche Heileingriff (ob gelungen oder misslungen) ist eine tatbestandliche Körperverletzung, die durch Einwilligung nach vorheriger ordnungsgemäßer Aufklärung gerechtfertigt ist. Aufklärungsadressat ist, wer die Einwilligung in die Behandlung zu geben hat. Dies ist bei minderjährigen Patienten der gesetzliche Vertreter (in der Regel die Eltern). Minderjährigen Patienten kann gegen die Fremdbestimmung der Eltern ein Vetorecht bei nur relativ indizierten Eingriffen mit möglichen erheblichen Folgen für die künftige Lebensgestaltung zustehen, wenn sie ausreichende Urteilsfähigkeit haben. Dann sind auch sie aufzuklären. Nach Deutsch hat die Betonung des Persönlichkeitsschutzes dazu geführt, dass heutzutage jugendliche Patienten, die zu ermessen vermögen, was mit ihnen vorgeht, gleichfalls in die Mitteilungssituation einzubeziehen sind. Die Aufklärung über den Verlauf der Behandlung und seine Risiken hat unabhängig davon zu geschehen, ob der Patient selbst zustimmen kann oder nicht. Dem Eingriff beim Minderjährigen müssen grundsätzlich beide Eltern zustimmen. Indes kann jeder Elternteil den anderen ermächtigen, für ihn mitzuhandeln; dann bedarf es nur der Aufklärung des so ermächtigten Elternteils. Geht es um Routinefälle (Alltagsfälle), dann kann der Arzt von einer Ermächtigung des mit dem Kind erschienenen Elternteils ausgehen, solange nicht anderes bekannt ist. Bei geschiedenen Eltern richtet sich die Person des Aufklärungsadressaten nach dem Sorgerecht. Bei schwerwiegenden und komplikationsträchtigen Eingriffen empfiehlt es sich, die Einwilligung beider Elternteile einzuholen oder die Person des Aufklärungsadressaten zunächst sicher zu bestimmen.
Auseinanderfallen
von Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit
Da für die Einwilligung in einen Heileingriff keine Geschäftsfähigkeit erforderlich ist, kann es geschehen, dass der Minderjährige zwar in den Heileingriff wirksam eingewilligt hat, aber kein wirksamer Vertrag (als Grundlage für den Honoraranspruch des Arztes) zwischen ihm und dem Arzt zustande gekommen ist, weil die Eltern nicht in den Vertrag eingewilligt oder ihn genehmigt haben. Es entsteht dann zwar keine strafrechtliche Problematik für den Arzt, er erhält aber möglicherweise kein Honorar.
Schweigepflicht
Ärzte unterliegen der Schweigepflicht. Bezugspunkt der ärztlichen Schweigepflicht ist das Geheimnis, d.h. eine Tatsache, die nur einem bestimmten, abgrenzbaren Personenkreis bekannt ist und an deren Geheimhaltung der Patient ein „verständliches“, also sachlich begründetes und damit schutzwürdiges Interesse hat. Auch minderjährigen Patienten gegenüber ist der Arzt grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, doch besteht bei fehlender Verstandesreife und mangelnder Einsichtsfähigkeit ein Informationsrecht der Eltern. Verfügt ein Minderjähriger über die erforderliche Reife zur eigenverantwortlichen Entscheidung, darf der Arzt ohne oder gegen seinen erklärten Willen weder über den Arztbesuch selbst noch über den Grund oder das Ergebnis der Untersuchung den Eltern Auskunft erteilen.
Schweigepflicht auch bei
Kindesmisshandlung?
Bei ernsthaften Anzeichen für Kindesmissbrauch oder
Kindesmisshandlungen (vor allem bei Wiederholungsgefahr) kann der
Arzt die Polizei benachrichtigen. Anknüpfungspunkt für die Befugnis
zur Offenbarung ist hier § 34 StGB „Rechtfertigender Notstand“.
Zusammenfassung
Die Behandlung von Kindern (und Minderjährigen) bringt für den Zahnarzt eine Reihe von Herausforderungen. Sie betreffen unter anderem die Behandlung selbst, aber auch rechtliche Fragen wie Vertragsschluss, Honorarschuldner, Aufklärung, Einwilligung oder Schweigepflicht.