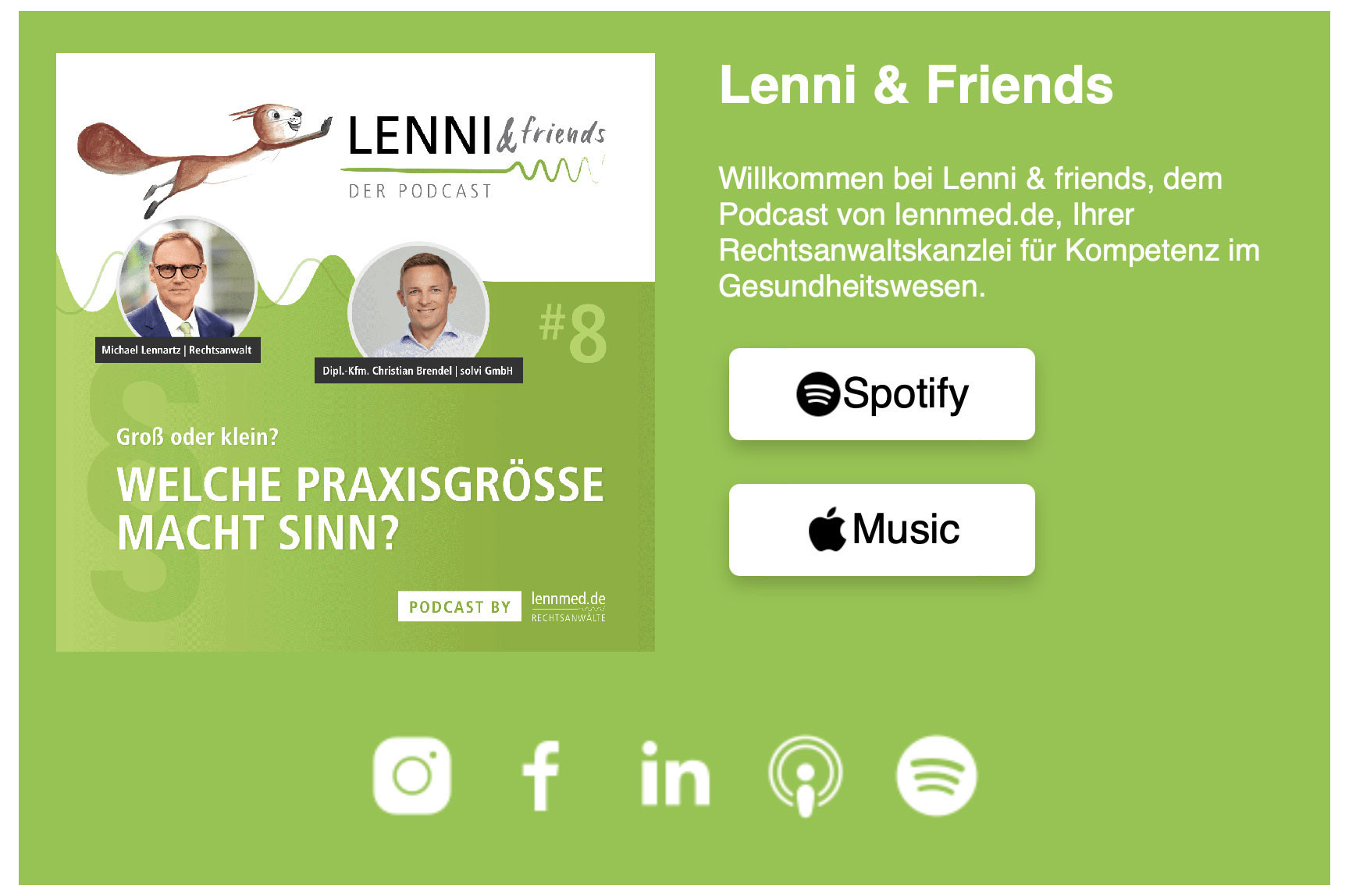Recht 15.10.2025
Gold-Call in der Zahnarztpraxis: Bundesverwaltungsgericht zieht klare Linie
share
Wer kennt ihn nicht, den Anruf während der Sprechstunde. Das Bundesverwaltungsgericht befasste sich in seinem Urteil vom 29.01.2025 mit der Frage, ob telefonische Kalt-Akquise rechtmäßig ist.
Der Fall
Die Klägerin ist ein europaweit tätiges Unternehmen, das Edelmetallreste aus Zahnarztpraxen und Dentallaboren ankauft. Zur Kundenakquise nutzte sie öffentlich zugängliche Verzeichnisse (z. B. „Gelbe Seiten“), um Namen, Anschriften und Telefonnummern von Praxisinhabern zu sammeln und in einer eigenen Datenbank zu speichern. Anschließend wurden die Praxen telefonisch kontaktiert, um mögliche Verkaufsinteressenten abzufragen. Beim Erstkontakt wurden die Dienstleistung erläutert und bei Interesse auch weitere Details zum Ankaufsprozess dargestellt.
Im Jahr 2017 erließ dann die zuständige Behörde am 10. Januar 2017 einen Bescheid, der dem Unternehmen untersagte, ohne Einwilligung oder bestehende Geschäftsbeziehung telefonische Werbung zu betreiben.
Untersagung telefonischer Werbung
Das Unternehmen war mit der Untersagung dieser Praxis nicht zufrieden. Rechtsgrundlage war damals die alte Fassung des § 38 Abs. 5 S. 2 Bundesdatenschutzgesetz.
Durch die Klage sollte eine Neubewertung des alten Bescheides stattfinden, da die Klägerin davon ausging, dass sich die Rechtslage änderte. Auf diesem Wege wollte die Klägerin erreichen ihre frühere Praxis der Telefonakquise wieder aufnehmen zu können.
Zur Begründung verwies sie auf das „berechtigtes Interesse“ aus Art. 6 DSGVO. Die Behörde sah dies jedoch anders und verwies insbesondere auf die Vorgaben des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, wonach Telefonwerbung ohne vorherige Einwilligung unzulässig sei.
Entscheidung
Das Gericht entschied, dass die Klägerin eine solche Akquise nur mit Einwilligung des Betroffenen durchführen dürfe. Eine Berufung auf ein berechtigtes Interesse aufgrund ihrer gewerblichen Tätigkeit sei dahingehend ausgeschlossen.
Das Gericht stellte fest, dass weder die DSGVO noch das UWG den Begriff „Werbung“ genauer definiere. Eine Unterscheidung zwischen „Direktwerbung“ und „Nachwerbung“ gebe es in diesen Gesetzen nicht – sie erfasse Werbung im Allgemeinen und nicht im Detail.
Zudem sei bei der Interessenabwägung für ein sog. „berechtigtes Interesse“ das Wettbewerbsrecht als Auslegungshilfe heranzuziehen, um die Grenze zwischen zulässiger und unzulässiger Datenverarbeitung zu bestimmen.
Das BVerwG wies die Beschwerde der Klägerin zurück.
Quelle: lennmed.de