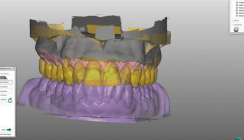Zahntechnik 03.03.2017
Hightech trifft auf „Oldschool“
Die folgende Situation beschreibt einen Patienten mittleren Alters, der trotz guter Zahnpflege mehrere Zahnverluste zu beklagen hatte. Aufgrund seines Alters war er leider nicht bereit, den fertiggestellten Zahnersatz in situ dokumentieren zu lassen. Deshalb möchte ich hier die gut funktionierende Kombination von digitalem Zahnersatz und der guten „alten“ Modellgussprothese beschreiben. Wichtig hierbei ist mir im Einzelnen das Thema „Funktion“ im hochdynamischen System versus starrem System, sprich Artikulator, zu erläutern.
Das Problem „Chipping“ kursiert immer wieder in vielen Köpfen der Behandler und viele Labore suchen verzweifelt nach den Ursachen bzw. nach Lösungen. Es werden geänderte Brandführungen ausgetüftelt, mit oder ohne Langzeitabkühlung, diverse Bonder werden ausprobiert, bis hin zu dem, meiner Meinung nach, sinnlosem Wechsel der Gerüst- oder Verblendmaterialien. Meine Ansicht dazu: „Leute, lasst es bleiben.“ Kein Hersteller, ob Edelmetalle, Zirkone, Glaskeramiken oder Feldspatkeramiken kann es sich heutzutage leisten „schlechte“ Materialien anzubieten. Alle, ausgenommen eventuelle Materialien aus „Grauzonenmärkten“, sind qualitativ auf hohem Niveau. Sie werden bei richtiger Verarbeitung somit nicht einfach „chippen“. Voraussetzung ist, dass die Funktion stimmt, worauf ich später noch im Besonderen eingehen werde.
Patientenfall
Im Oberkiefer werden die Zähne 17, 15, 14 und 24 mit VMK-Kronen, vollverblendet und mit Auflagen für den folgenden Modellguss versehen. Die Versorgung von Zahn 22 erfolgt mit einer Vollkeramikkrone aus Zirkon, vollverblendet. Die Modellherstellung erfolgt mit dem System Giroform® (Amann Girrbach); (Abb. 1–3). Dies ist die Grundlage des sogenannten „Modellmanagements“, die durch spezielles Pinsetzen und definierte Sägeschnitte die lineare Gipsexpansion eliminiert. Der ausgegossene Zahnkranz muss nach 30 Minuten von der Splitcast-Platte abgezogen werden, da er sich nach Einsetzen der Expansion nicht mehr abheben lässt.
Egal welche Situation abgeformt ist, werden immer Sägeschnitte zwischen den Zähnen 3 und 4 sowie zwischen den 1ern gesetzt. Jeder weitere Schnitt erfolgt nach Anordnung der präparierten Zähne. Neben jedem Stumpf muss immer ein einzelnes Segment gesägt werden, um mesial und distal einen exakten Kontaktpunkt zu erhalten. Je größer das Segment neben dem Stumpf, desto größer die Expansion in Richtung der „Lücke“. Die fertigen und präparierten Zahnkränze sind in den Abbildungen 4 und 5 zu sehen. Anschließend wird der Oberkiefer mithilfe eines Artex®-Übertragungsstandes passgenau in den Artex® CR (Amann Girrbach) übertragen (Abb. 6). Nach der Artikulation des Unterkiefers wird der Artex® CR „programmiert“ und diese Werte später virtuell übertragen. Im Weiteren folgt das „Modellmanagement“. Wenn Kronen „zu hoch“ oder Kontaktpunkte zu stramm bzw. zu locker sind, begeben wir uns auf Fehlersuche. Abformung? Kontraktion der Abformmasse? Expansion? Sehr beliebt ist hier die Anpreisung von Gipsen mit „0-Prozent-Expansion“, doch das wäre Magie. Ein Gips muss expandieren, sonst würde keine Krone mehr passen. Wir können nur die Fehlerquellen minimieren, d. h. manch „Sparfuchs“ sollte sich von seinen Artikulations-Gipssockeln trennen, denn hier findet man die größten Ungenauigkeiten. Je weniger Gips zwischen Modellen und Artikulator, desto genauer können wir arbeiten. Meine Empfehlung: Arbeiten Sie mit Kunststoffplatten. Wir übertragen also ein stomatognathes, flexibles System (Patientenmund) in ein starres System, sprich Artikulator bzw. Modellen aus Gips.
Das skelettale System des Körpers ist darauf ausgelegt, hohen Belastungen standzuhalten. So sorgt die Mikrostruktur des Körpers dafür, dass auch bei erhöhter Krafteinwirkung keine Schäden entstehen. Das gleiche trifft auf den Kauapparat zu. Hier wirken im Seitenzahnbereich enorm hohe Kräfte von bis zu mehreren Hundert Kilogramm pro Quadratzentimeter.Der Artikulator ist starr, er weist keinen „Stoßdämpfer“ im Gelenk auf. Des Weiteren simuliert das Gipsmodell weder die Einzelzahnbewegung noch die dreidimensionale Verwindung der Unterkieferspange.1 Jetzt ermöglicht aber die Knochenstruktur des Unterkiefers zur Kompensation der großen auftretenden Kaukräfte die o. g. Verwindung der Unterkieferspange bei der Mundöffnung. Genau diese Fehlerquelle, nämlich bei der Abdrucknahme bei geöffnetem Mund, müssen wir mit einem geeigneten Modellsystem ausgleichen. Ohne groß ins Detail zu gehen, liegen diese Werte bei circa 0,08% (Herstellerangabe), führt aber bei einem tangentialen Zahnkranzmaß von ca. 8 Zentimeter zu einer Abweichung von 0,64 mm. Dieser Wert wird unseren Anforderungen absolut nicht gerecht. Diese Abweichung wird durch die o. g. Sägeschnitte ausgeglichen. Demzufolge wäre die Krone zwangsläufig zu hoch, da die Höcker im Schlussbiss im Mund tiefer liegen als auf unserem Modell.1 Folgerichtig muss die korrekte Höhe der Okklusion eingestellt werden. Durch gezieltes Entfernen einzelner Segmente und eine spezielle Einschleiftechnik der Gipszähne vermesse ich die korrekte Bisshöhe bzw. die Bisserhöhung.
Leider trennt sich hier oft die Spreu vom Weizen. Bei hochgesteckten Zielen in Bezug auf die Genauigkeit des anzufertigenden Zahnersatzes kommt man an einem Arcon-Artikulator nicht vorbei. Viele Kolleginnen und Kollegen meinen jedoch, dass sich der Aufwand nicht lohnt, sowohl zeitlich als auch finanziell. Teilweise haben diese Kollegen natürlich Recht. Allerdings nützt alles ohne Gesichtsbogen und Konstruktionsbisse nichts. Auch dies stimmt. Aber: Ein volljustierbarer Artikulator (halbgenutzt) ist immer noch die bessere Variante als ein „voll“ genutzter Mittelwert-Artikulator1.
Wenn wir genau gearbeitet und die Systematik des Modellmanagements richtig angewandt haben, hat unsere Krone im Mund die Kontaktpunktverteilung, wie wir sie im Artikulator angelegt haben. Bei der Höhenkontrolle mit Shimstockfolie, die eine Dicke von 8 µm hat, wird überprüft, ob der Patient sowohl mit seiner Restbezahnung als auch mit der Krone die Shimstockfolie halten kann. Das ist der Nachweis dafür, dass der von uns angefertigte Zahnersatz tatsächlich eine Genauigkeit im Bereich der angeforderten 8 µm aufweist. Somit haben wir in Handarbeit einen wirklich funktionierenden Zahnersatz erarbeitet .1 Eigene Erfahrungen bestätigen seit über acht Jahren eine erfolgreiche Herstellung passender Kronen ohne Einschleifen – und vor allem ohne „Chipping“. Wie im Vorfeld erwähnt – wenn die Funktion in der Statik sowie in der Dynamik stimmt, kann ein Abplatzen der Keramik nahezu ausgeschlossen werden. Sollte schon bei den dynamischen Bewegungen das Gerüst der Keramik zu wenig Platz bieten, ist ein „Chipping“ vorprogrammiert, durch relativ einfache Maßnahmen aber zu verhindern. Die „analoge“ Situation im Artikulator muss jetzt in den virtuellen Artikulator übertragen werden (Abb. 7 – 9). Nach dem Scannen wird nun der virtuelle Artikulator „programmiert“. Da in diesen Fall keine Konstruktionsbisse mitgeliefert wurden, blieb der Bennett-Winkel auf 5° und die Gelenkbahnneigung mittelwertig auf 35°. Durch Abfahren der Gipszähne ergaben sich auf dem individuellen Führungsteller folgende Werte:
- Protrusion: 40°
- Laterotrusion links: 19°
- Laterotrusion rechts: 22°
Die benötigten Freiräume (immediate sideshift) auf der Kaufläche belasse ich immer bei 0,5 mm (Abb. 10). Folgende Schritte können wir relativ schnell bebildert durchgehen: Nach Festlegung der Präparationsgrenzen (Abb. 11) bietet das Programm eine provisorische Aufstellung an (Abb. 12). Nachdem die Zähne richtig platziert wurden, lässt man den virtuellen Artikulator die Kiefergelenkbewegungen abfahren und die Durchdringungen in der Dynamik werden abgeschnitten.Dieser Schritt ist enorm wichtig, zurückblickend auf das Modellmanagement ist es unerlässlich, genug Platz für die Keramik zu schaffen. Nur so ist ein „Chipping“ auszuschließen (Abb. 13). Danach kann, unter Beachtung der Gerüstmindeststärken, das Gerüst geschrumpft werden (Abb. 14). Anschließend werden die Verbinder platziert (Abb. 15) und die fertigen Teile zusammengefügt. Der fertige Datensatz kann nun gefräst werden (Abb. 16). In diesem Fall wird das Material ceramill® zolid (Amann Girrbach) verwendet. Mit der Keramik ZI-F (Creation Willi Geller) wurden die Gerüste verblendet (Abb. 17 und 18). Nun werden die VMK-Kronen im OK für den späteren Modellguss modelliert und in NEM umgesetzt. Das Meistermodell wird in herkömmlicher Weise mit einem individuellen Löffel und den Gerüsten abgeformt, mit Kunststoffstümpfen versehen und ausgegossen (Abb. 19 und 20). Die Keramik Creation CC (Creation Willi Geller) wurde zur Verblendung genutzt (Abb. 21). Nach Fertigstellung der Kronen wird, wie es sich seit vielen Jahren bewährt hat, der Modellguß vorbereitet (Abb. 22), dubliert (Abb. 23), modelliert (Abb. 24) und ausgearbeitet (Abb. 25). Ein Tipp zum Dublieren: Die besten Ergebnisse langer Tüfteleien erhalte ich mit einer Shore-Härte von 22–24 in einem Küvettenrahmen, aber ohne Stabilisierungseinsatz. Die fertige Arbeit in Kunststoff ist in Abbildung 26 zu sehen.
Persönliches Fazit
Wie zu Anfang erwähnt, kam es mir in meinem Bericht weniger auf die Situation im Mund des Patienten an, sondern vielmehr auf die Herstellung eines funktionell einwandfreien Zahnersatzes in Kombination der „digitalen“ und der „alten Handwerkskunst“. Vielmehr beschreibe ich hier unser tägliches Brot, unseren Alltag. Es mag viele toll fotografierte Kauflächen mit 100 Nebenfissuren geben, aber mal ehrlich: Gibt es viele Kunden, die das möchten und auch bezahlen? Ich denke nicht. Ebenso können immer mehr zahntechnische Bereiche mit CAD/CAM abgedeckt werden. Aber ob die digitale Welt das „Allerheilmittel“ in der heutigen Zahntechnik ist, möchte ich bezweifeln. Die gute alte Handarbeit hat in meinem Labor immer noch „goldenen Boden“.
Verwendete Materialien
- Gips: Klasse 4
- Verblendkeramik: ZI-F und CC von Creation Willi Geller
- Gerüstkeramik: Ceramill ZOLID von Amann Girrbach
- NEM: Sheralit von SHERA; Nemo Aufbrennlegierung Klasse 4
- Einbettmassen: Sheracast 2000 und Dreibettmasse Klasse 4
- Kunststoff: Aesthetic Blue von CANDULOR
- Kunststoffzähne: Physiostar NFC und Bonartic II NFX von CANDULOR
1 Liebel M. Der Schlüssel zum Erfolg. Funktionierender Zahnersatz mit Modellmanagement. dental dialogue 2009(3):88-101.
Autor: ZTM Oliver Krutsch
Dieser Beitrag ist erstmals in der Zahntechnik Zeitung 3/17 erschienen.


 DD cube X® ML
DD cube X® ML  DD Incisal X
DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben
DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link
DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX
DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI
DD Bio Splint P HI  DD cube case
DD cube case  DD Shade Guide
DD Shade Guide  Asiga Ultra 50
Asiga Ultra 50  THERMEO® SO
THERMEO® SO