Branchenmeldungen 19.05.2025
Zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung: Die Dentalbranche im Spagat
share
Es liegt daher nahe, dass diese Wertvorstellungen für einen erfüllenden Arbeitsplatz auch bei längerfristig Beschäftigten, Angestellten und Gesellen in der gesamten Dentalbranche gelten. Der folgende Beitrag setzt sich mit dem aktuellen Status quo auseinander.
Kurzer Rückblick auf den Bereich Ausbildung
Gründe für den Ausstieg junger Menschen aus der Zahntechnikbranche nach ihrer Ausbildung bestehen zu einem großen Teil bezogen auf die finanziellen Mittel während und nach der Ausbildungszeit. In meinen zehn Jahren Tätigkeit als Berufsschullehrer an der Landesberufsschule für Zahntechnik in Neumünster habe ich es selbst nicht selten erlebt, dass Azubis nach erfolgreich absolvierter 3,5-jähriger Ausbildung ein Vertragsangebot mit einem Gehalt exakt oder lediglich leicht über dem aktuellen Mindestlohn vorlag. Bemerkenswert ist, dass nur 54 von 327 (das entspricht 16,5 Prozent) aller dualen Ausbildungsgänge in Deutschland1 von dreieinhalbjähriger Dauer sind und die Zahntechnik hier natürlich aufgrund ihrer Komplexität und der Anforderungen an handwerkliche Fähigkeiten beim Umgang mit verschiedensten Materialien und Verarbeitungstechniken hinzuzählt. Bedauerlich ist dabei jedoch die Häufigkeit, in der ein gesetzlicher Mindestlohn2 nach dieser langen Ausbildungszeit überhaupt zur Debatte steht. Handelt es sich tatsächlich um Wertschätzung, wenn Gesellen in anderen Berufen beispielweise mit einer zwei- oder dreijährigen Ausbildung mehr Gehalt winkt als in der Zahntechnik mit dreieineinhalb Jahren?

Der Blick in die Ausbildungsberufe selbst erzeugt bereits richtungsweisende Gedanken: Laut Bericht der HWK Trier3 wird in 14 von den 103 untersuchten Berufen die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung bezahlt. Die Zahntechnik ist in diesen 14,6 Prozent der beteiligten Berufe vertreten. Leider. Nur um einmal einen anschaulichen Vergleich für alle Lesenden zu ermöglichen: Mit auf derselben Stufe der Vergütung stehen Berufe wie Orgel- und Harmoniumbauer, Orthopädietechnikmechaniker, Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, Änderungsschneider und Klempner. Die Spanne der Ausbildungsvergütungen in den 190 durch das BIBB verglichenen Ausbildungsberufen4 ist breit (Berichtsjahr 2023) und die Position der Zahntechnik leider eindeutig:
In der Ausbildung der ZFA liegen die Ausbildungsvergütungen pro Monat zwischen 195 und 233 Euro brutto höher als die der Zahntechniker: 913 Euro im ersten, 988 Euro im zweiten und 1.070 Euro im dritten Lehrjahr. Eine positive Entwicklung – doch auch hier ist noch Luft nach oben. Denn die notwendigen Fähigkeiten auf menschlicher, technischer und fachlicher Ebene sind mit anderen gutbezahlten Ausbildungsgängen und deren Anforderungen definitiv vergleichbar. Natürlich ist nachvollziehbar, dass Betriebe in sehr unterschiedlichem Maß Zeit und Ressourcen in ihre Auszubildenden investieren können. Das hängt oft von der Größe, Struktur und wirtschaftlichen Lage eines Betriebs ab. Dennoch soll dieser Abschnitt vor allem eines tun: Zeigen, welchen hohen Anspruch der Beruf der Zahntechnik mit sich bringt – und damit nach außen ein klares Zeichen setzen, dass diese Ausbildung Wertschätzung verdient. Denn genau das kann ein Schlüssel sein, um dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken: Ein ehrliches, respektvolles Bild des Berufs, das junge Menschen anspricht – nicht nur fachlich, sondern auch menschlich.
| Vergütung mindestens (alle Ausbildungsberufe) | Vergütung maximal (alle Ausbildungsberufe) | durchschnittliche Vergütung (Ausbildungsberuf Zahntechnik) | |
| 1. Lehrjahr | 625,– € | 1.132,– € | 680,– € |
| 2. Lehrjahr | 736,– € | 1.223,– € | 779,– € |
| 3. Lehrjahr | 841,– € | 1.480,– €* | 874,– € |
| 4. Lehrjahr | 935,– € | 1.292,– €* | 935,– € |
Der Blick auf den Arbeitsmarkt
Dass die rosigen Zeiten Geschichte sind (oder waren – wer hält uns davon ab, diese neu zu schreiben?), ist jedem in der Branche klar. Ein genauer Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt, wie es aktuell um die Beschäftigten in der Dentalbranche steht. Hierzu zitiere ich einen LinkedIn- Beitrag des Verbands medizinischer Fachberufe e.V. vom 15.04.20255:
- ZFA und Zahntechniker gehören trotz drei- bzw. dreieinhalbjähriger Ausbildung und hoher Verantwortung zu den am schlechtesten bezahlten Fachkräften im Gesundheitswesen
- 25 Prozent der ZFA verdienten 2023 weniger als 12,57 Euro/Stunde und lagen damit nur knapp über dem Mindestlohn
- Bis 2027 werden über 11.000 qualifizierte ZFA fehlen
- Für das Zahntechniker-Handwerk liegt das Gehalt im Mittel zwar bei 2.982 Euro im Monat (17,22 Euro pro Stunde), aber die Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen liegt bei 19,8 Prozent.
- Nach jahrzehntelanger wichtiger Arbeit droht die Altersarmut
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Lohnunterschiede innerhalb Deutschlands sind gravierend. Laut Berechnungen des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V. verdienen Berufseinsteiger unter vergleichbaren Voraussetzungen (Realschulabschluss, keine Berufserfahrung, kein Tarifvertrag, unbefristeter Vertrag, 40-Stunden-Woche, keine Sonderzahlungen) in Sachsen im Schnitt über 500 Euro weniger im Monat als in Baden-Württemberg. Teilweise liegt das Einkommen damit sogar unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 12,82 Euro (Stand: Januar 20256) – trotz abgeschlossener Ausbildung und voller Berufstätigkeit!

Online-Petition für Mindestlohn in der Dentalbranche
Es verwundert daher nicht, dass der Ruf nach einem Branchenmindestlohn von 17,50 € pro Stunde immer lauter wird. Eine entsprechende Petition des Verbands medizinischer Fachberufe e.V. hat bereits breite Unterstützung erfahren und bringt das auf den Punkt, was in vielen Gesprächen, Umfragen und Erfahrungsberichten mitschwingt: Der finanzielle Wert eines Berufs stimmt oft nicht mit seiner tatsächlichen gesellschaftlichen Bedeutung überein. Die Petition kann online eingesehen und unterstützt werden: www.openpetition.de/petition/online/petition-zum-mindestlohn-in-der-dentalbranche
Doch wie viel ist die Arbeit eines Menschen wert, der täglich hoch konzentriert, kreativ und verantwortungsvoll dafür sorgt, dass Patienten wieder unbeschwert lächeln können? Wie lässt sich diese Kombination aus Feingefühl, Präzision, Teamarbeit und Gesundheitsvorsorge in Euro bemessen?
Zwischen Anspruch und Realität: der Spagat im Handwerk
Zugleich darf nicht ausgeblendet werden, welche Herausforderungen kleine und mittelständische Betriebe zu stemmen haben, um wirtschaftlich überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Höhere Löhne bedeuten auch höhere Belastungen – gerade in einem Handwerk, das oft von Auftragslage, Materialkosten und unregelmäßigen Einnahmen abhängig ist. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, bringt diese Sorge nüchtern auf den Punkt: „Ein zu hoher Mindestlohn setzt die Wettbewerbsfähigkeit weiter herunter, und wir nehmen billigend in Kauf, dass Geschäftsmodelle verloren gehen.“ Dittrich warnte vor Jobverlusten: „Es würde keine Kündigungswellen im Handwerk geben, aber es gibt ein stilles Sterben, weil Meister sagen, das rechnet sich nicht mehr, ich schließe einfach den Laden zu.“7
Auch wirtschaftspolitische Stimmen innerhalb des Handwerks sehen die Dynamik kritisch. Es wird argumentiert, dass eine politische Festlegung des Mindestlohns die Tarifautonomie untergräbt – ein Grundprinzip der deutschen Arbeitsbeziehungen. Zugleich betont der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), dass die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,82 Euro nur ein Zwischenschritt sein kann. „Um Altersarmut zu verhindern, brauchen wir einen Mindestlohn von mindestens 14,50 bis 15 Euro. Die aktuellen Löhne reichen oft nicht zum Leben.“8
Die Debatte dreht sich also nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern auch um soziale Gerechtigkeit – ein Spannungsfeld, das sich im Handwerk besonders deutlich zeigt, da dort viele arbeits- intensive Kleinbetriebe tätig sind.Hier braucht es ein ehrliches Hinsehen: Manche Betriebe zahlen gerne besser, können es aber nicht leisten, ohne an anderer Stelle wirtschaftlich in Schieflage zu geraten. Es geht also nicht um bösen Willen, sondern um systemische Grenzen – die wir aber auch systemisch verschieben können, wenn wir bereit sind, über den Tellerrand hinaus zu denken.
Wertschätzung beginnt nicht erst beim Lohn – zeigt sich aber oft genau dort
Aus meiner Coaching-Perspektive lässt sich sagen: Wertschätzung hat viele Ausdrucksformen. Aber gerade junge Fachkräfte – geprägt durch einen Mix aus Leistungsdruck, Unsicherheiten und Zukunftsangst – achten zunehmend darauf, wo und wie sich echte Anerkennung zeigt. Und ja, Gehalt ist ein zentraler Bestandteil davon.
Ein fairer Lohn signalisiert Vertrauen, stärkt das Selbstbild („Ich bin es wert!“) und beeinflusst direkt, ob jemand langfristig bleibt oder innerlich kündigt. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, „für einen Appel und ein Ei zu schuften“, hilft auch das schönste Betriebsklima irgendwann nicht mehr. Und genau hier setzt die Diskussion an. Sie sollte nicht nur in Euro und Cent geführt werden, sondern auch mit Blick auf Haltung, Struktur und Zukunftsfähigkeit der ganzen Branche.
Was wären also realistische Lösungen?
- Transparenz in der Entlohnung: Offene Gespräche über betriebliche Finanzen, Leistungen und Spielräume – nicht als Rechtfertigung, sondern als Einladung zur Mitgestaltung.
- Stärkere Differenzierung von Einstieg, Erfahrung und Spezialisierung: Warum nicht ein System, das Expertise gezielt belohnt und nicht auf Jahre oder Alter setzt?
- Branchenfonds oder staatlich geförderte Lohnzuschüsse: Gerade für kleinere Betriebe könnten solche Modelle ein Ausgleich sein, um faire Löhne zu ermöglichen, ohne wirtschaftlich zu scheitern.
- Verzahnung mit Fortbildung und Verantwortung: Höheres Gehalt kann an Weiterbildungsbereitschaft, Teamverantwortung oder Innovationsideen geknüpft sein.
Fazit
Zukunft sichern heißt Wert vermitteln
Die Frage nach dem Mindestlohn ist keine Frage des Geldes allein. Es ist eine Frage der Haltung gegenüber einem Berufsfeld, das zwischen Hochtechnologie, Handwerk und Patientenzuwendung balanciert. Wenn wir die Zukunft der Zahntechnik sichern wollen, müssen wir nicht nur über Gehalt reden, sondern über den gesamten Rahmen, in dem Arbeit stattfindet. Und das beginnt bei der Art, wie wir über Berufsstolz, Potenzial und gesellschaftlichen Beitrag sprechen. Schon damals hatten meine Auszubildenden in der Berufsschule ähnliche Aspekte geäußert. Denn die Punkte Kommunikation, Wertschätzung, Sicherheit und Vertrauen waren damals bereits im Fokus.
Denn Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, bleiben im Betrieb. Sie entwickeln sich und sie gestalten gemeinsam Zukunft.
* Für den aufmerksamen Leser – die Zahlen sind korrekt: Die maximale Ausbildungsvergütung bei dreieinhalbjährigen Ausbildungen liegt unterhalb des Höchstwertes der dreijährigen Ausbildungen. Hintergrund: Die dreijährige Ausbildung als Gerüstbauer gibt mit 1.480 Euro im dritten Lehrjahr den Höchstwert vor. Von den dreieinhalbjährigen Ausbildungen schafft es der Chemikant auf 1.292 Euro und gibt daher die Obergrenze für das 4. Lehrjahr vor.
Dieser Beitrag ist in der ZT Zahntechnik Zeitung erschienen.


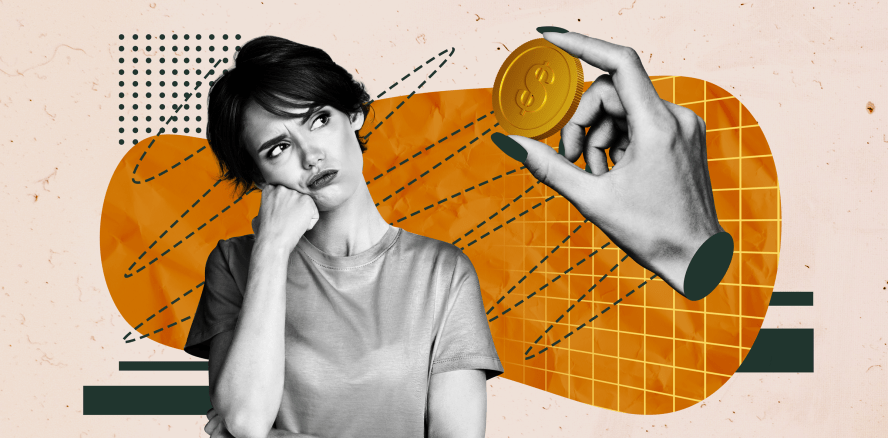
 3-Layer FLEX
3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen
3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML
DD cube X® ML  DD Incisal X
DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben
DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link
DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX
DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI
DD Bio Splint P HI  DD cube case
DD cube case  DD Shade Guide
DD Shade Guide 







