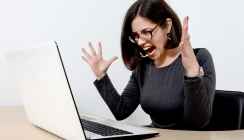Praxismanagement 17.02.2017
Mythos Benchmarking: Sinn und Unsinn von Praxisvergleichen
share
Sobald das Wort „Benchmarking“ fällt, werden unternehmerisch interessierte Praxisinhaber hellhörig. Mit Benchmarking wird die Hoffnung auf Erkenntnisse verbunden, die die eigene Standortbestimmung ermöglichen und anzeigen, an welchen Stellen noch Potenziale schlummern. Das Prinzip ist einleuchtend und stellenweise auch gut, hat allerdings in Bezug auf Zahnarztpraxen enge Grenzen. Wer die Parameter nicht hinterfragt, läuft Gefahr „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen und schiefe Schlussfolgerungen zu ziehen. Dieser Fachbeitrag erläutert Hintergründe und bietet Lösungsideen.
Benchmarking ist eine Managementmethode zielgerichteter Vergleiche, die es den teilnehmenden Praxen ermöglichen soll, sich an den jeweils besten der Gruppe zu orientieren und aus Abweichungen für die eigene Praxis Optimierungspotenziale zu erkennen. Das hört sich zunächst mal gut an. Allerdings ist das so beliebte (weil einfache) betriebswirtschaftliche „Kennzahlen-Benchmarking“ für Zahnarztpraxen in der konkreten Anwendung mit Vorsicht zu genießen, weil es kaum Praxen gibt, die hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer Ressourcen und ihrer Leistungsstruktur identisch aufgestellt sind. Sobald die Praxiskonzepte auch nur in Details voneinander abweichen, ergeben sich veränderte Werte. Die im Benchmarking (übrigens auch in DATEV-Betriebsvergleichen) praktizierte Bildung von Praxisgruppen nach Umsatzklassen suggeriert Vergleichbarkeit, überwindet aber das Problem der unterschiedlichen Praxiskonzepte nicht. Die Aussagekraft ist deshalb immer kritisch zu hinterfragen. Nachfolgend werden einige Beispiele dargestellt, die die Grenzen der Vergleichbarkeit veranschaulichen beziehungsweise weiterführende Lösungsansätze bieten:
Materialkostenquote
Die Materialkostenquote einer Praxis (ohne Praxislabor) kann mit 6 Prozent schon zu hoch sein, aber auch
bei völlig gesunden 11 Prozent liegen.
Es ist ein Unterschied, ob in einer
Praxis mit beispielsweise 2 Millionen Euro Umsatz 100 Implantate pro Jahr gesetzt werden oder 350 Implantate oder gar keines. Wo viel private Endo-Leistung stattfindet, ist die Materialquote deutlich höher als in der Praxis,
die nur Kassen-Endo anbietet. Sobald CEREC zum Leistungsspektrum gehört, steigt auch die Materialkostenquote. Soll heißen: Eine Orientierung
an der Materialkostenquote der augenscheinlich „besten“ Praxis wäre nur im theoretischen Fall komplett
identischer Honorargröße und Leistungsstruktur sinnvoll.
Allerdings: In diesem Feld steckt die Chance eines Benchmarkings von Prozessabläufen. Und das kann sehr sinnvoll sein: Wer sich mit Kollegen dazu austauscht, wie sie die Warenwirtschaft in ihrer Praxis organisieren, bekommt vielleicht Erkenntnisse für ei nen klugen Weg der Digitalisierung des Einkaufs. Hier setzt die Praxis mit den effektivsten Prozessabläufen den Benchmark, von dem andere profitieren können.
Honorarumsatz pro Behandlungseinheit
Diese Kennzahl klingt zunächst interessant. Aber was sagt das Ergebnis? Kann der höchste Umsatz pro Behandlungseinheit (ermittelt aus einer Gruppe von Praxen) als Orientierungsgröße für alle anderen dienen? Nein, kann er nicht. Dazu folgende Beispiele:
- Ein hoher Durchsatz von Prophlyaxeleistungen wirkt ebenso reduzierend auf den Honorarumsatz pro Behandlungseinheit wie die Kinderzahnheilkunde.
- Die Spreizung des Schichtdienstes wirkt umsatzsteigernd pro Behandlungseinheit, bedeutet aber auch gleichzeitig einen satten Anstieg von Fixkosten im Personalbereich und steigert die Komplexität in der Organisation.
- Praxen mit Spezialistenkonzept in Endo und Implantologie haben im Vergleich zu Praxen, die sich auf PAR, Prophylaxe oder Kinderbehandlung konzentrieren, ein grundlegend anderes Zahlenniveau.
- Praxen, die ihren Zahnärzten (ggf. zeitweise) zwei Zimmer parallel zur Verfügung stellen und klug terminieren, haben einen niedrigeren Umsatz pro Zimmer, erreichen damit aber eine höhere Produktivität auf der Zahnarztstelle. Es steigen dadurch die Honorarstundensätze des Zahnarztes.
Und das ist in diesem Fall der Weg zu einem BWL-Parameter, der im Benchmarking gut funktioniert:
Honorarstundensätze
Ein Vergleich der in verschiedenen Praxen erzielten
Stundensätze ist erhellend, weil sich daraus substanzstarkes
Brainstorming ergeben kann. Auch hier ist
natürlich darauf zu achten, sich nur an dem tatsächlich
Vergleichbaren zu orientieren: Der Endo-Spezialist
am Endo-Spezialist und nicht an dem Kollegen, der
die allgemeine Zahnheilkunde abdeckt. Den Routinier
nicht mit dem Berufsanfänger gleichsetzen und die
Zahnmedizinische Fachassistentin nicht mit der Dentalhygienikerin,
die alle PARs der Praxis übernimmt.
Und den Spezialisten für Kinderzahnheilkunde nicht
mit dem Kollegen in ein Boot setzen, der nur Erwachsene
behandelt.
Ansatzpunkte für die Steigerung von Honorarstundensätzen könnten sein (Auszug):
- Organisationsgrad (Terminierung/Patientensteuerung optimieren, einheitliche Behandlungsleitlinien etablieren etc.)
- Einheitliche Dokumentationsstandards und konsequente Abrechnung
- teameinheitliche Sprachregelungen in der Patientenberatung erarbeiten
- Qualifizierungsstand der Assistenzen steigern
- Erweiterung der Raumkapazitäten
- Veränderung der Patienten-Zahnarzt-Relation (mehr oder weniger Patienten pro Zahnarzt – je nach Ausgangslage).
Personalkostenquote
Personalkostenquoten (Anteil der Personalkosten
am Gesamtumsatz der
Praxis) entziehen sich jeglicher Vergleichsfähigkeit.
18 Prozent klingt nach
wenig, kann bei einer kleinen EndoPraxis
aber schon viel sein. 60 Prozent
wirkt hoch, kann bei einem großen
Betrieb (Z-MVZ) in der Expansionsphase
aber durchaus passen.
Es kommt immer auf die Inhaberstruktur
und das Praxiskonzept an. Viele
Details haben Einfluss auf die Personalkostenquote
(Praxislabor ja/nein,
Anzahl und Umfang Wochenstunden
der Inhaber bzw. angestellten Zahnärzte, Leistungsspektrum der Praxis,
Prophylaxeanteil am Gesamthonorar
der Praxis, Vergütung mitarbeitender
Ehepartner, Gestaltung des Führungsteams
und vieles mehr). Auch die
Phase, in der sich eine Praxis gerade
befindet (Wachstumsphase, Konsolidierungsphase,
Einbindung weiterer
Standorte, Erweiterung auf Spezialistenkonzept
etc.) hat Auswirkung auf
die Personalkostenquote.
Im Hinblick auf Personal ist Folgendes entscheidend:
- Der laufende Check der Produktivkräfte (Honorarstundensätze von Zahnärzten und Prophylaxespezialisten verfolgen)
- Bei jeder Einstellung von angestellten Zahnärzten und Prophylaxespezialisten darauf achten, dass eine zur Praxiskultur passende, wirtschaftlich ausgewogene und außerdem rechtssichere Vergütungsgestaltung stattfindet.
- Personalkostenstruktur im Blick halten (Personalkostenanteil der Verwaltung plus ggf. externe Abrechnungskräfte, Personalkostenanteil im Labor etc.)
- Verfolgung von Krankenstand und Fluktuation (das sind die Gradmesser für Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation des Teams mit der Praxis)
- Schrittweise Professionalisierung des Personalmanagements, das gilt insbesondere für wachstumsorientierte Praxen (siehe Veröffentlichung ZWP Oktober 2016)
- Vorausschauende Personalkostenkalkulation im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Gesamtplanung (umso wichtiger je größer die Praxis ist)
Fazit
Aus den dargestellten Gründen ist dringend zu warnen vor unternehmerischen Entscheidungen, die rein aus Betriebsvergleichen abgeleitet werden. Nur einige wenige Kennzahlen sind für Zahnarztpraxen Benchmarking-tauglich.
Davon unabhängig können Benchmarking-Seminare sehr sinnvoll sein, weil der vertrauensvolle Austausch mit Kollegen, die ähnlich „unterwegs“ sind, über Zahlen und vor allem auch Prozessabläufe das Querdenken anregt und vielfältige, bereichernde Impulse für die eigene Praxisführung bietet. Ergänzend sinnvoll ist ein praxisindividuelles Controlling, mit dem die Zukunftsziele der Praxis in geeignete Kennzahlen oder Messgrößen transferiert und regelmäßig aktiv verfolgt werden.
Dieser Beitrag erschien erstmalig in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 1+2/17.