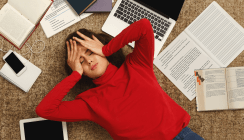Psychologie 08.03.2023
Wenn Selbstzweifel aus dem Ruder geraten
share
Das Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt, ist in unserer Gesellschaft weitverbreitet und betrifft dabei in besonderem Maße die Berufsgruppe der Mediziner. Schon Studierende leiden zu einem erstaunlich hohen Prozentsatz an überstarken Selbstzweifeln und einer ausgeprägten Angst, als Betrüger aufgedeckt zu werden. Auch Zahnmediziner sind von dem Phänomen betroffen. Dr. Michaela Muthig war langjährige Fachärztin für Psychosomatik und ärztliche Psychotherapie am Universitätsklinikum Tübingen und bietet seit 2019 als selbstständige Coachin Hilfe für Menschen mit Imposter-Syndrom. Welche Merkmale das Syndrom umfasst und wie Selbsthilfe für Betroffene aussehen kann, verrät unser Interview mit der erfahrenen Ärztin.
Frau Dr. Muthig, was unterscheidet das Hochstapler-Syndrom von „gesunden“ Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten?
Normale Selbstzweifel hat jeder einmal. Denn wenn wir eine neue Aufgabe beginnen, können wir noch gar nicht einschätzen, ob wir die Fähigkeiten dazu haben. Mit der Zeit aber werden normale Selbstzweifel besser. Wir lernen aus unseren Erfolgen und fühlen uns immer sicherer. Beim Hochstapler-Syndrom dagegen sind die Betroffenen „lernresistent“. Obwohl sie gut sind, Erfolge erleben und Anerkennung bekommen, bleibt doch der Gedanke „Ich bin nicht gut genug“. Ihre Erfolge erklären sie sich durch Zufall („Ich hatte Glück, dass genau das dran kam, was ich gelernt habe“) oder Sympathie („Der Chef hat mich nur gelobt, weil er nett sein wollte“) und erkennen nicht, dass sie das nötige Wissen haben. Je mehr Anerkennung sie bekommen, desto mehr geraten Menschen mit Imposter-Syndrom unter Druck, weil sie denken, dass sie die immer höher werdenden Erwartungen nicht erfüllen können.
Krank machende Zweifel an der eigenen Kompetenz
Das Hochstapler-Syndrom ist ein häufiges Phänomen, bei dem Menschen sich trotz guter Ausbildung und nachweisbaren Erfolgen immer noch nicht gut genug fühlen. Sie leben in Angst, irgendwann könnte jemand merken, dass sie ja keine Ahnung haben, und sie als Hochstapler enttarnen. Im Gegensatz zu echten Hochstaplern aber haben sie die nötige Qualifikation und sind in der Regel sehr gut, meist sogar exzellent. Die Überzeugung von der eigenen Inkompetenz ist also falsch. Informationen zu den Coaching-Angeboten von Dr. Michaela Muthig unter: www.coaching-azur.de
Gerade Medizinstudierende und ausgebildete Mediziner leiden unter dem Imposter-Syndrome – gibt es eine Verbindung zwischen bestimmten Berufsfeldern und dem Hochstapler-Syndrom? Oder anders gefragt, bedingen bestimmte Berufseigenschaften das Auftreten der Krankheit?
Prinzipiell sind wir besonders gefährdet, wenn wir eine Vorreiterrolle übernehmen (z. B. der erste in der Familie sind, der studiert), wenn wir einer Minderheit angehören oder wenn wir in einer Position sind, die exponierter und mehr der Bewertung ausgesetzt ist. Dies ist beim (Zahn-)Arztberuf der Fall. Im Medizinerberuf kann ein Fehler massive Konsequenzen haben, er bringt eine sehr hohe Verantwortung mit sich. Daher ist die Angst vor einem Fehler oder einem Versagen dort auch stärker. Zudem ist der Arztberuf immer noch mit hohen Erwartungen versehen, während gleichzeitig der Patient zunehmend kritischer ist, sich vorher online informiert und bestimmte Ansprüche mit sich bringt, die der Arzt aber nicht immer erfüllen kann. Gerade dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können, verstärkt sich das Hochstapler-Syndrom. Zudem wird immer noch unbewusst dem Arzt die Rolle des Retters übergestülpt. Er gilt als Autorität, die möglichst alles wissen sollte, um den Patienten adäquat zu helfen. Alles zu wissen, ist aber unmöglich, und so geraten Ärzte ganz besonders unter Druck und haben Schwierigkeiten, zuzugeben, dass auch sie vielleicht gerade ratlos sind.
Das Hochstapler-Syndrom scheint eine Erscheinung der Moderne – ist das so?
Das Phänomen ist noch relativ jung, es wurde in den 1980er-Jahren erstmals beschrieben. Doch nur, weil es vorher nicht bekannt war, heißt das nicht, dass es nicht schon existierte. Ich bin vielmehr der Überzeugung, dass es diese massiven Selbstzweifel schon immer gegeben hat. Jedoch finden sie jetzt mit unserer Leistungsgesellschaft und der immer stärker werdenden Öffentlichkeit durch soziale Medien, wo wir uns immer mehr mit retuschierten Idealbildern konfrontiert sehen, den idealen Nährboden. Daher haben diese Selbstzweifel in den letzten Jahrzehnten zugenommen und werden es sicher noch weiter tun, bis wir von dieser „Höher, schneller, weiter“-Devise wieder wegkommen.
Was kann man tun, wenn man merkt, dass man von ausgeprägten Imposter- Zweifeln geplagt ist? Gibt es einen Quick-Fix oder muss man in jedem Fall eine Therapie absolvieren?
Nicht immer sind gleich eine langes Coaching oder eine Therapie nötig. Das Imposter-Syndrom ist an sich keine Krankheit, eine Therapie ist daher nur dann nötig, wenn die Selbstzweifel so stark werden, dass daraus eine Angststörung, eine Erschöpfungsdepression oder andere körperliche oder psychische Erkrankungen entstehen. Leichtere Ausprägungen des Hochstapler-Syndroms lassen sich gut auch allein in den Griff bekommen. Das erste und wichtigste ist: Zu wissen, dass es dieses Phänomen gibt, dass es häufig auftritt und man sich damit in bester Gesellschaft befindet. Das kann schon ungemein entlasten. Gut ist auch, darüber zu sprechen und so die Erfahrung zu machen, dass auch andere mit den gleichen Zweifeln zu kämpfen haben, sich gegenseitig zu stärken und darüber auszutauschen. Außerdem kann es helfen, sich die eigenen Erfolge bewusst zu machen. Die eigenen Bewertungen zu hinterfragen („Würde ich das auch so sehen, wenn nicht ich, sondern mein Kollege diesen Fehler gemacht hätte? Wäre ich dann auch so kritisch?“) ist darüber hinaus wichtig. Und ganz zentral: Sich deutlich zu machen, dass man nicht unfähig ist, nur weil man sich so unfähig fühlt. Auch bei einer Sonnenbrille sieht man die Welt dunkler als sie ist, aber man weiß, dass die eigene Wahrnehmung trügt. Genauso ist es beim Hochstapler-Syndrom. Sich dieser Tatsache bewusst zu sein, ist der erste Weg raus aus der Hochstapler-Falle.
Kann man dem Imposter-Syndrom durch eine bestimmte Denkweise oder mit einem gezielten „Kopf“-Training oder anderen Ansätzen vorbeugen?
Ja, die Ansätze sind ähnlich wie oben schon als Quick-Fix beschrieben: Sich auf die Stärken und nicht auf die Schwächen fokussieren. Lob annehmen, ohne die eigene Leistung gleich wieder kleinzureden. Mit sich selbst so umgehen, wie man mit dem besten Freund umgehen würde: Bei Fehlern aufrichten, vor Herausforderungen ermutigen und sich immer wieder sagen „Das schaffe ich“. Von den eigenen zu hohen Erwartungen wegkommen, denn wir können Perfektion zwar anstreben, aber nie erreichen. Und außer uns erwartet das auch kaum jemand. Stolz sein auf die eigene Leistung und kleine Fehler nicht überbewerten. Wenn man mit sich selbst so wohlwollend umgeht, ist man schon sehr gut gewappnet gegen ungesunde, ausufernde Selbstzweifel.
Studien belegen überproportionales Auftreten
Vielfache Fachartikel und Studien der letzten Jahre zeigen, wie ausgebreitet das Imposter-Syndrom unter Medizinstudierenden ist. Zum Beispiel zeigt die amerikanische Studie der University of Kentucky „Association between Characteristics of Impostor Phenomenon in Medical Students and Step 1 Performance“1, dass unter 233 Studierenden im Fach Medizin das Syndrom überproportional auftritt. Auch die Wochenzeitung DIE ZEIT berichtete im vergangenen Jahr über das weitverbreitete Vorkommen des Imposter-Syndroms im akademischen Milieu.2
1 Shreffler J., et al. Association between Characteristics of Impostor Phenomenon in Medical Students and Step 1 Performance. Teach Learn Med. 2021 Jan–Mar;33(1):36–48. „doi: 10.1080/10401334.2020.1784741“ _blank. Epub 2020 Jul 7. PMID: 32634054.
2 Klaue, Magnus S. „Hochstapler wie die anderen“. ZEIT ONLINE, 25. April 2022.
Dieser Beitrag ist in der ZWP Zahnarzt Wirschaft Praxis erschienen.